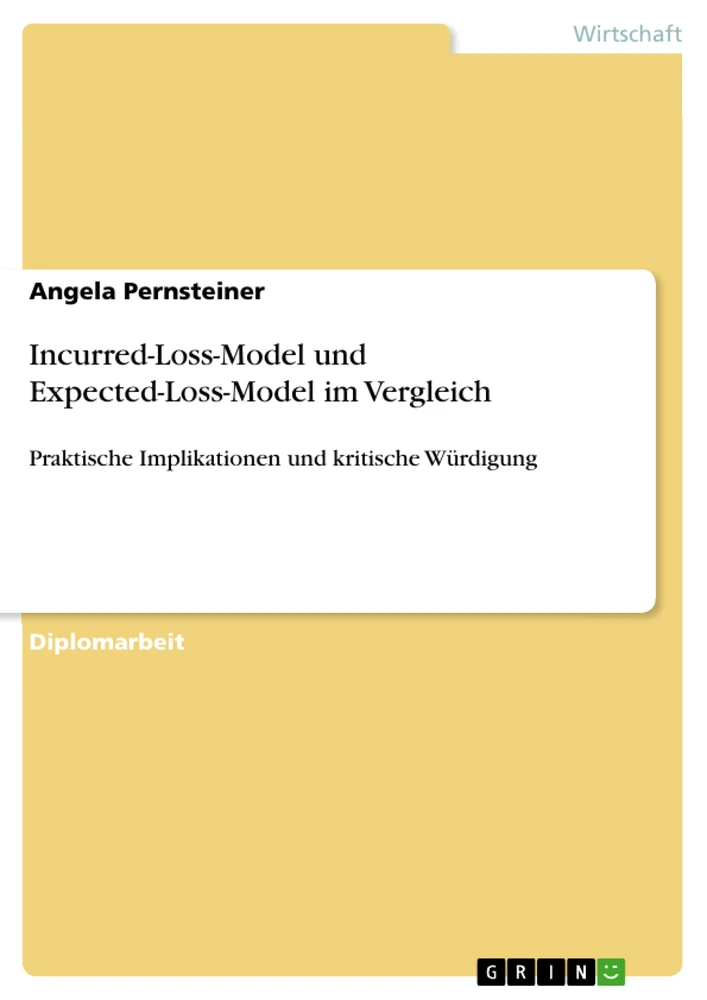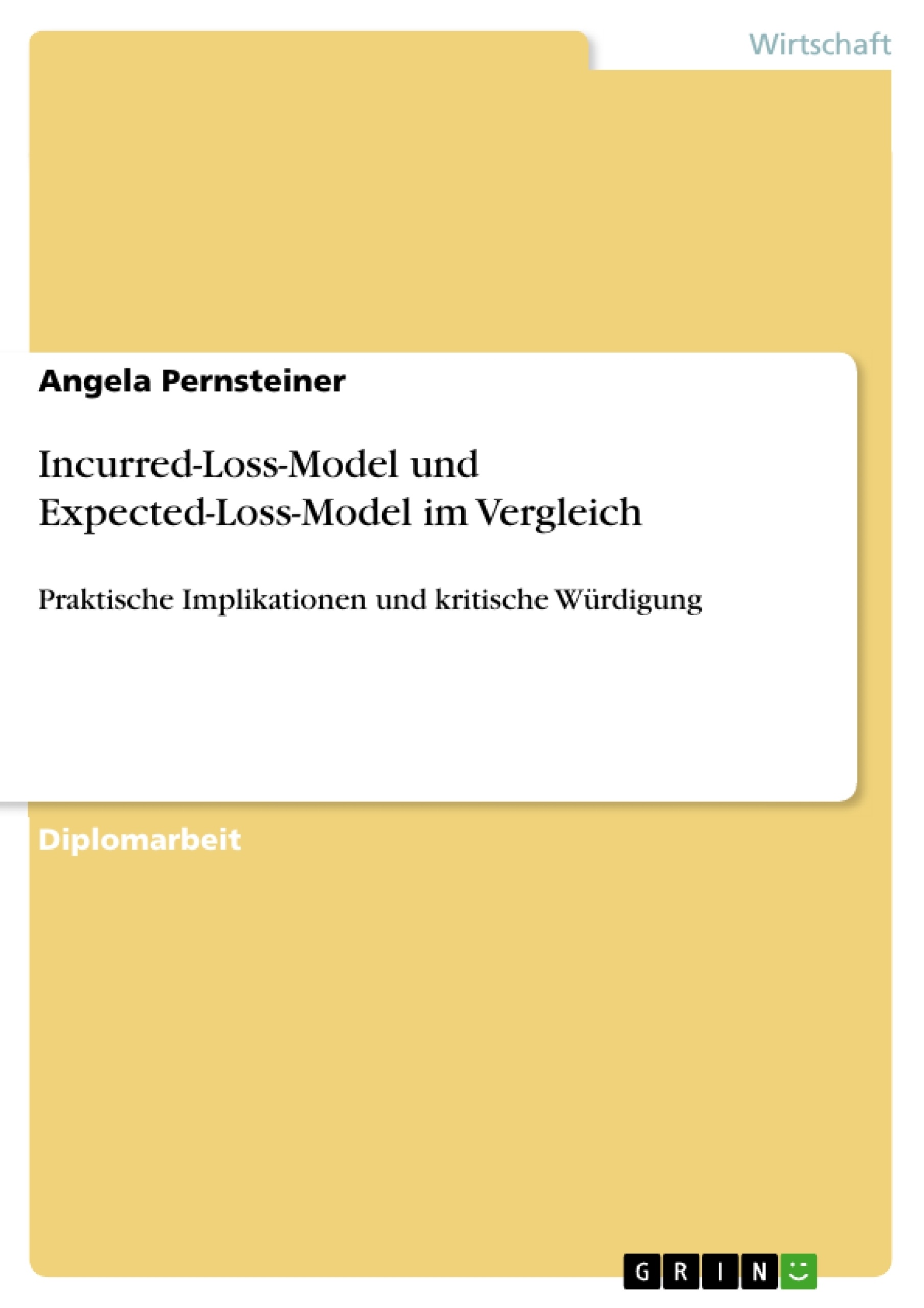Gegenstand der vorliegenden Arbeit soll eine kritische Analyse des Incurred-Loss-Model und des Expected-Loss-Model sowie dessen praktische Implikationen sein. Phase I Classification and Measurement sowie Phase III Hedge Accounting des Replacement-Projektes werden zwar eingangs kurz beleuchtet, allerdings nicht im Detail beschrieben, da sich die Arbeit voll umfänglich der Phase II Amortised Cost and Impairment widmet.
Während die Untersuchung des aktuellen Incurred-Loss-Model gemäß IAS 39 sowie die angeführten Unzulänglichkeiten dieses gegenwärtig vorherrschenden Modells nur als Einführung und als Basis für weitere Abhandlungen gedacht sind, wird der Fokus der Arbeit auf dem Expected-Loss-Model liegen. Hauptziel ist es, die Entwicklungsschritte des Expected-Loss-Model von der Veröffentlichung des ED/2009/12 „Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment“ im November 2009 bis hin zum Diskussionstand des IASB im Dezember 2010 aufzuzeigen und einen strukturierten Überblick über die damit einhergehenden Varianten und Modifikationen eines Expected-Loss-Model zu geben. Ein Teilziel der Arbeit ist somit auch die Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Expected-Loss-Model gemäß ED/2009/12 sowie des Expected-Loss-Model mit Stand Dezember 2010. Praktische Beispiele sollen die Unterschiede veranschaulichen und klar exemplifizieren.
Als weiteres Teilziel kann die Darlegung alternativer Modelle zur Bewertung von Kreditrisiken gesehen werden, deren Vor- und Nachteile sowie Implikationen aufgegriffen und mit Hilfe von aktueller wissenschaftlicher Literatur diskutiert werden.
Obwohl der Fokus der Arbeit auf der Behandlung von Wertberichtigungen im Rahmen der internationalen Rechnungslegung liegt, werden einige Aspekte im Hinblick auf die Thematik der Wertminderung gemäß österreichischem sowie US-amerikanischem Recht geschildert werden. Nicht behandelt wird diese Materie in Bezug auf das deutsche Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz.
Die vorliegende Arbeit bezieht sämtliche Änderungen der Rechtslage bis zum 01. Dezember 2010 ein. Falls nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, ist mit Expected-Loss-Model das Modell des Standardsetter IASB gemeint.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Zielsetzung
- 1.3. Methodik
- 1.4. Aufbau der Arbeit
- 2. Einführung von IFRS 9 – Ersetzung von IAS 39
- 2.1. Phase I - Classification and Measurement
- 2.2. Phase II - Amortised Cost and Impairment
- 2.3. Phase III - Hedge Accounting
- 3. Aktuelles Incurred-Loss-Model des IAS 39
- 3.1. Zugangsbewertung
- 3.2. Folgebewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten
- 3.3. Ausweis
- 3.4. Anhangangaben
- 3.5. Kritik am Incurred-Loss-Model
- 4. Entwicklung des Expected-Loss-Model
- 4.1. An der Entwicklung des Expected-Loss-Model beteiligte Gremien
- 4.2. Fortschritte in der Entwicklung des Expected-Loss-Model
- 4.3. Das Expected-Loss-Model des IASB mit Stand Dezember 2010
- 5. Alternative Modelle
- 5.1. Das Expected-Loss-Model des FASB
- 5.2. Das Expected-Loss-over-the-Life-of-the-Portfolio-Model der EBF
- 5.3. Fair-Value-Model
- 5.4. Dynamic Provisioning
- 5.5. Das Modell der spanischen Bankenaufsicht
- 6. Praktische Implikationen des Expected-Loss-Model
- 6.1. Konvergenz IAS 39/IFRS 9 und UGB
- 6.2. Konvergenz IAS 39/IFRS 9 und US-GAAP
- 6.3. Allgemeine Herausforderungen des Expected-Loss-Model
- 6.4. Spezifische Herausforderungen des Expected-Loss-Model für nicht-finanzielle Institutionen
- 7. Vergleich und kritische Würdigung der Modelle
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit vergleicht das Incurred-Loss-Model mit dem Expected-Loss-Model und beleuchtet deren praktische Implikationen sowie deren kritische Punkte. Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Modelle aufzuzeigen und deren Anwendbarkeit zu bewerten.
- Vergleich des Incurred-Loss- und des Expected-Loss-Modells
- Analyse der praktischen Implikationen beider Modelle
- Kritische Würdigung der Stärken und Schwächen beider Modelle
- Bewertung der Anwendbarkeit der Modelle in verschiedenen Kontexten
- Untersuchung der Konvergenz mit anderen Rechnungslegungsstandards
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, beschreibt die Problemstellung, die Zielsetzung der Arbeit und die angewandte Methodik. Es skizziert den Aufbau der Arbeit und legt die Grundlage für die nachfolgenden Kapitel, welche sich eingehend mit dem Vergleich des Incurred-Loss- und des Expected-Loss-Modells auseinandersetzen. Die Problemstellung wird als die Notwendigkeit eines umfassenden Vergleichs der beiden Modelle zur besseren Beurteilung ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile formuliert. Die Zielsetzung ist klar definiert, um einen strukturierten und informativen Überblick über die beiden Modelle und ihre Auswirkungen zu bieten.
2. Einführung von IFRS 9 – Ersetzung von IAS 39: Dieses Kapitel präsentiert die Einführung von IFRS 9 als Nachfolger von IAS 39 und beschreibt die drei Phasen des Übergangs, "Classification and Measurement", "Amortised Cost and Impairment" und "Hedge Accounting". Es wird detailliert auf die Änderungen und Neuerungen eingegangen, die mit der Einführung von IFRS 9 verbunden sind und wie diese sich auf die Bewertung von Finanzinstrumenten auswirken. Die Bedeutung dieser Veränderungen für die zukünftige Rechnungslegungspraxis wird hervorgehoben.
3. Aktuelles Incurred-Loss-Model des IAS 39: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Incurred-Loss-Model gemäß IAS 39, einschließlich der Zugangsbewertung, der Folgebewertung, des Ausweises und der notwendigen Anhangangaben. Es beleuchtet die Mechanismen der Wertberichtigung und Uneinbringlichkeit sowie das Konzept des "Unwinding". Kritische Punkte des Modells werden herausgearbeitet und bilden einen wichtigen Bezugspunkt für den Vergleich mit dem Expected-Loss-Model in späteren Kapiteln. Die Diskussion der Schwächen legt die Grundlage für die Argumentation der Vorteile des Expected-Loss-Modells.
4. Entwicklung des Expected-Loss-Model: Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung des Expected-Loss-Modells, beginnend mit den beteiligten Gremien und den Fortschritten in der Entwicklung. Es analysiert verschiedene Aspekte der Diskussionen des IASB, wie z.B. den Ausblickszeitraum für erwartete Verluste, die zu berücksichtigenden Bedingungen bei der Berechnung der erwarteten Verluste und die Zuteilung der anfänglichen Schätzung des erwarteten Verlusts. Es beinhaltet auch einen Exkurs zum "good book-bad book-approach" und präsentiert schließlich das Expected-Loss-Model des IASB zum Stand Dezember 2010 mit seinen Besonderheiten in Bezug auf Zugangs- und Folgebewertung, Ausweis und Anhangangaben. Das Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Entstehung und die Details des Modells.
5. Alternative Modelle: Dieses Kapitel stellt verschiedene alternative Modelle zur Bewertung von Finanzinstrumenten vor, darunter das Expected-Loss-Model des FASB, das Expected-Loss-over-the-Life-of-the-Portfolio-Model der EBF, das Fair-Value-Model, Dynamic Provisioning und das Modell der spanischen Bankenaufsicht. Es vergleicht diese Modelle kurz mit dem Incurred-Loss- und dem Expected-Loss-Model und beleuchtet deren Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Die Darstellung der Alternativen bereichert den Vergleich und bietet einen breiteren Kontext für die Beurteilung der Modelle.
6. Praktische Implikationen des Expected-Loss-Model: Dieses Kapitel behandelt die praktischen Implikationen des Expected-Loss-Modells, einschließlich der Konvergenz mit UGB und US-GAAP sowie der allgemeinen und spezifischen Herausforderungen für nicht-finanzielle Institutionen. Es analysiert die praktischen Probleme und Schwierigkeiten bei der Implementierung des Modells und bewertet deren Auswirkungen auf die Praxis der Rechnungslegung. Die Darstellung der Herausforderungen trägt zur kritischen Würdigung der Modelle bei.
Schlüsselwörter
Incurred-Loss-Model, Expected-Loss-Model, IFRS 9, IAS 39, Finanzinstrumente, Wertberichtigung, Ausfallrisiko, Rechnungslegung, Banken, Bewertung, Konvergenz, US-GAAP, UGB.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Vergleich des Incurred-Loss- und Expected-Loss-Modells
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit vergleicht das Incurred-Loss-Model (nach IAS 39) mit dem Expected-Loss-Model (nach IFRS 9) und untersucht deren praktische Implikationen und kritische Punkte. Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Modelle aufzuzeigen und deren Anwendbarkeit zu bewerten.
Welche Modelle werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht detailliert das Incurred-Loss-Model des IAS 39 mit dem Expected-Loss-Model des IFRS 9. Zusätzlich werden alternative Modelle wie das Expected-Loss-Model des FASB, das Expected-Loss-over-the-Life-of-the-Portfolio-Model der EBF, das Fair-Value-Model, Dynamic Provisioning und das Modell der spanischen Bankenaufsicht kurz vorgestellt und verglichen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die Einführung von IFRS 9 als Nachfolger von IAS 39, eine detaillierte Beschreibung beider Modelle (einschließlich Zugangsbewertung, Folgebewertung, Ausweis und Anhangangaben), die Entwicklung des Expected-Loss-Modells, die Analyse der praktischen Implikationen (Konvergenz mit UGB und US-GAAP, Herausforderungen für Finanz- und Nicht-Finanzinstitutionen) und eine kritische Würdigung der Stärken und Schwächen beider Modelle.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung (Problemstellung, Zielsetzung, Methodik), Einführung von IFRS 9, Beschreibung des Incurred-Loss-Modells, Entwicklung des Expected-Loss-Modells, Darstellung alternativer Modelle, praktische Implikationen des Expected-Loss-Modells und schließlich ein Vergleich und eine kritische Würdigung der Modelle.
Welche sind die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Incurred-Loss- und dem Expected-Loss-Model?
Der Hauptunterschied liegt im Zeitpunkt der Wertberichtigung. Das Incurred-Loss-Model berücksichtigt Verluste erst, wenn sie eingetreten sind (Incurred Loss), während das Expected-Loss-Model erwartete Verluste über die gesamte Laufzeit des Finanzinstruments (Expected Loss over the Life) berücksichtigt. Dies führt zu einer früheren und vorausschauenderen Bewertung von Risiken.
Welche praktischen Implikationen hat die Einführung des Expected-Loss-Modells?
Die Einführung des Expected-Loss-Modells hat erhebliche praktische Implikationen, insbesondere für die Bewertung von Finanzinstrumenten und die Risikovorsorge. Es ergeben sich Herausforderungen bei der Implementierung, der Datenbeschaffung und der Berechnung der erwarteten Verluste. Die Konvergenz mit anderen Rechnungslegungsstandards wie UGB und US-GAAP wird ebenfalls thematisiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Incurred-Loss-Model, Expected-Loss-Model, IFRS 9, IAS 39, Finanzinstrumente, Wertberichtigung, Ausfallrisiko, Rechnungslegung, Banken, Bewertung, Konvergenz, US-GAAP, UGB.
Wo finde ich weitere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Zusammenfassung der einzelnen Kapitel im Inhaltsverzeichnis der Arbeit bietet eine detaillierte Übersicht über die jeweiligen Themengebiete und die dort behandelten Inhalte.
- Quote paper
- Angela Pernsteiner (Author), 2010, Incurred-Loss-Model und Expected-Loss-Model im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171101