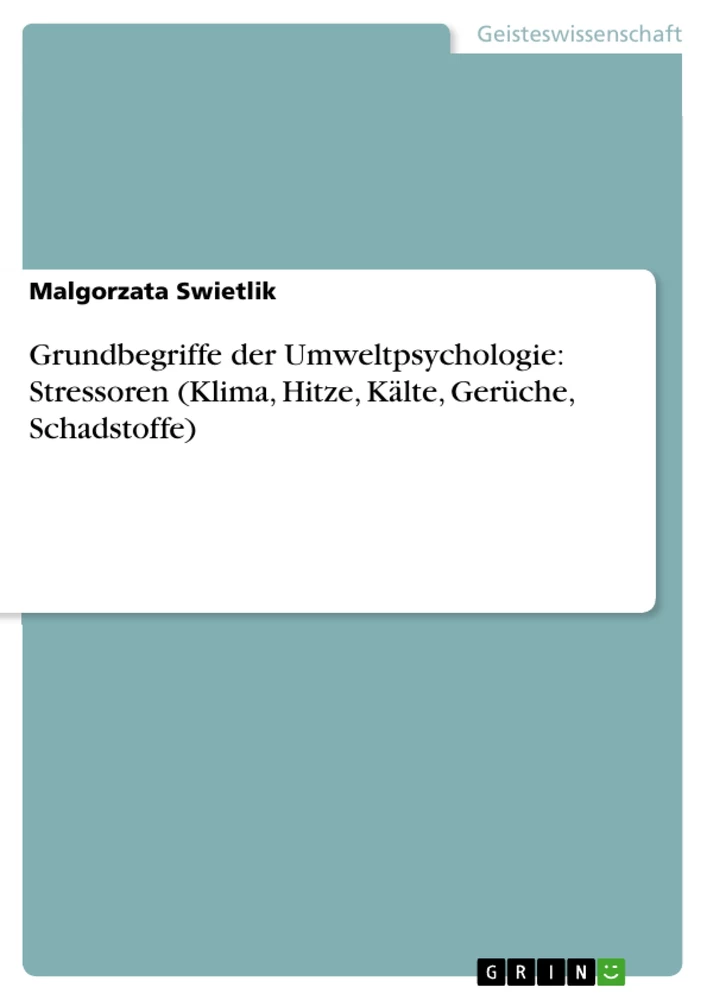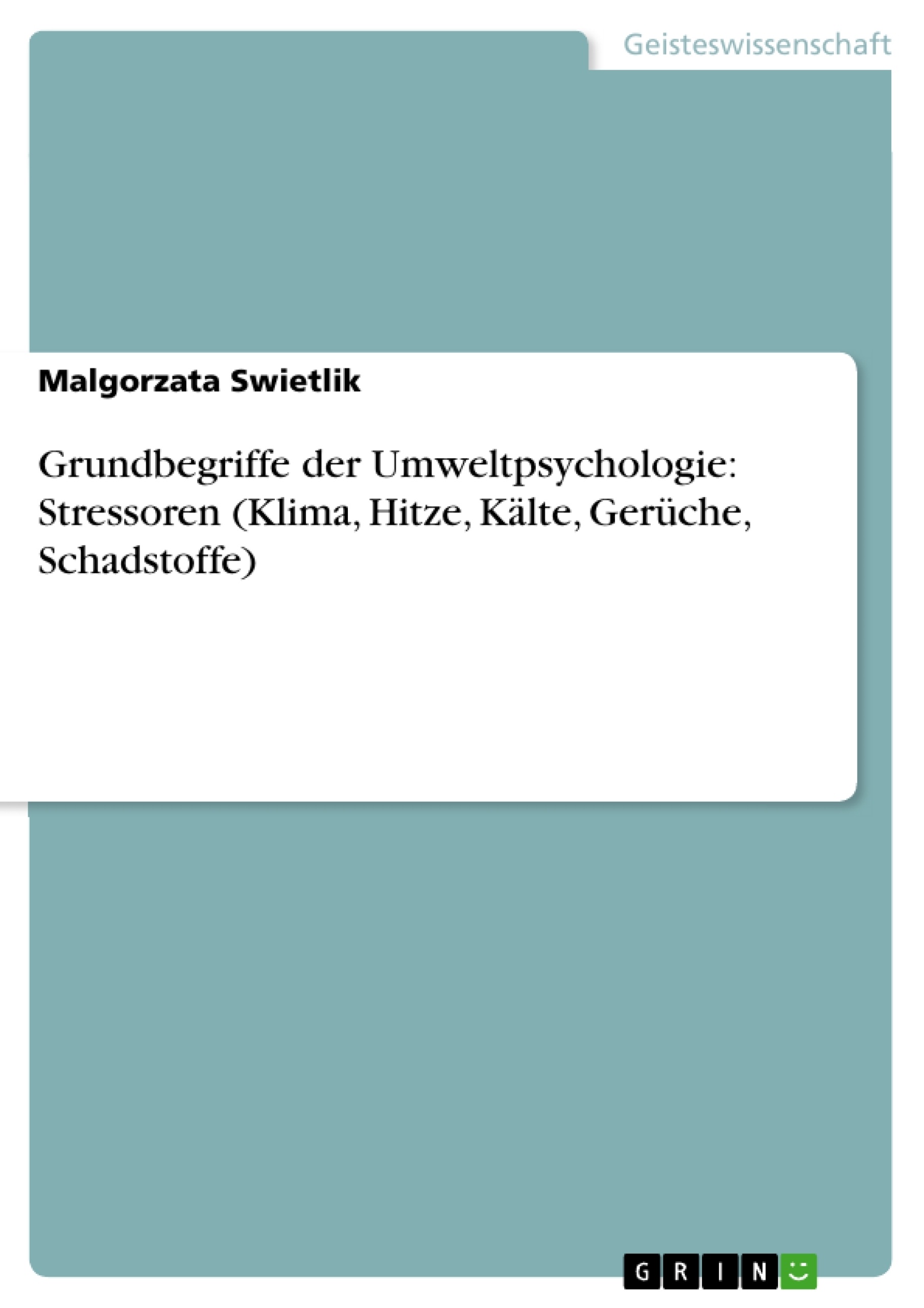1. Stress: Begriffbestimmung, Umweltstress
Der Begriff „Stress“ wird sehr häufig im Alltag benutzt und ist von der modernen Welt kaum wegzudenken. Dieser Begriff ist sogar so etwas wie ein „Modebegriff“ geworden und wird in schulischen, alltäglichen und vor allem arbeitsbezogenen Kontexten sowohl im positiven als auch im negativen Sinne benutzt. Da der Begriff so vielseitig ist, erscheint es sogar notwendig, ihn erst mal zu definieren.
Das Wort „Stress" stammt aus dem Englischen und bedeutet „Druck", „Zwang“ und „Belastung“. Den Begriff hat der kanadische Wissenschaftler Selye in den 50-er Jahren der vorausgegangenen Jahrhunderts in der Medizin geprägt und damit den Anfang der wissenschaftlichen Stressforschung gegründet. (vgl. Allenspach/Brechbühler, 2005, S. 26)
Selye (1957) beschreibt Stress in seinem Handbuch „Stress beherrscht unser Leben“ als:
„Die Belastungen, Anstrengungen und Ärgernisse, denen ein Lebewesen täglich durch viele Umweltein¬flüsse ausgesetzt ist. Es handelt sich um Anspannungen und Anpassungszwänge, die einen aus dem persönli¬chen Gleichgewicht bringen können und bei denen man seelisch und körperlich unter Druck steht.“ (Wagner-Link, https://www.tk-online.de/centaurus/generator/tkonline.de/b01__bestellungen__downloads/z99__downloads__bilder/pdf/broschuere__der__stress,property=Data.pdf)
Allgemein gesprochen entsteht Stress in einer Situation, in der der Mensch als Individuum eine Anpassungsleistung vollbringen muss: Er muss sich an neue oder veränderte Umweltgegebenheiten anpassen. Wenn man sich im Gleichgewicht zwischen äußeren Reizen und seinen individuellen Bedürfnissen befindet, entsteht der Zustand der Homöostase. (vgl. Walden, 1998, S. 69) Wenn es dem Individuum nicht gelingt, sich der Umwelt anzupassen oder die Umwelt zu ändern, entsteht Stress. Dieser Zustand wird von Ereignissen eingeführt, die für das physische und psychische Wohlbefinden als bedrohlich empfunden werden, und wenn die betreffende Person unsicher darüber ist, ob sie mit der Situation umgehen kann oder nicht. Stress ist also auch mit der Einschätzung der eigenen Möglichkeiten zur Bewältigung von Überlastung und mit der subjektiven Wahrnehmung von dieser Belastung verbunden. (vgl. Walden, 1998, S. 69)
Inhaltsverzeichnis
- Stress: Begriffbestimmung, Umweltstress
- General Adaptation Syndrome (GAS), der reaktionsorientierte Ansatz nach Selye (1957)
- Faktoren von Umweltstress, The Stress Process nach Green (1990)
- Streß als Wechselwirkung zwischen Person und Umwelt, der transaktionale und kognitive Ansatz nach Lazarus & Launier (1981)
- Umweltstressoren
- Klassen von Stressoren
- Soziale Stressoren bzw. physische Stressoren
- Aktuelle Stressoren bzw. chronische Stressoren
- Individuelle Stressoren bzw. kollektive Stressoren
- Klima
- Raumklima
- Wetterfühligkeit
- Hitze, Kälte
- Hitze
- Kälte
- Gerüche
- Aromatherapie
- Luftverschmutzung, Schadstoffe
- Kohlenmonoxid
- Die Kognitive- Dissonanz Theorie – Festinger (1957)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit dem Thema Umweltstress und beleuchtet verschiedene Aspekte der Stressforschung. Sie will den Leser mit den wichtigsten Begriffen und Theorien der Umweltpsychologie vertraut machen, die sich mit den Auswirkungen von Umweltfaktoren auf das menschliche Wohlbefinden beschäftigen.
- Definition von Stress und Umweltstress
- Theorien der Stressentstehung: General Adaptation Syndrome (GAS), Stress Process, transaktionaler und kognitiver Ansatz
- Klassifizierung von Umweltstressoren
- Auswirkungen von Klima, Hitze, Kälte, Gerüchen und Schadstoffen auf den Menschen
- Zusammenhang zwischen Umweltstress und Gesundheit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert den Begriff „Stress“ und erklärt, wie er im Kontext der Umweltpsychologie verstanden wird. Es werden verschiedene Definitionen von Stress vorgestellt und die Entstehung von Umweltstress im Zusammenhang mit Anpassungsleistungen des Organismus an die Umwelt erläutert.
Das zweite Kapitel behandelt das General Adaptation Syndrome (GAS) nach Selye, ein reaktionsorientierter Ansatz, der den Stress als Anpassungsversuch des Organismus auf einen Reiz betrachtet. Es werden die drei Phasen des GAS (Alarm, Widerstand, Erschöpfung) beschrieben und die Bedeutung von Eustress und Distress für das menschliche Wohlbefinden hervorgehoben.
Das dritte Kapitel stellt den „Stress Process“ nach Green (1990) vor, der den Umweltstress anhand von drei Faktoren (physischer Stressor, Bewertung des Stressors, Einwirkung des Stressors auf den Organismus) erklärt. Es wird betont, dass Stress nicht der Stressor selbst, sondern das Ergebnis von Bewertung und Einschätzung des wahrgenommenen Reizes ist.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit dem transaktionalen und kognitiven Ansatz nach Lazarus & Launier (1981), der den Stress als Wechselwirkung zwischen Person und Umwelt betrachtet. Es wird erklärt, wie die individuelle Bewertung und Interpretation von Situationen den Stresslevel beeinflussen kann.
Das fünfte Kapitel behandelt das Thema Umweltstressoren und klassifiziert sie in verschiedene Kategorien (soziale vs. physische, aktuelle vs. chronische, individuelle vs. kollektive). Es werden Beispiele für verschiedene Umweltstressoren gegeben und ihre potenziellen Auswirkungen auf den Menschen diskutiert.
Das sechste Kapitel befasst sich mit dem Einfluss von Klima auf den Menschen. Es werden die Konzepte Raumklima und Wetterfühligkeit erläutert und die Auswirkungen von extremen klimatischen Bedingungen auf das menschliche Wohlbefinden diskutiert.
Das siebte Kapitel behandelt die Auswirkungen von Hitze und Kälte auf den Menschen. Es werden die physiologischen und psychologischen Reaktionen auf Hitze und Kälte beschrieben und die Bedeutung von Schutzmaßnahmen gegen extreme Temperaturen hervorgehoben.
Das achte Kapitel beschäftigt sich mit dem Einfluss von Gerüchen auf den Menschen. Es werden die unterschiedlichen Reaktionen auf Gerüche und die Bedeutung von Aromatherapie für das menschliche Wohlbefinden diskutiert.
Das neunte Kapitel behandelt das Thema Luftverschmutzung und Schadstoffe. Es werden verschiedene Schadstoffe wie Kohlenmonoxid vorgestellt und ihre Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit erläutert. Es wird auch die Kognitive- Dissonanz Theorie von Festinger (1957) im Zusammenhang mit Umweltstress diskutiert.
Schlüsselwörter
Umweltstress, Stressoren, General Adaptation Syndrome (GAS), Stress Process, transaktionaler und kognitiver Ansatz, Raumklima, Wetterfühligkeit, Hitze, Kälte, Gerüche, Aromatherapie, Luftverschmutzung, Schadstoffe, Kohlenmonoxid, Kognitive- Dissonanz Theorie
- Quote paper
- Malgorzata Swietlik (Author), 2008, Grundbegriffe der Umweltpsychologie: Stressoren (Klima, Hitze, Kälte, Gerüche, Schadstoffe), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170692