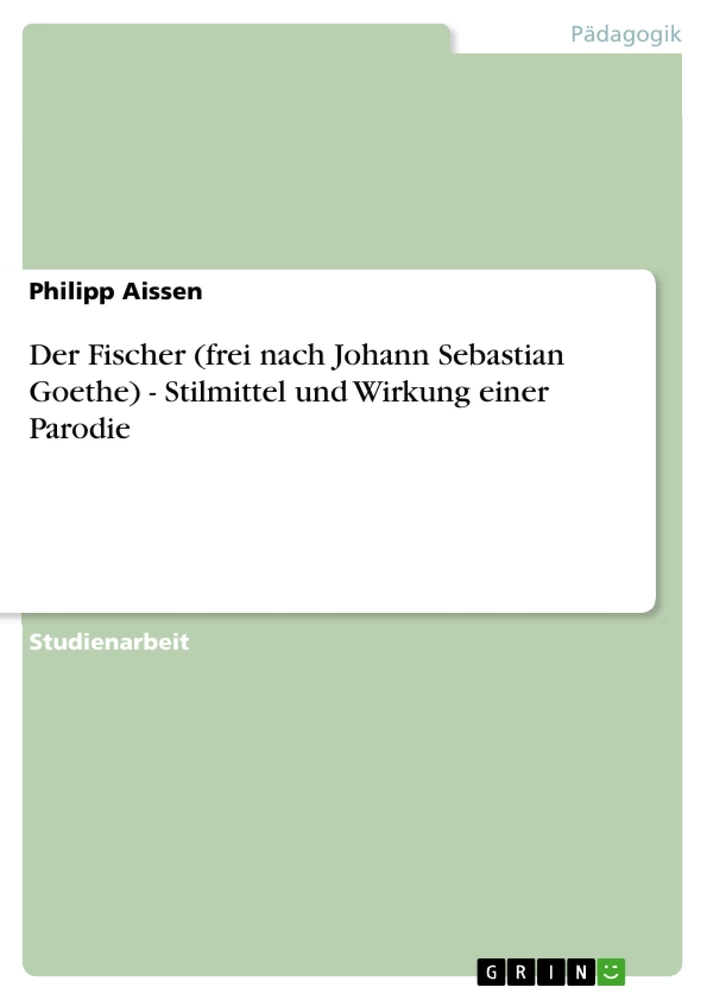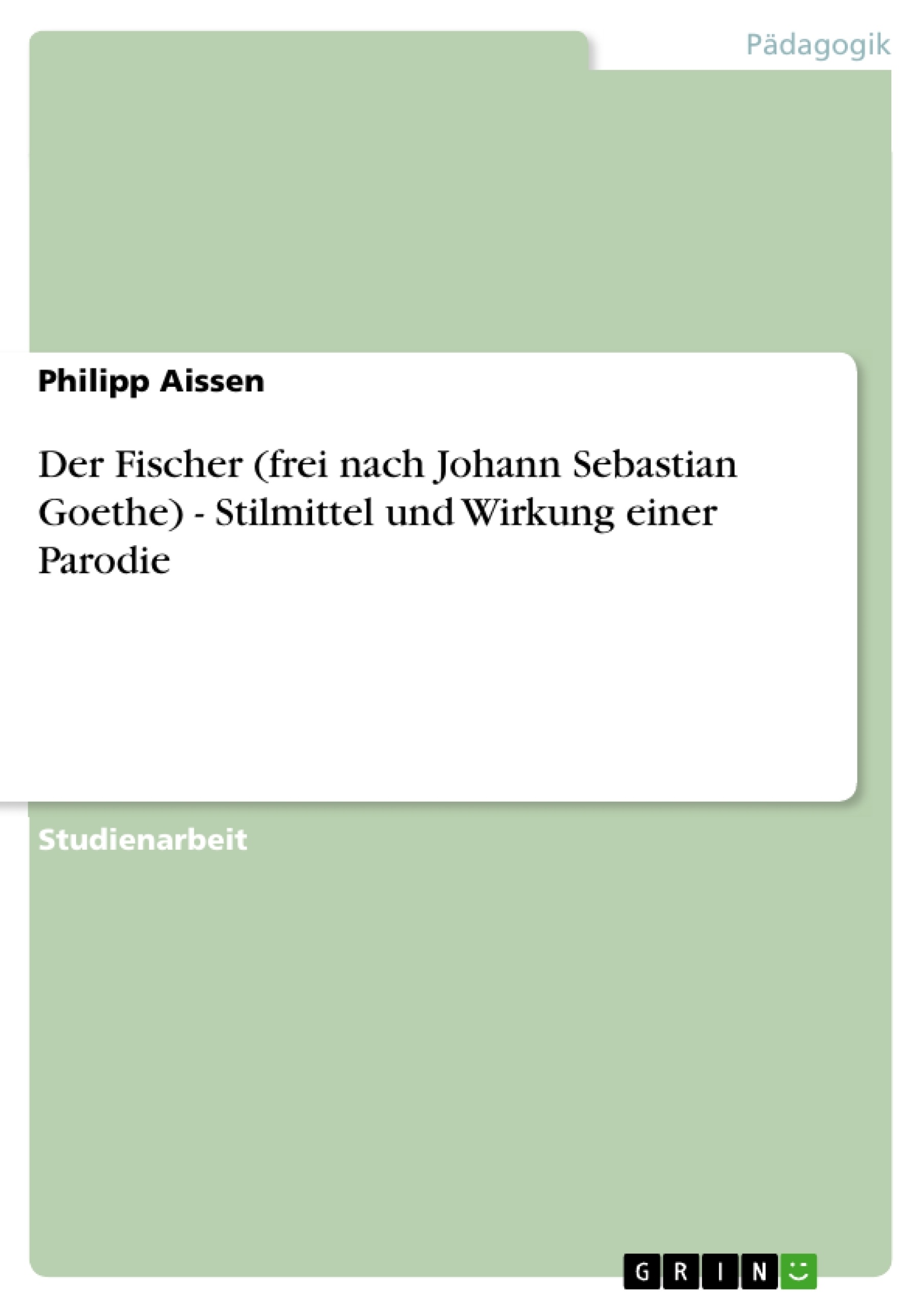„Wie ich ein Todfeind sey von allem Parodiren und Travestiren hab‘ ich nie verhehlt: aber nur deswegen bin ich’s, weil dieses garstige Gezücht das Schöne, Edle, Grosse herunterzieht, um es zu vernichten.“
Wie diesem Zitat zu entnehmen ist, war Goethe nicht gerade ein glühender Verehrer der, oftmals als parasitär bezeichneten, Gattung Parodie. Eine Daseinsberechtigung gestand er ihr nur ein, sofern sie berechtigte Kritik am Original äußert oder ein „kreatives Potential“ entfaltet. Der Untersuchungsgegenstand dieser Hausarbeit erfüllt beide Kriterien. Ob Goethe Gefallen an Heinz Erhardts Parodie „Der Fischer (frei nach Johann Sebastian Goethe)“ gefunden hätte, muss leider offen bleiben.
Um Textverweise zu erleichtern, sind in vorliegender Hausarbeit beide Versionen des Fischers abgedruckt. Bevor sich der Blick jedoch auf Original und Adaption richtet, werden einige Definitionsversuche der Parodie im Allgemeinen vorgestellt, um eine theoretische Grundlage zu schaffen.
Heinz Erhardt war ein (Unsinns-)Poet, der nie als solcher wahrgenommen wurde und eher als sympathischer Dicker aus zahlreichen Klamaukfilmen der Nachkriegszeit in Erinnerung geblieben ist. Dass Erhardt weit mehr war als ein blödelnder Komiker mit Hang zur einfachen Pointe, zeigen allein schon seine Balladenparodien, die sich unter anderem Goethe, Schiller und Bürger widmen und dabei eine ganz spezielle Originalität entfalten.
Diese Hausarbeit erhebt nicht den Anspruch, eine vollständige Balladenanalyse zu leisten, vielmehr geht es darum Erhardts parodistische „Werkzeuge“ und deren Wirkung zu beschreiben. Wie schafft er es Goethe lächerlich zu machen? Wie beeinflusst seine Parodie die spätere Rezeption eines lebendigen Kulturguts?
Als Arbeitsgrundlage diente hauptsächlich Waltraud Wendes „Goethe-Parodien…“, das Heinz Erhardt leider kaum Beachtung schenkt, aber Licht in das terminologische Wirrwarr bringt, das Gérard Genette mit seinen strikten Ein- und Abgrenzungsversuchen der Parodie nur weiter zu verdunkeln droht. Aufschlussreich für die Annäherung an die Person Heinz Erhardt ist Heinrich Detering. Nicht nur im Nachwort seiner Erhardt Sammlung „Von der Pampelmuse geküsst“, sondern auch in Vorträgen versucht er einen Dichter zu rehabilitieren, dem die Anerkennung für sein poetisches Schaffen zumeist verwehrt blieb.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsgeschichte
- 2.2 Aktuelle Definitionsversuche und funktionale Bestimmung
- 3. Zum Anspruch eines verkannten Poeten
- 4.1 J.W. Goethe Der Fischer (1778)
- 4.2 Heinz Erhardt: Der Fischer (frei nach Johann Sebastian Goethe)
- 5. Parodistische Stilmittel
- 5.1 Übererfüllung vs. Untererfüllung
- 5.2 Überschrift
- 5.3 Kurze Formanalyse
- 5.4 Übertreibung der Wiederholungen
- 5.5 Figurenentmachtung des Fischers
- 5.6 Figurenentmachtung des Fischweibes
- 5.7 Reimen auf Biegen und Brechen
- 5.8 Tempusbeibehaltung
- 6. Wirkung
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Heinz Erhardts Parodie „Der Fischer (frei nach Johann Sebastian Goethe)“ und analysiert die verwendeten parodistischen Stilmittel und deren Wirkung. Ziel ist es, Erhardts Vorgehen bei der Lächerlichmachung Goethes zu beschreiben und den Einfluss seiner Parodie auf die Rezeption des Originalwerks zu beleuchten. Die Arbeit stützt sich dabei auf bestehende Literatur zur Parodie und zu Heinz Erhardt.
- Definition und Begriffsgeschichte der Parodie
- Analyse der parodistischen Stilmittel in Erhardts Version
- Vergleich zwischen Goethes Original und Erhardts Parodie
- Wirkung der Parodie auf die Rezeption von Goethes „Der Fischer“
- Heinz Erhardts Stellung als (verkannter) Poet
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert Goethes ablehnende Haltung gegenüber der Parodie, gleichzeitig aber auch die mögliche Berechtigung dieser Gattung, wenn sie berechtigte Kritik äußert oder kreatives Potential entfaltet. Sie stellt Heinz Erhardt als (Unsinns-)Poet vor und definiert den Fokus der Arbeit auf die Analyse der parodistischen Mittel und deren Wirkung in Erhardts Parodie von Goethes „Der Fischer“. Die Einleitung verweist auf die verwendeten Quellen, insbesondere Waltraud Wende und Heinrich Detering, deren Werke als Grundlage für die Analyse dienen.
2. Begriffsgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs „Parodie“, beginnend mit dem griechischen Ursprung „parodia“ und dessen verschiedenen Bedeutungen wie „Nebengesang“, „Beigesang“ und „Gegengesang“. Es werden frühe Beispiele wie die Rezitation der Homerischen Epen durch Hegemon von Thasos diskutiert und die verschiedenen Interpretationen des Begriffs aus der Antike bis zur römischen Auffassung bei Quintilian und Scaliger erörtert. Der Abschnitt mündet in die Feststellung, dass trotz semantischer Wandlungen die Debatte um eine eindeutige terminologische Klarheit bis heute anhält.
2.2 Aktuelle Definitionsversuche und funktionale Bestimmung: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen modernen Versuchen, den Begriff der Parodie zu definieren und von ähnlichen literarischen Phänomenen abzugrenzen. Es werden die Ansätze von Genette diskutiert, der Parodie, Travestie und Persiflage unterscheidet, sowie die Kritik an diesen künstlichen Abgrenzungen, die fließende Übergänge oft außer Acht lassen. Die Arbeit verweist auf die Schwierigkeit, einen Konsens in der Begriffsbestimmung zu erreichen und erwähnt Grawe, der die Parodie und Travestie als „Schwestern“ bezeichnet.
3. Zum Anspruch eines verkannten Poeten: Kapitel 3 legt den Fokus auf die Einordnung Heinz Erhardts als Poet und dessen verkannte Anerkennung für sein poetisches Schaffen. Es betont Erhardts Leistungen über seine Rolle als Komiker hinaus, speziell durch seine Balladenparodien, die sich mit bekannten Dichtern auseinandersetzen. Dieser Teil dient als Brücke zur folgenden Analyse von Erhardts Parodie auf Goethe.
4.1 J.W. Goethe Der Fischer (1778): Dieser Abschnitt stellt Goethes Originalwerk „Der Fischer“ vor, welches als Grundlage für Erhardts Parodie dient. Er dient der Kontextualisierung und zum Vergleich mit der späteren Parodie. Obwohl nicht explizit im gegebenen Text, muss hier angenommen werden, dass dieser Abschnitt das Originalgedicht von Goethe in Teilen darstellt oder darauf Bezug nimmt.
4.2 Heinz Erhardt: Der Fischer (frei nach Johann Sebastian Goethe): Dieser Abschnitt präsentiert Erhardts Parodie und dient als Vergleichsgrundlage für die folgende Analyse der parodistischen Stilmittel. Analog zu Abschnitt 4.1, wird hier Erhardts Text als Referenz benutzt und analysiert.
5. Parodistische Stilmittel: Dieses Kapitel analysiert die von Erhardt in seiner Parodie eingesetzten Stilmittel. Der gegebene Text nennt verschiedene Aspekte, wie z.B. Übererfüllung/Untererfüllung, Überschrift, Formanalyse, Übertreibung von Wiederholungen, Figurenentmachtung des Fischers und des Fischweibes, Reimen auf Biegen und Brechen sowie Tempusbeibehaltung.
6. Wirkung: Dieses Kapitel untersucht die Wirkung von Erhardts parodistischen Stilmitteln und deren Einfluss auf die Rezeption von Goethes „Der Fischer“. Wie verändert die Parodie das Verständnis des Originals? Wie trägt sie zur Auseinandersetzung mit dem ursprünglichen Text bei? Diese Fragestellungen bilden den Schwerpunkt dieser Analyse.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Parodieanalyse von Heinz Erhardts "Der Fischer"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert Heinz Erhardts Parodie "Der Fischer (frei nach Johann Sebastian Goethe)" auf Goethes gleichnamiges Gedicht. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der verwendeten parodistischen Stilmittel und deren Wirkung auf die Rezeption des Originalwerks.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit beschreibt Erhardts Vorgehen bei der Parodie, beleuchtet den Einfluss der Parodie auf die Rezeption von Goethes "Der Fischer" und untersucht Erhardts Stellung als Poet.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Begriffsgeschichte der Parodie, analysiert die parodistischen Stilmittel in Erhardts Version, vergleicht Goethes Original mit Erhardts Parodie und untersucht die Wirkung der Parodie auf die Rezeption von Goethes Gedicht. Zusätzlich wird Erhardts Position als (verkannter) Poet beleuchtet.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Begriffsgeschichte der Parodie (inkl. aktueller Definitionsversuche), Erhardt als verkannter Poet, Analyse von Goethes "Der Fischer", Analyse von Erhardts Parodie, Analyse der parodistischen Stilmittel (z.B. Übererfüllung/Untererfüllung, Reim, Figurenentmachtung), Wirkung der Parodie und Fazit.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf bestehende Literatur zur Parodie und zu Heinz Erhardt. Explizit erwähnt werden die Werke von Waltraud Wende und Heinrich Detering.
Welche parodistischen Stilmittel werden analysiert?
Die Analyse umfasst verschiedene Stilmittel wie Übererfüllung/Untererfüllung, Überschrift, Formanalyse, Übertreibung der Wiederholungen, Figurenentmachtung des Fischers und des Fischweibes, Reimen auf Biegen und Brechen und Tempusbeibehaltung.
Wie wird die Wirkung der Parodie untersucht?
Die Arbeit untersucht, wie Erhardts parodistische Stilmittel die Rezeption von Goethes "Der Fischer" verändern und zur Auseinandersetzung mit dem Originaltext beitragen.
Welche Rolle spielt Heinz Erhardt in der Arbeit?
Die Arbeit betrachtet Heinz Erhardt nicht nur als Komiker, sondern auch als Poet, dessen Werk, insbesondere seine Balladenparodien, eine verkannte Anerkennung verdient. Seine Parodie auf Goethe steht im Mittelpunkt der Analyse.
Welche Bedeutung hat die Begriffsgeschichte der Parodie?
Die Begriffsgeschichte der Parodie, von den antiken Ursprüngen bis zu modernen Definitionsversuchen, liefert den theoretischen Rahmen für die Analyse und beleuchtet die Schwierigkeiten einer eindeutigen Begriffsbestimmung.
Wie wird Goethes "Der Fischer" in der Arbeit behandelt?
Goethes "Der Fischer" wird als Grundlage und Vergleichstext für Erhardts Parodie präsentiert und analysiert. Die Arbeit stellt das Originalgedicht vor um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu Erhardts Version herauszuarbeiten.
- Quote paper
- Philipp Aissen (Author), 2009, Der Fischer (frei nach Johann Sebastian Goethe) - Stilmittel und Wirkung einer Parodie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170672