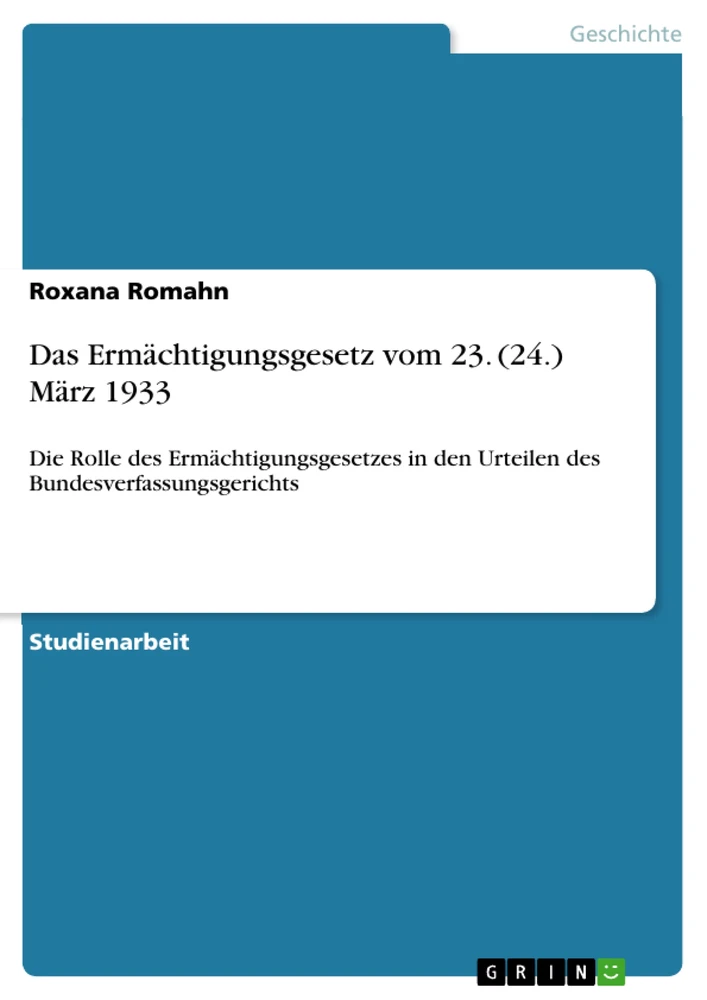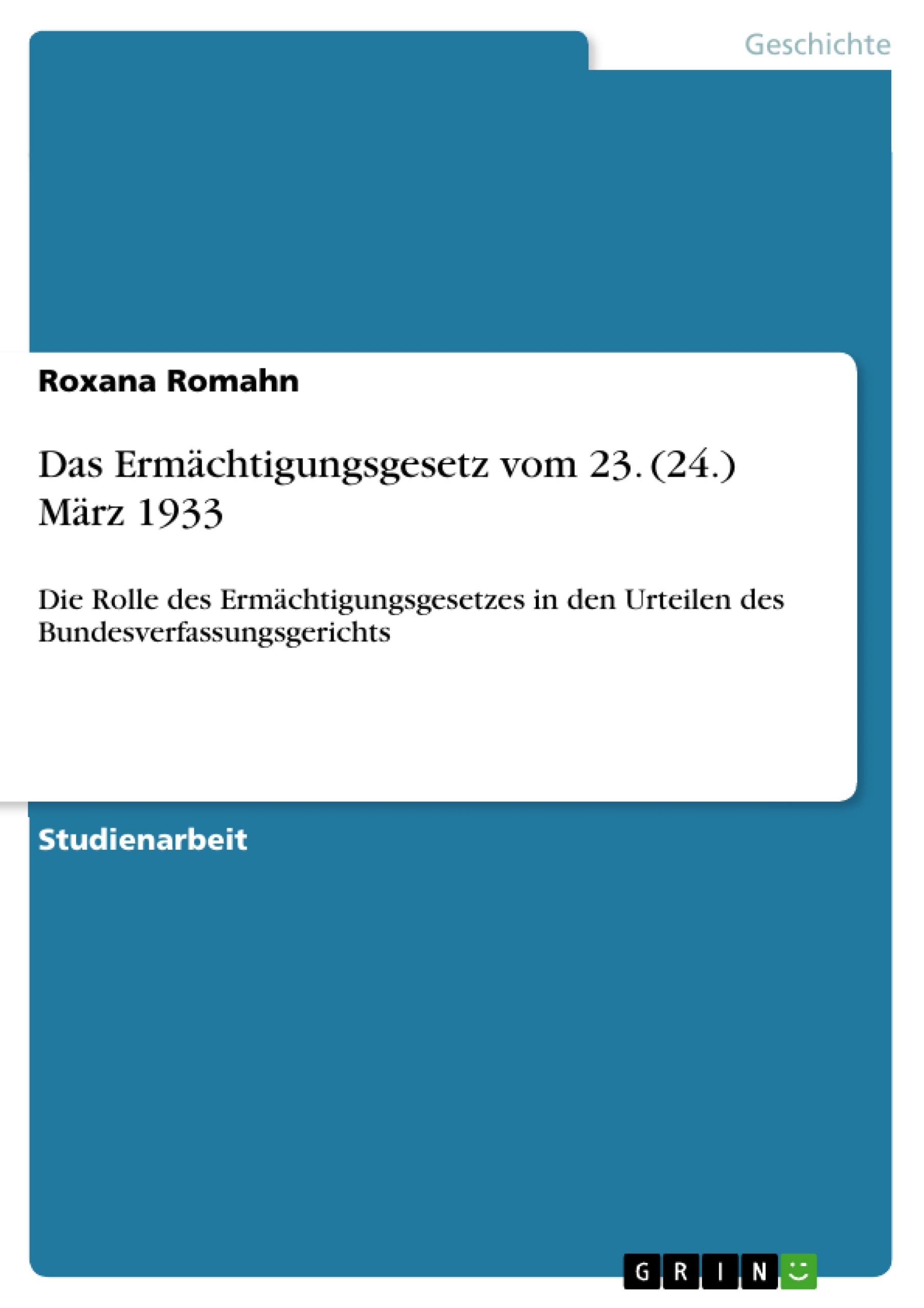Hitler umging mit diesem Gesetz die Legislative und beförderte den Reichstag mit dessen Zustimmung fast gänzlich ins politische Aus. Lediglich sieben Gesetze, von denen zwei die Verlängerung des Ermächtigungsgesetzes betrafen, sind danach vom Reichstag beschlossen worden.
Und auch wenn während der Zeit des „dritten Reichs“ keinerlei Diskurs über die Rechtskräftigkeit oder Legalität des „Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich“ (Ermächtigungsgesetz) vom 23. März 1933 aufgekommen war oder hätte aufkommen können, so entbrannte bereits kurz nach Kriegsende eine lebhafte Diskussion darüber.
Politiker und Historiker argumentiert heftigst miteinander, wobei die Motive für eine Anerkennung der Rechtskräftigkeit oder deren Ablehnung nicht immer offen ersichtlich waren. Einig war man indes nur darüber, dass das Ermächtigungsgesetz die nationalsozialistische Machtergreifung juristisch hatte untermauern sollen, um dem folgenden Regime eine Legitimation zu verleihen.
Die Debatte jedoch war offensichtlich so von öffentlichem Interesse, dass sich das Bundesverfassungsgericht, das erst am 9. September 1951 die Arbeit aufgenommen hatte, bereits 1953 das erste Mal mit der Problematik auseinandersetzen musste. Doch dies blieb nicht das einzige Urteil, das sich mit dem Ermächtigungsgesetz befasste.
In der folgenden Arbeit soll betrachtet werden, welche Stellung das Ermächtigungsgesetz in den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts einnahm und wozu es herangezogen wurde.
Exemplarisch wurden für diese Untersuchung die Urteile aus den Jahren 1953, 1957 und 1958 herangezogen, die in verschiedenen Weisen Bezug auf das „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“ nahmen. Hierzu werden vorab jeweils der Inhalt der Verfassungsbeschwerde und deren mögliche Hintergründe beleuchtet. Danach wird gesondert die Stellung des Ermächtigungsgesetzes in diesen Urteilen abgehandelt, um zum Schluss ein fundiertes Fazit über die oben genannte These ziehen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- II. Das Ermächtigungsgesetz als Teil der Urteilsbegründung des Rechtsspruchs vom 24. April 1953
- 1. Inhalt, Beschlüsse und Entscheidungsformel der Verfassungsbeschwerde
- 2. Das Ermächtigungsgesetz in III. der Urteilsbegründung
- III. Die Legalität des Ermächtigungsgesetzes nach dem Urteil vom 26. März 1957
- 1. Inhalt und Hintergrund der Verfassungsbeschwerde
- 2. Die Entscheidung vom 26. März 1957
- IV. Schlussbetrachtung und Notstandgesetzgebung der Bundesrepublik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle des Ermächtigungsgesetzes in den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts. Sie analysiert exemplarisch die Urteile von 1953, 1957 und 1958, um zu klären, wie das Gesetz in der Rechtsprechung verwendet und interpretiert wurde. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des Ermächtigungsgesetzes für die Legitimation des NS-Regimes und dessen nachträgliche juristische Bewertung.
- Die juristische Bewertung des Ermächtigungsgesetzes nach dem Zweiten Weltkrieg.
- Die Rolle des Ermächtigungsgesetzes in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
- Die unterschiedlichen Interpretationen des Ermächtigungsgesetzes in verschiedenen Urteilen.
- Der Einfluss des Ermächtigungsgesetzes auf die deutsche Nachkriegsgesetzgebung.
- Die Auseinandersetzung mit dem Verfassungsrang des Gesetzes vor und nach dem NS-Regime.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einführung: Die Einführung beleuchtet die Bedeutung des Ermächtigungsgesetzes als Abschluss der nationalsozialistischen Machtergreifung und die damit verbundene Umgehung der Legislative. Sie beschreibt die kontroverse Debatte über die Rechtsgültigkeit des Gesetzes nach dem Zweiten Weltkrieg und kündigt die Untersuchung der Rolle des Ermächtigungsgesetzes in ausgewählten Urteilen des Bundesverfassungsgerichts an. Die Arbeit fokussiert auf die Urteile von 1953, 1957 und 1958, wobei jeweils der Kontext der Verfassungsbeschwerden und die Stellung des Ermächtigungsgesetzes in den Urteilsbegründungen analysiert werden.
II. Das Ermächtigungsgesetz als Teil der Urteilsbegründung des Rechtsspruchs vom 24. April 1953: Dieses Kapitel analysiert das Urteil vom 24. April 1953. Es fasst zunächst den Inhalt der Verfassungsbeschwerde zusammen, die sich gegen Gesetze richtete, welche Grundstücke mit Umstellungsschulden belasteten. Die Beschwerdeführer argumentierten, es handele sich um eine entschädigungslose Enteignung. Das Kapitel beschreibt dann, wie das Bundesverfassungsgericht in seiner Urteilsbegründung den Artikel 153 Absatz 2 der Reichsverfassung von 1919 und dessen Gültigkeit im Kontext des Ermächtigungsgesetzes behandelt. Die Argumentation des Gerichts wird detailliert dargestellt, wobei auch auf unterschiedliche Entscheidungen des Reichsgerichts verwiesen wird. Die Bedeutung dieses Urteils liegt in der Auseinandersetzung mit dem Verfassungsrang von Gesetzen unter dem NS-Regime und der Frage, inwieweit diese Gesetze nach dem Krieg noch Gültigkeit besitzen.
Schlüsselwörter
Ermächtigungsgesetz, Bundesverfassungsgericht, Nationalsozialismus, Rechtsprechung, Verfassungsbeschwerde, Legitimation, Reichsverfassung, Rechtsgültigkeit, Enteignung, Notstandgesetzgebung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse des Ermächtigungsgesetzes in Urteilen des Bundesverfassungsgerichts
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Rolle des Ermächtigungsgesetzes in Urteilen des Bundesverfassungsgerichts, insbesondere in den Entscheidungen von 1953, 1957 und 1958. Der Fokus liegt auf der juristischen Bewertung des Gesetzes nach dem Zweiten Weltkrieg, seiner Bedeutung für die Legitimation des NS-Regimes und dessen Interpretation in verschiedenen Gerichtsurteilen.
Welche Urteile werden im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht exemplarisch die Urteile des Bundesverfassungsgerichts vom 24. April 1953 und vom 26. März 1957. Diese Urteile werden hinsichtlich des Inhalts der jeweiligen Verfassungsbeschwerden, der Argumentation des Gerichts und der Behandlung des Ermächtigungsgesetzes in den Urteilsbegründungen analysiert. Der Kontext des Urteils von 1958 wird ebenfalls erwähnt.
Wie wird das Ermächtigungsgesetz in den Urteilen behandelt?
Die Arbeit beschreibt, wie das Bundesverfassungsgericht in seinen Urteilen den Verfassungsrang von Gesetzen unter dem NS-Regime und deren Gültigkeit nach dem Krieg behandelt. Sie zeigt auf, wie das Ermächtigungsgesetz in die Argumentation der Urteile eingebunden ist und welche unterschiedlichen Interpretationen des Gesetzes in verschiedenen Entscheidungen zu finden sind.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die juristische Bewertung des Ermächtigungsgesetzes nach dem Zweiten Weltkrieg, seine Rolle in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, unterschiedliche Interpretationen des Gesetzes in verschiedenen Urteilen, den Einfluss des Gesetzes auf die deutsche Nachkriegsgesetzgebung und die Auseinandersetzung mit dem Verfassungsrang des Gesetzes vor und nach dem NS-Regime.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung des Ermächtigungsgesetzes für die Legitimation des NS-Regimes und seine nachträgliche juristische Bewertung zu klären. Sie untersucht, wie das Gesetz in der Rechtsprechung verwendet und interpretiert wurde und analysiert die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts in ausgewählten Urteilen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, die die Bedeutung des Ermächtigungsgesetzes und die Forschungsfrage darstellt. Die Hauptkapitel analysieren das Ermächtigungsgesetz im Urteil von 1953 und im Urteil von 1957. Ein abschließendes Kapitel bietet eine Schlussbetrachtung und befasst sich mit der Notstandgesetzgebung der Bundesrepublik.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Ermächtigungsgesetz, Bundesverfassungsgericht, Nationalsozialismus, Rechtsprechung, Verfassungsbeschwerde, Legitimation, Reichsverfassung, Rechtsgültigkeit, Enteignung, Notstandgesetzgebung.
- Quote paper
- Roxana Romahn (Author), 2010, Das Ermächtigungsgesetz vom 23. (24.) März 1933, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170507