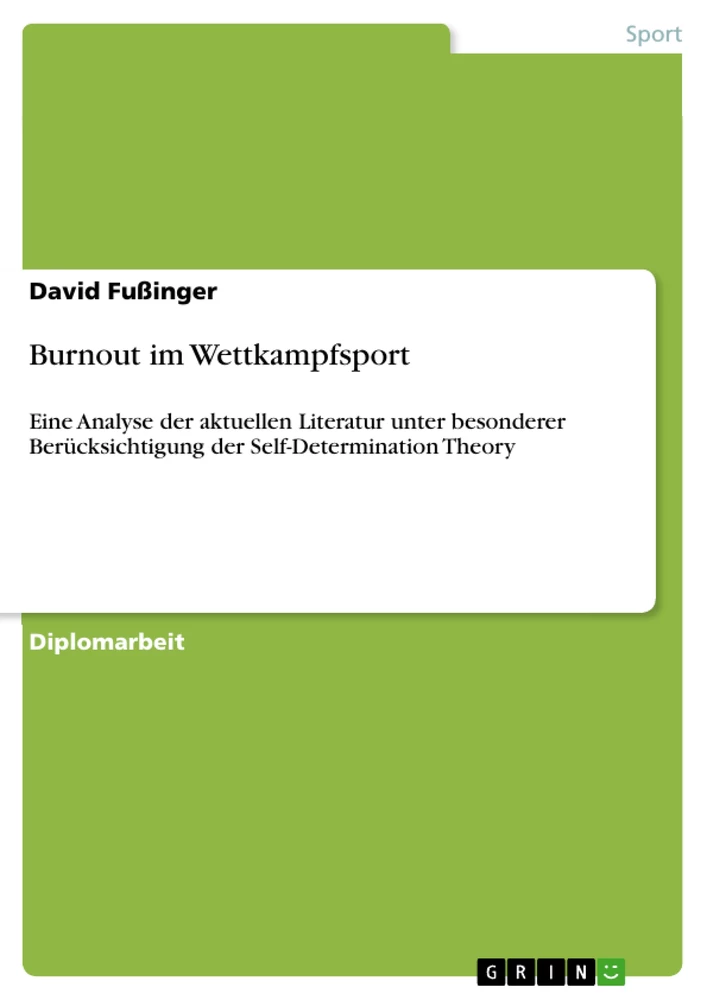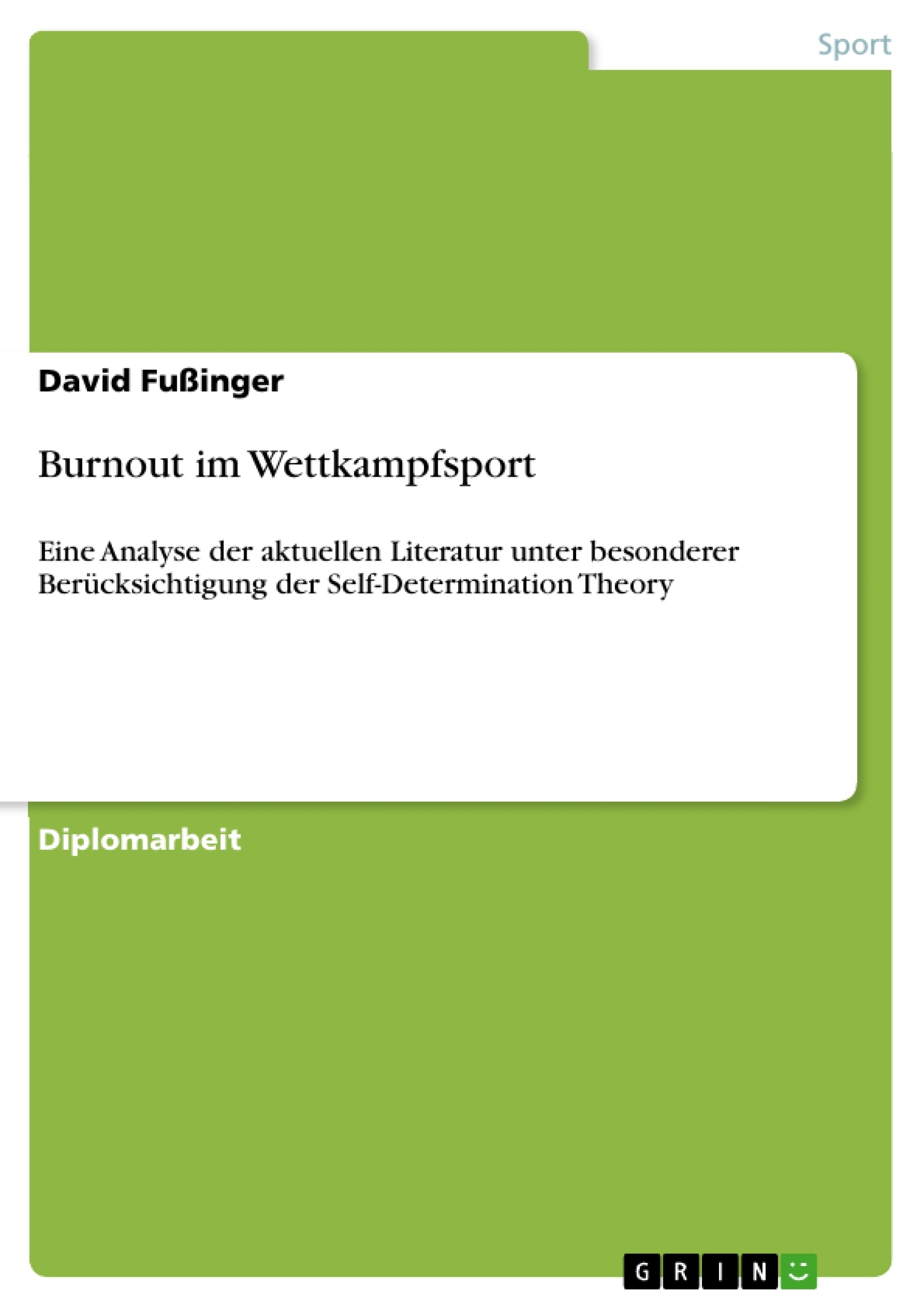Spätestens seit dem Freitod Robert Enkes, beschäftigt die Sportwelt das Thema Burnout und Depressionen im Leistungssport mehr denn je. Dieser tragische Vorfall war ausschlaggebend für die Motivation das Phänomen Burnout im Bereich des Spitzensports zu untersuchen, um einen besseren Einblick in das Burnout-Syndrom und die Tragweite der Problematik im Wettkampfsport zu bekommen. Ziel dieser Arbeit ist die genaue Untersuchung dieses Forschungsgegenstandes im Wettkampfsport und eine umfassende qualitative Analyse aktueller Literatur unter besonderer Berücksichtigung der Self-Determination Theory(SDT).
Vorab werden folgende Fragen an die Literaturanalyse gestellt:
1) Gibt es eine einheitliche Definition über das „Athlete-Burnout“ - Syndrom?
2) Welche theoretischen anerkannten Hintergrundmodelle bezüglich der Ätiologie des
Syndroms gibt es, und welche Rolle spielt die Self-Determination Theory?
3) Gibt es anerkannte Messverfahren, um Burnout zu quantifizieren und zu diagnostizieren?
4) Welche Auswirkungen haben die Ergebnisse der Burnoutforschungen vor dem Hintergrund der Self-Determination Theory auf Interventionsstrategien?
Um diese Fragen zu beantworten und den Forschungsgegenstand genauer darzulegen, wurde eine umfassende Literaturanalyse durchgeführt, die auf der Grundlage modernster sportwissenschaftlicher und -psychologischer Literatur fußt. In den Onlinekatalogen der
wichtigsten Datenbanken wurden die Artikel aus den Fachzeitschriften heruntergeladen, ausgedruckt und tabellarisch zusammengefasst. Die Tabellen wurden sorgfältig nach diversen einheitlichen Kriterien unterteilt, die von Bedeutung für die nachfolgende Datenanalyse waren. Aufgrund des weit verbreiteten und oftmals umgangssprachlichen
Gebrauchs des Begriffes Burnout (Cresswell & Eklund, 2002), der uneinheitlichen Charakterisierung in der publizierten Literatur, die häufig für Verwirrung und Verwechslung mit anderen Symptomen und Erkrankungen sorgen (Cresswell & Eklund, 2006), ist es das Ziel dieser Literaturanalyse, das „Athlete-Burnout“ - Syndrom zu konkretisieren, um es besser einordnen und verstehen zu können. Die vorliegende Arbeit erhebt den Anspruch, das Burnoutkonzept im Wettkampfsport unter besonderer Berücksichtigung der Self-Determination Theory in der aktuellen Literatur zu analysieren. Der Forschungsgegenstand wird dabei unter verschiedenen Kriterien genauer betrachtet und die Ergebnisse dieser Übersichtsarbeit sollen auf wesentliche Aussagen reduziert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das Burnout-Syndrom
- 2.1 Allgemeine Definitionen
- 2.2 Richtungsweisende Erklärungsansätze
- 2.2.1 Burnout nach Freudenberger
- 2.2.2 Burnout nach Maslach
- 3 Das „Athlete-Burnout“ - Syndrom
- 3.1 Definitionen des „Athlete-Burnout“ - Syndroms
- 3.2 Verschiedene Konzepte und Entstehungsmodelle
- 3.3 Quantifizierung und Messverfahren
- 4 Self-Determination Theory
- 4.1 Organismic Integration Theory
- 4.2 Basic Needs Theory
- 5 Methodisches Vorgehen der Literaturanalyse
- 5.1 Quellen/Literaturrecherche
- 5.2 Weitere Vorgehensweise
- 5.3 Datenanalyse
- 6 Allgemeine Ergebnisse der Literaturanalyse
- 6.1 Definition „Athlete-Burnout“
- 6.2 Theoretische Hintergrundmodelle
- 6.3 Probanden
- 6.4 Messverfahren
- 6.5 Studiendesign und Überprüfung der Hypothesen
- 6.6 Ergebnisse
- 7 Einschränkungen der Studien und zukünftige Fragestellungen
- 8 Praxistransfer und Präventionsstrategien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht das Burnout-Syndrom im Wettkampfsport, insbesondere unter Berücksichtigung der Self-Determination Theory (SDT). Ziel ist eine umfassende qualitative Literaturanalyse, um das Phänomen besser zu verstehen und präventive Maßnahmen zu entwickeln.
- Definition und Abgrenzung von „Athlete-Burnout“
- Analyse relevanter theoretischer Modelle zur Entstehung von Burnout im Leistungssport
- Rolle der Self-Determination Theory bei der Entstehung und Bewältigung von Burnout
- Bewertung vorhandener Messverfahren zur Erfassung von Burnout
- Ableitung von Implikationen für Interventions- und Präventionsstrategien
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Burnout-Syndroms ein und beleuchtet die Problematik anhand von Beispielen bekannter Leistungssportler wie Robert Enke, Sebastian Deisler und Sven Hannawald. Sie verdeutlicht die Notwendigkeit der Forschung zu diesem Thema und formuliert zentrale Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen, insbesondere hinsichtlich der Definition von Athlete-Burnout, relevanter theoretischer Modelle, Messverfahren und Implikationen für Interventionsstrategien im Kontext der Self-Determination Theory.
2 Das Burnout-Syndrom: Dieses Kapitel bietet eine allgemeine Definition des Burnout-Syndroms und präsentiert verschiedene Erklärungsansätze, insbesondere die Modelle von Freudenberger und Maslach. Es legt den Grundstein für das Verständnis des Phänomens und seiner komplexen Ursachen.
3 Das „Athlete-Burnout“ - Syndrom: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die spezifischen Aspekte von Burnout im Leistungssport. Es werden verschiedene Definitionen von „Athlete-Burnout“ diskutiert und unterschiedliche Konzepte und Entstehungsmodelle beleuchtet. Ein wichtiger Fokus liegt auf der Quantifizierung und den Messverfahren dieses Syndroms im Sportkontext.
4 Self-Determination Theory: Dieses Kapitel beschreibt die Self-Determination Theory (SDT) als ein theoretisches Rahmenmodell, welches zur Erklärung und zum Verständnis von Motivation und Wohlbefinden im Sport relevant ist. Die Organismic Integration Theory und die Basic Needs Theory werden als zentrale Komponenten der SDT vorgestellt und ihre Bedeutung im Kontext von Burnout erläutert.
5 Methodisches Vorgehen der Literaturanalyse: Hier wird die Methodik der durchgeführten Literaturanalyse detailliert beschrieben. Es werden die Quellen und die Vorgehensweise der Recherche, sowie die angewandte Datenanalyse erläutert und begründet.
6 Allgemeine Ergebnisse der Literaturanalyse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Literaturanalyse, welche die verschiedenen Aspekte von Athlete-Burnout, die untersuchten theoretischen Modelle und die verwendeten Messverfahren umfasst. Die Ergebnisse bezüglich der Prävalenz von Athlete-Burnout und der Rolle der SDT werden zusammengefasst.
7 Einschränkungen der Studien und zukünftige Fragestellungen: Dieses Kapitel diskutiert die Limitationen der vorhandenen Studien und benennt offene Fragen und zukünftige Forschungsansätze im Bereich des Athlete-Burnouts.
8 Praxistransfer und Präventionsstrategien: Dieses Kapitel überträgt die Ergebnisse der Literaturanalyse auf die Praxis und entwickelt daraus mögliche Präventionsstrategien zur Vermeidung von Burnout im Leistungssport.
Schlüsselwörter
Burnout, Athlete-Burnout, Self-Determination Theory (SDT), Leistungssport, Depression, Erschöpfung, Motivation, Prävention, Interventionsstrategien, Stress, Wohlbefinden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Burnout-Syndrom im Leistungssport
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht das Burnout-Syndrom im Leistungssport, insbesondere unter Berücksichtigung der Self-Determination Theory (SDT). Es handelt sich um eine umfassende qualitative Literaturanalyse mit dem Ziel, das Phänomen „Athlete-Burnout“ besser zu verstehen und präventive Maßnahmen zu entwickeln.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von „Athlete-Burnout“, Analyse relevanter theoretischer Modelle zur Entstehung von Burnout im Leistungssport, die Rolle der Self-Determination Theory bei der Entstehung und Bewältigung von Burnout, Bewertung vorhandener Messverfahren zur Erfassung von Burnout und die Ableitung von Implikationen für Interventions- und Präventionsstrategien.
Welche Modelle zur Erklärung von Burnout werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Erklärungsansätze zum Burnout-Syndrom, insbesondere die Modelle von Freudenberger und Maslach. Im Kontext des Athlete-Burnouts werden diverse Konzepte und Entstehungsmodelle diskutiert. Ein zentrales theoretisches Rahmenmodell ist die Self-Determination Theory (SDT) mit ihren Komponenten Organismic Integration Theory und Basic Needs Theory.
Wie wird die Self-Determination Theory (SDT) in die Arbeit integriert?
Die SDT dient als theoretisches Rahmenmodell zum Verständnis von Motivation und Wohlbefinden im Sport und wird im Hinblick auf die Entstehung und Bewältigung von Burnout analysiert. Ihre Bedeutung im Kontext von Athlete-Burnout wird ausführlich erläutert.
Welche Methodik wurde für die Literaturanalyse verwendet?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Methodik der durchgeführten Literaturanalyse. Dies beinhaltet die Quellen und die Vorgehensweise der Recherche sowie die angewandte Datenanalyse.
Welche Ergebnisse werden in der Arbeit präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Literaturanalyse zu verschiedenen Aspekten von Athlete-Burnout, darunter die untersuchten theoretischen Modelle und die verwendeten Messverfahren. Die Ergebnisse bezüglich der Prävalenz von Athlete-Burnout und der Rolle der SDT werden zusammengefasst.
Welche Einschränkungen der Studien und zukünftigen Forschungsfragen werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Limitationen der vorhandenen Studien und benennt offene Fragen und zukünftige Forschungsansätze im Bereich des Athlete-Burnouts.
Welche Praxistransfer und Präventionsstrategien werden vorgeschlagen?
Die Arbeit überträgt die Ergebnisse der Literaturanalyse auf die Praxis und entwickelt daraus mögliche Präventionsstrategien zur Vermeidung von Burnout im Leistungssport.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Burnout, Athlete-Burnout, Self-Determination Theory (SDT), Leistungssport, Depression, Erschöpfung, Motivation, Prävention, Interventionsstrategien, Stress, Wohlbefinden.
Welche Beispiele bekannter Leistungssportler werden genannt?
Die Einleitung nennt Beispiele wie Robert Enke, Sebastian Deisler und Sven Hannawald, um die Problematik des Burnout-Syndroms im Leistungssport zu verdeutlichen.
- Citar trabajo
- David Fußinger (Autor), 2010, Burnout im Wettkampfsport, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170447