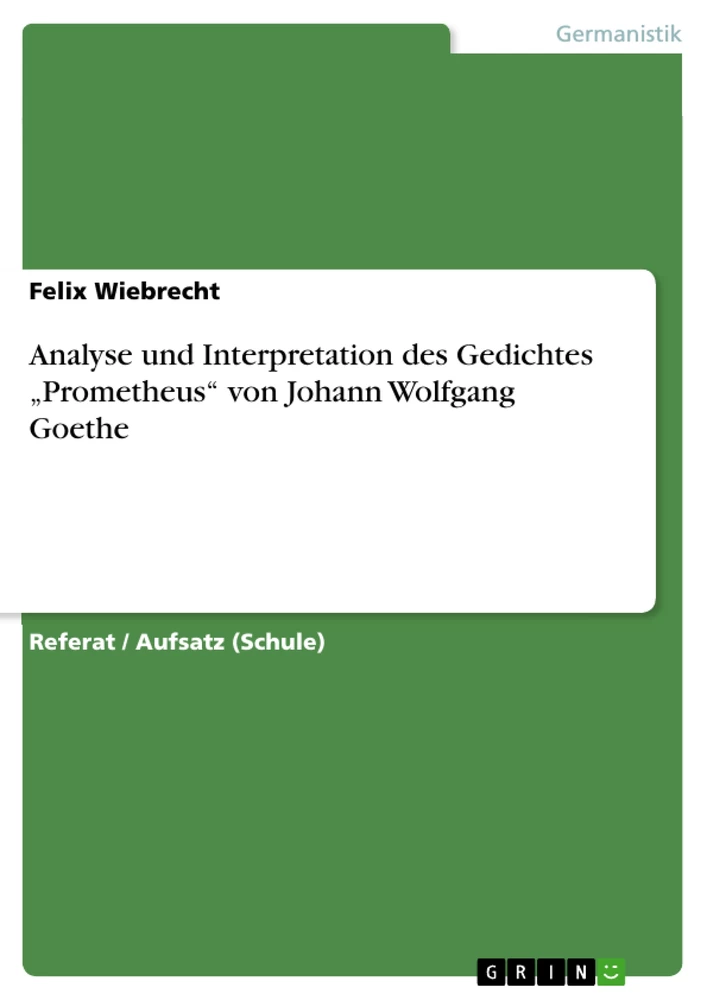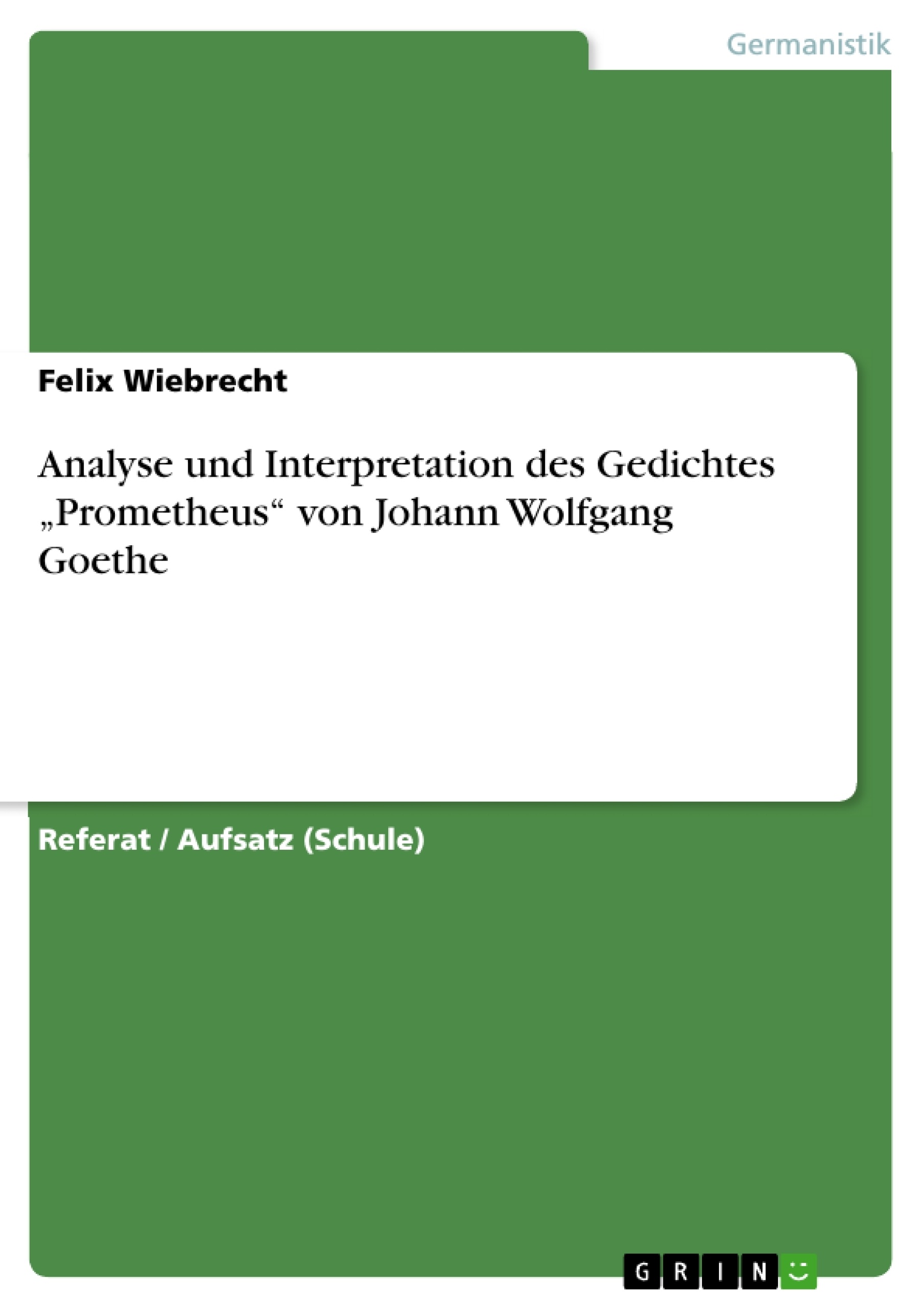Interpretation von "Prometheus" von Johann Wolfgang GoetheEs gibt viele Varianten der Schöpfungsgeschichte, aber alle unterscheiden sich hinsichtlich dem Erschaffer der Menschen. Der christlichen Geschichte nach, war es der Herr persönlich, so allerdings nicht in der griechischen Mythologie, denn in dieser ist es nicht der
Göttervater Zeus oder eine andere bedeutende Göttlichkeit, sondern der Halbgott Prometheus. In Goethes Gedicht „Prometheus“ aus dem Jahr 1775 geht es um genau diesen.
Er äußert seinen Zorn gegenüber Zeus, aber auch allen anderen griechischen Göttern gegenüber.
Im Gedicht stellt Prometheus Forderungen auf, die Zeus erfüllen sollte, so verlangt er, dass sich die Götter nicht länger an den Erfindungen der Menschen bereichern. Außerdem beleidigt er die gesamte griechische Gottschaft und berichtet dann von seinem Leidensweg. Er gab sich auch den Göttern hin, als er noch jung war, um von diesen Hilfe und Rat zu bekommen. Doch bekam er die erwartete und erhoffte Unterstützung nicht von den Göttern, somit kommt es zum Bruch zwischen diesen und dem Halbgott Prometheus. Dieser hört nun
auf, die Gottheiten überhaupt noch zu verehren, da es dazu für ihn keinen Grund gibt. Am Ende wird deutlich, dass Prometheus nun die Menschen erschafft, und zwar so, wie er sie sich vorstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhaltsangabe
- Beschreibung der äußeren Form
- Zur Figur des Prometheus aus der griechischen Mythologie
- Systematische Darlegung der Analyseergebnisse unter Berücksichtigung der Inhalt-Form-Beziehung
- Darlegung der Intention(en)
- Historischer Bezug
- Biographischer Bezug
- Gesellschaftlicher Bezug
- Persönliche Auseinandersetzung „Prometheus“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist eine detaillierte Analyse und Interpretation von Goethes Gedicht „Prometheus“. Es werden die äußere Form, der Inhalt, die Intentionen des Autors sowie die historischen, biographischen und gesellschaftlichen Bezüge untersucht. Die Analyse fokussiert auf die Beziehung zwischen Form und Inhalt und beleuchtet die Aussagekraft des Gedichtes im Kontext seiner Entstehungszeit.
- Prometheus' Rebellion gegen Zeus und die Götter
- Die Kritik an der traditionellen Vorstellung von Göttlichkeit und Macht
- Die Menschwerdung und die schöpferische Kraft des Prometheus
- Die Rolle des Feuers als Symbol der Erkenntnis und Befreiung
- Der gesellschaftliche Kontext und die Kritik am bestehenden System
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Gedichtes „Prometheus“ von Johann Wolfgang Goethe ein und skizziert den methodischen Ansatz der folgenden Analyse. Sie benennt die zu untersuchenden Aspekte, wie die äußere Form, den Inhalt, die Intentionen des Autors und den Kontext der Entstehung.
Inhaltsangabe: Die Inhaltsangabe bietet eine knappe Zusammenfassung des Handlungsverlaufs des Gedichtes. Prometheus, in seiner Rebellion gegen Zeus, beklagt die Ohnmacht und Armut der Götter im Vergleich zu seiner eigenen schöpferischen Kraft und dem Stolz auf seine menschliche Schöpfung. Er verwirft die göttliche Autorität und betont seine Unabhängigkeit.
Beschreibung der äußeren Form: Dieser Abschnitt analysiert die formale Gestaltung des Gedichtes. Die unregelmäßige Strophenform und der Verzicht auf einen durchgängigen Reim werden im Kontext des Sturm und Drang interpretiert als Ausdruck der Abkehr von traditionellen poetischen Konventionen und des Strebens nach Authentizität und Individualität.
Zur Figur des Prometheus aus der griechischen Mythologie: Dieser Teil beleuchtet die mythologische Figur des Prometheus und ihre Bedeutung für die Interpretation des Gedichtes. Die Darstellung Prometheus' als Titan, der den Menschen das Feuer brachte und dafür bestraft wurde, wird als Grundlage für Goethes Interpretation verwendet. Der Abschnitt diskutiert die verschiedenen Aspekte des Prometheus-Mythos und ihre Relevanz für Goethes Werk.
Systematische Darlegung der Analyseergebnisse unter Berücksichtigung der Inhalt-Form-Beziehung: Dieser zentrale Abschnitt verknüpft die Ergebnisse der formalen und inhaltlichen Analyse. Er untersucht, wie die sprachlichen Mittel und die formale Gestaltung die Aussage des Gedichtes unterstützen und verstärken. Die Beziehung zwischen Form und Inhalt wird als integraler Bestandteil der Interpretation betrachtet.
Darlegung der Intention(en): Hier wird spekuliert über die Intentionen Goethes beim Schreiben des Gedichtes. Die möglichen Motive, wie Kritik an der religiösen Autorität, die Betonung der menschlichen Freiheit und Selbstbestimmung oder die Auseinandersetzung mit existentiellen Fragen, werden diskutiert und anhand der Textanalyse belegt.
Schlüsselwörter
Prometheus, Zeus, Götter, Rebellion, Menschwerdung, Feuer, Freiheit, Selbstbestimmung, Sturm und Drang, Mythologie, Kritik, Gottesvorstellung, Schöpfung.
Goethes Prometheus: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei bietet eine umfassende Übersicht über eine akademische Analyse von Johann Wolfgang Goethes Gedicht "Prometheus". Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Analyse, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Die Analyse untersucht die äußere Form, den Inhalt, die Intentionen des Autors sowie die historischen, biographischen und gesellschaftlichen Bezüge des Gedichtes.
Welche Aspekte von Goethes "Prometheus" werden in der Analyse behandelt?
Die Analyse umfasst eine detaillierte Untersuchung der äußeren Form des Gedichtes (z.B. Strophenform, Reim), eine Inhaltsangabe, eine Auseinandersetzung mit der Figur des Prometheus in der griechischen Mythologie, eine systematische Darlegung der Analyseergebnisse unter Berücksichtigung der Inhalt-Form-Beziehung, eine Erörterung der Intentionen Goethes und die Berücksichtigung des historischen, biographischen und gesellschaftlichen Kontextes.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Analyse von Goethes "Prometheus"?
Schlüsselwörter, die die Analyse von Goethes "Prometheus" prägen, sind: Prometheus, Zeus, Götter, Rebellion, Menschwerdung, Feuer, Freiheit, Selbstbestimmung, Sturm und Drang, Mythologie, Kritik, Gottesvorstellung, Schöpfung.
Wie ist die Analyse von Goethes "Prometheus" strukturiert?
Die Analyse gliedert sich in verschiedene Kapitel, die jeweils einen spezifischen Aspekt des Gedichtes beleuchten. Die Kapitel umfassen eine Einleitung, eine Inhaltsangabe, eine Beschreibung der äußeren Form, eine Auseinandersetzung mit der Figur des Prometheus in der griechischen Mythologie, eine systematische Darlegung der Analyseergebnisse unter Berücksichtigung des Verhältnisses von Form und Inhalt, eine Erörterung der Intentionen Goethes sowie einen Ausblick auf die historischen, biographischen und gesellschaftlichen Bezüge.
Was ist die Zielsetzung der Analyse von Goethes "Prometheus"?
Die Zielsetzung der Arbeit ist eine detaillierte Analyse und Interpretation von Goethes Gedicht "Prometheus". Es werden die äußere Form, der Inhalt, die Intentionen des Autors sowie die historischen, biographischen und gesellschaftlichen Bezüge untersucht. Die Analyse fokussiert auf die Beziehung zwischen Form und Inhalt und beleuchtet die Aussagekraft des Gedichtes im Kontext seiner Entstehungszeit.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Analyse von Goethes "Prometheus" behandelt?
Die Analyse konzentriert sich auf folgende Themenschwerpunkte: Prometheus' Rebellion gegen Zeus und die Götter, die Kritik an der traditionellen Vorstellung von Göttlichkeit und Macht, die Menschwerdung und die schöpferische Kraft des Prometheus, die Rolle des Feuers als Symbol der Erkenntnis und Befreiung und der gesellschaftliche Kontext und die Kritik am bestehenden System.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird in der HTML-Datei bereitgestellt?
Die HTML-Datei bietet für jedes Kapitel der Analyse eine kurze Zusammenfassung. Diese Zusammenfassungen fassen die wichtigsten Punkte jedes Kapitels prägnant zusammen und geben einen Überblick über den Inhalt der einzelnen Abschnitte.
- Quote paper
- Felix Wiebrecht (Author), 2011, Analyse und Interpretation des Gedichtes „Prometheus“ von Johann Wolfgang Goethe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170057