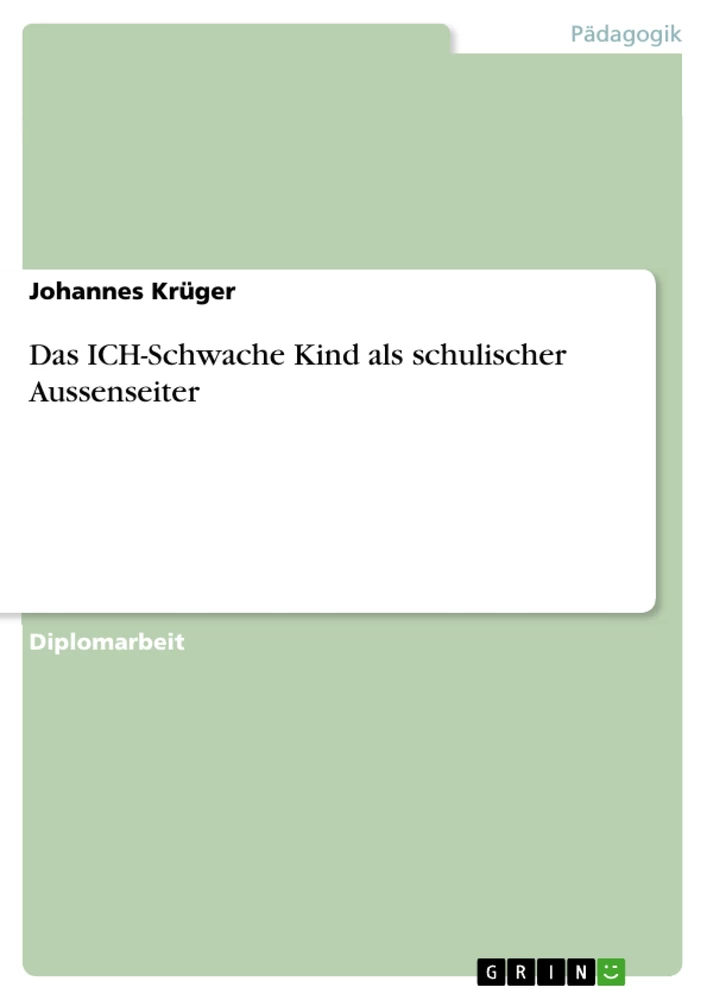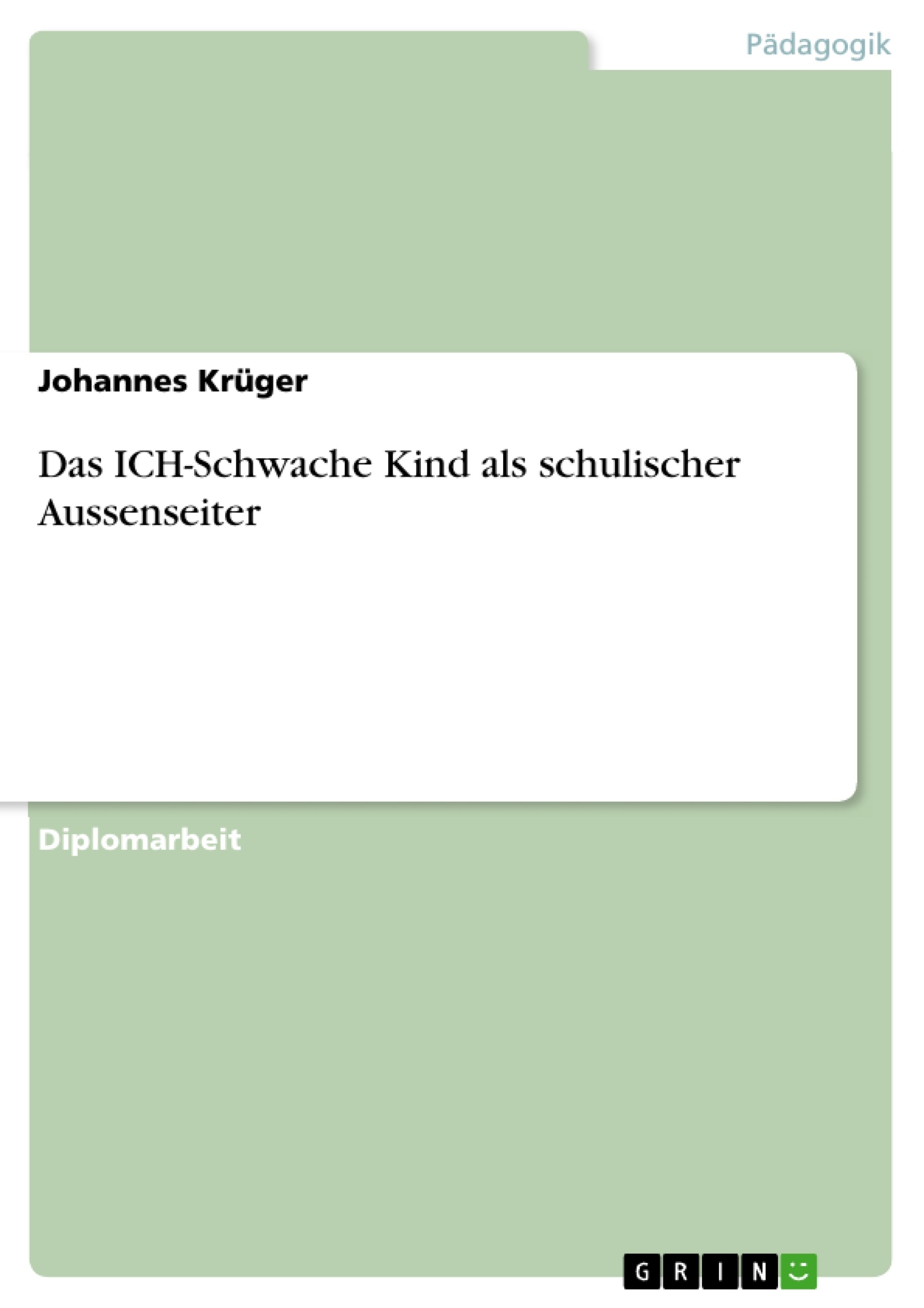"Warum immer ich? Warum bin immer ich derjenige, der gehänselt wird und mit dem sie ihren Spott treiben? Ich hab′ ihnen doch gar nichts getan! Gestern sind sie wieder alle auf einmal auf mich losgegangen und haben mir meine Schulsachen weggenommen. Und kein Einziger, der zu mir halten und mir helfen würde! Warum?"
So, oder so ähnlich geht es immer wieder Kindern in unseren Schulklassen. Hilflos sind sie dem Spott und den Hänseleien ihrer Mitschüler ausgeliefert und wissen sich meist nicht zu helfen. Vielfach sind es Kinder, die dem Lehrer1 gar nicht besonders auffallen. Sie verhalten sich eher ruhig, still, schüchtern und melden sich fast nie von sich aus zu Wort.
Im Schulalltag besteht die Gefahr, dass Lehrer - voll in Anspruch genommen von den "lebhaften", "aktiven", "lauten" Kindern - diese "ruhigen" Kinder nicht ausreichend wahrnehmen und ihren Bedürfnissen entsprechend unterstützen. Dabei wären gerade diese Kinder auf Hilfe von außen angewiesen, weil sie sich aus eigener Kraft meist nicht aus ihrer misslichen Situation befreien können.
Mögliche Ursachen und Erklärungsmodelle
In dieser Arbeit sollen - ausgehend von einer Fallbeschreibung - gruppentheoretische und individuelle Aspekte dieses Phänomens beleuchtet sowie mögliche Ursachen und Erklärungsmodelle dafür gefunden werden. Warum haben manche Kinder so große Schwierigkeiten, sich in einer Gruppe von Gleichaltrigen zurechtzufinden und zu behaupten? Welche Faktoren sind dafür verantwortlich?
Pädagogische Interventionsmöglichkeiten
Anschließend soll untersucht werden, welche pädagogischen Hilfestellungen Lehrern zur Verfügung stehen, um solchen Kindern zu helfen. Dabei soll der Schwerpunkt auf Interventionsmöglichkeiten gelegt werden, die im Regelschulbetrieb der Hauptschule umgesetzt werden können.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- FALLBESCHREIBUNG
- DIE GRUPPE UND IHR AUSSENSEITER
- WAS VERSTEHT MAN UNTER EINER GRUPPE?
- GRUPPENENTWICKLUNG
- ORIENTIERUNG UND EXPLORATION
- AUSEINANDERSETZUNG UND MACHTKAMPF
- BINDUNG UND VERTRAUTHEIT
- DIFFERENZIERUNG UND FESTIGUNG
- ABSCHLUSS UND NEUORIENTIERUNG
- KOMMUNIKATION
- NORMEN
- ENTSTEHUNG UND FUNKTION VON NORMEN
- SICHERUNG DES NORMENSYSTEMS
- ÄNDERUNG VON NORMEN
- VERHALTEN IN GRUPPEN
- FELDTHEORIE VON LEWIN
- ROLLENTHEORIE
- Position und Rolle
- Rollenkonflikte
- DAS AUSSENSEITERTUM
- WER WIRD ZUM AUSSENSEITER?
- DIE ROLLE DES AUSSENSEITERS IN DER GRUPPE
- PROBLEMATIK DES AUSSENSEITERTUMS
- Stigmatisierung
- Zirkuläre Verstärkerprozesse
- Stabilität
- ICH-SCHWÄCHE
- BEGRIFFSBESTIMMUNG
- ICH-STÄRKE
- Anlage
- Selbstkompetenz
- Wahrnehmungskompetenz
- Sozialkompetenz
- ICH-SCHWÄCHE
- ASPEKTE DER ICH-SCHWÄCHE
- SOZIALE INKOMPETENZ
- SOZIALER RÜCKZUG
- SOZIALE ISOLIERUNG
- SOZIALE ANGST
- Zeichen und Symptome sozialer Angst
- Kognitives Modell der sozialen Angst
- SOZIAL UNSICHERES VERHALTEN
- DEPRESSION
- Erscheinungsformen depressiver Störungen
- Wie kann man Depression erkennen?
- Negative Spiralen
- Begleiterscheinungen von Depressionen
- Stabilität depressiver Belastung im Lebenslauf
- Ursachen von Depressionen
- Zusammenhang Angst – Unsicherheit – Depression
- MÖGLICHE URSACHEN FÜR ENTWICKLUNGSSTÖRUNGEN DER ICH-STÄRKE
- ANLAGE - UMWELT
- ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHES MODELL NACH ERIKSON
- UR-VERTRAUEN VERSUS UR-MISSTRAUEN
- AUTONOMIE VERSUS SCHAM UND ZWEIFEL
- WERKSINN VERSUS MINDERWERTIGKEITSGEFÜHL
- LERNTHEORETISCHE KONZEPTE
- MODELLLERNEN
- VERSTÄRKUNGSLERNEN
- KLASSISCHES KONDITIONIEREN
- THEORIE DER ERLERNTEN HILFLOSIGKEIT NACH SELIGMAN
- EXPERIMENTE
- ERLERNTE HilflosigkeiT UND AUSSENSEITERTUM
- ERZIEHUNG
- MÖGLICHE URSACHEN IN der ErziehuNG
- ÜBERZOGENE SCHUTZHALTUNG
- VERWÖHNUNG UND EHRGEIZ
- SOZIALER PERFEKTIONISMUS
- FEHLENDE KONSEQUENZ
- VERHARMLOSUNG ODER DRAMATISIERUNG EINES PROBLEMS
- PÄDAGOGISCHE INTERVENTIONSMÖGLICHKEITEN
- INDIKATIONSSTELLUNG
- VERHALTENSBEOBACHTUNG
- INDIVIDUelle FörderUNG
- EINZELGESPRÄCHE
- FÖRDERUNG DES SELBSTBEWUSSTSEINS
- FÖRDERUNG DER SELBSTSTÄNDIGKEIT
- KONTAKTE ERMÖGLICHEN
- ANGST VERMINDERN
- SOZIALE UNSICHERHEIT VERMINDERN
- Einzeltraining
- Gruppentraining
- INTERVENTION BEI DEPRESSIVEN VERSTIMMUNGEN
- WERTSCHÄTZUNG
- SCHAFFUNG EINES INTEGRATIVEN KONTEXTES
- MÖGLICHKEITEN IN DER KLASSE
- Aufstellen von Spielregeln
- Offene Gruppennormen
- Einsatz von Sozialformen im Unterricht
- Spiele
- Bekräftigung gewünschten Verhaltens
- Rollenspiele
- LEHRERVERHALTEN
- Der Lehrer als Modell für kooperatives Verhalten
- Der Lehrer als Modell für tolerantes Verhalten
- Der Lehrer als Modell für positives Konfliktlösungsverhalten
- SCHULORGANISATORISCHE MÖGLICHKEITEN
- ELTERNARBEIT
- ZUSAMMENFASSUNG
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des schülischen Außenseiters, insbesondere mit dem "ich-schwachen" Kind, das in der Gruppe aufgrund seiner mangelnden Selbstbehauptung und Sozialkompetenz ausgegrenzt wird. Die Arbeit untersucht die gruppendynamischen Prozesse, die zur Ausgrenzung führen, sowie die individuellen Faktoren, die zur "Ich-Schwäche" beitragen können. Dabei werden verschiedene theoretische Ansätze und Modelle aus der Pädagogischen Psychologie herangezogen, um die Problematik zu beleuchten und mögliche Interventionsstrategien im Schulalltag aufzuzeigen.
- Gruppendynamische Prozesse und ihre Auswirkungen auf das Außenseitertum
- Das Konzept der "Ich-Schwäche" und ihre Auswirkungen auf das Sozialverhalten von Kindern
- Mögliche Ursachen für die Entwicklung von "Ich-Schwäche" im Kontext von Anlage und Umwelt
- Pädagogische Interventionsmöglichkeiten zur Förderung der Selbstständigkeit und Sozialkompetenz von "ich-schwachen" Kindern
- Schöpfungs eines integrativen Kontextes in der Schulklasse, um Ausgrenzung zu verhindern und ein positives Klassenklima zu fördern
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Thema des Außenseitertums in der Schule vor, fokussiert auf die Problematik des "ich-schwachen" Kindes und die damit verbundenen Schwierigkeiten in der Gruppenintegration. Die Arbeit erläutert den methodischen Ansatz und die Zielsetzung.
- Die Gruppe und ihr Außenseiter: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition einer Gruppe, deren Entwicklungsphasen und Kommunikationsstrukturen sowie mit den Normen und Verhaltensweisen in Gruppen. Es beleuchtet die Rolle des Außenseiters und die Problematik seiner Ausgrenzung.
- Ich-Schwäche: Dieses Kapitel definiert den Begriff der "Ich-Schwäche" und untersucht verschiedene Aspekte wie soziale Inkompetenz, sozialer Rückzug, soziale Angst und Depression. Die Kapitel beleuchtet die Ursachen und Symptome dieser Phänomene.
- Mögliche Ursachen für Entwicklungsstörungen der Ich-Stärke: Dieses Kapitel analysiert die Interaktion von Anlage und Umweltfaktoren, die zur Entwicklung von "Ich-Schwäche" beitragen können. Es werden Entwicklungspsychologische Modelle sowie Lerntheoretische Konzepte erläutert, um die Problematik der "Ich-Schwäche" zu verstehen.
- Pädagogische Interventionsmöglichkeiten: Dieses Kapitel stellt verschiedene pädagogische Interventionen vor, die Lehrkräfte im Schulalltag einsetzen können, um "ich-schwachen" Kindern zu helfen. Es umfasst Einzel- und Gruppentrainings, die Förderung der Selbstständigkeit und des Selbstbewusstseins sowie die Schaffung eines integrativen Kontextes in der Klasse.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen "Ich-Schwäche", "Außenseitertum", "Gruppenintegration", "Sozialkompetenz", "Selbstständigkeit" und "pädagogische Interventionen" im Kontext von Schule und Unterricht. Sie untersucht die Ursachen und Auswirkungen von "Ich-Schwäche" und bietet pädagogische Hilfestellungen für Lehrkräfte, um Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen und die Entstehung von Außenseitertum in der Klasse zu verhindern.
- Quote paper
- Dipl.Päd. MSc Johannes Krüger (Author), 2003, Das ICH-Schwache Kind als schulischer Aussenseiter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16992