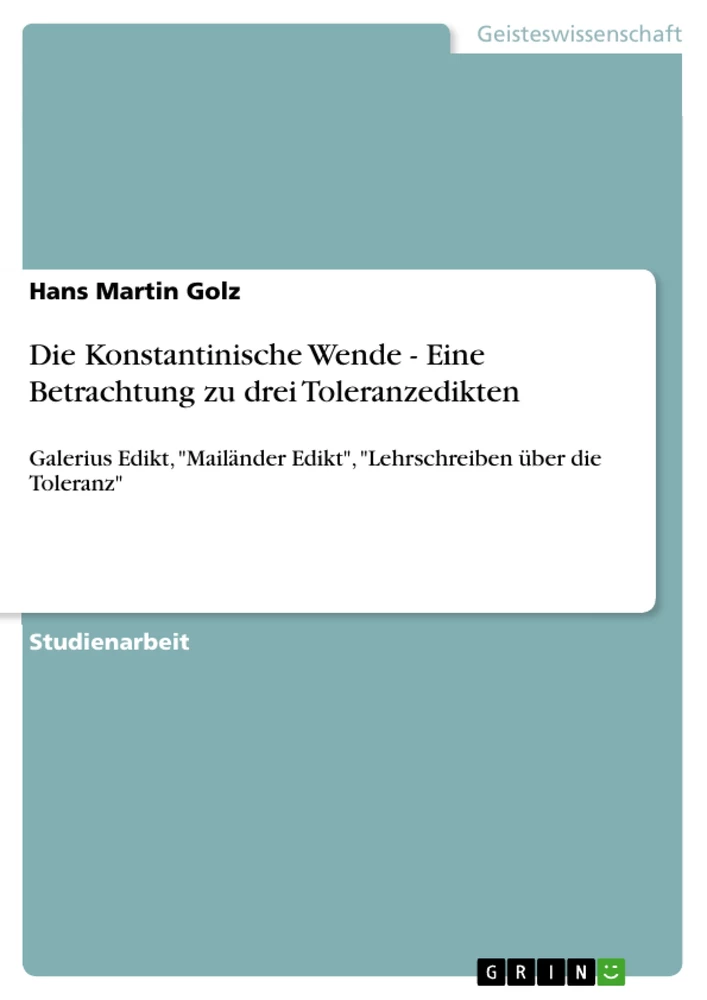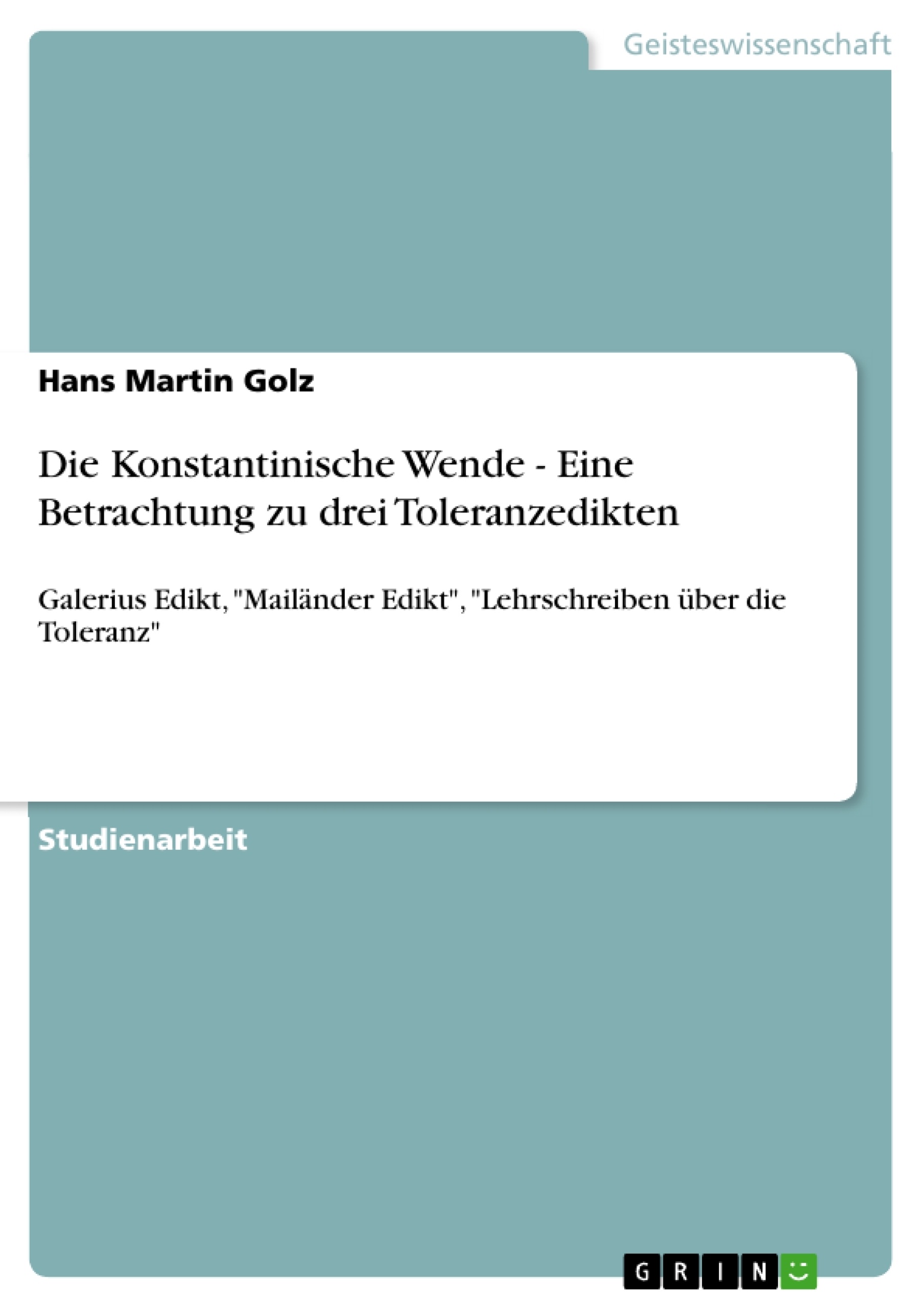Nach dem Versagen der Diokletianischen Verfolgung und dem damit einhergehenden Versuch, das
römische Imperium als Kultgenossenschaft zu einen, trat eine für die antiken Voraussetzungen
ungewöhnliche Phase ein. Mit dem Toleranzedikt von Nikomedia des Kaisers Galerius von 311
wurde, neben den zahlreichen heidnischen Kulten, auch dem Christentum religiöse Freiheit und
Betätigung gewährt, mit der Bedingung, für das Heil des Kaisers und des Staates zu beten2. In die
Nachfolge dieses Edikts trat Konstantin, der im Laufe seiner langen Regierungszeit (306-337) einen
persönlichen religiösen Wandel vollzog, welcher sich in seiner Politik dieser Jahre widerspiegeln
sollte. Konstantin wandte sich von den heidnischen Göttern, wie Jupiter und Apollo, ab, begeisterte
sich anschließend für den monotheistischen Glauben an den Sol Invictus und bekannte sich
schließlich zum Christentum. Dieser Glaubensweg des Kaisers ist auch in den einzelnen Perioden
seiner Herrschaft wiederzufinden, die sich anhand von zwei weiteren Toleranzedikten gliedern lässt.
Mit dem „Edikt von Mailand“ im Jahre 313 beginnt Konstantins Bemühen für die Gleichstellung
des Christentums mit der Jahrhunderte alten heidnischen Religion. Das Gleichgewicht dieses
Nebeneinanders der Religionen auf Augenhöhe sollte sich in den folgenden Jahren jedoch zu
Gunsten der Christen verschieben. Mit dem „Lehrschreiben über die Toleranz“ aus dem Jahr 324
sollte dieser Weg im Bekenntnis des Kaisers zum „Christengott“ enden. Die Christen erlangten den
Status der Reichsreligion, wobei zu beachten gilt, dass Konstantin das Heidentum in seiner
Amtszeit nicht verbot oder verfolgte. Es gab somit immer noch ein Nebeneinander der Religionen,
nur nicht mehr „auf Augenhöhe“. In den folgenden Betrachtungen soll der Weg des Christentums
von einer verfolgten Religion hin zur Reichsreligion anhand der drei oben genannten Toleranzedikte
nachgezeichnet werden. Weiter stehen die Verfügungen dieser Schreiben im Vordergrund, um die
Frage zu beleuchten, wie die Christen nach Erlangen der staatlichen Macht mit dem Heidentum
umgingen, welches zuvor versuchte hatte, sie durch Verfolgungen auszurotten. Diese Arbeit soll
hier lediglich den Zeitraum der Herrschaft Kaisers Konstantin I. umfassen.
1
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Das Toleranzedikt von Nikomedia
- Das,,Mailänder Edikt“
- Das Lehrschreiben über die Toleranz
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des Christentums von einer verfolgten Religion zur Reichsreligion während der Herrschaft des römischen Kaisers Konstantin I. Sie analysiert die drei Toleranzedikte des Kaisers und beleuchtet, wie die Christen nach Erlangen der staatlichen Macht mit dem Heidentum umgingen, das zuvor versuchte hatte, sie auszurotten.
- Die Rolle des Toleranzedikts von Nikomedia im Kontext der Diokletianischen Verfolgung
- Der Wandel in Konstantins Religionspolitik und die Einführung des „Edikts von Mailand“
- Die Bedeutung des „Lehrschreibens über die Toleranz“ für die Etablierung des Christentums als Reichsreligion
- Die Beziehung zwischen Staat und Religion im Römischen Reich
- Der Umgang mit dem Heidentum nach dem Aufstieg des Christentums
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Einleitung stellt die historische Situation vor dem Toleranzedikt von Nikomedia dar und beschreibt die Rolle des Christentums im römischen Imperium während der Diokletianischen Verfolgung. Sie gibt zudem einen Überblick über die drei Toleranzedikte, die im Zentrum der Arbeit stehen.
- Das Toleranzedikt von Nikomedia: Dieses Kapitel untersucht das Edikt des Kaisers Galerius aus dem Jahr 311, das die Christenverfolgung offiziell beendete. Es analysiert die Motivation Galerius' für diese Entscheidung und beleuchtet die Bedingungen, die den Christen für die Ausübung ihres Glaubens gestellt wurden.
- Das,,Mailänder Edikt“: Dieses Kapitel behandelt die Deklaration von Konstantin und Licinius aus dem Jahr 313, die die Gleichstellung des Christentums mit der heidnischen Religion einleitete. Es beleuchtet die Folgen dieser Entscheidung für die Religionslandschaft des Römischen Reiches und die Position des Christentums.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit konzentriert sich auf die Toleranzedikte des Kaisers Konstantin I., die Entwicklung des Christentums im römischen Reich, die Beziehung zwischen Staat und Religion, die Christenverfolgung, das Heidentum, und die politische und religiöse Landschaft im 4. Jahrhundert nach Christus.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Toleranzedikt von Nikomedia?
Es wurde 311 n. Chr. von Kaiser Galerius erlassen und beendete offiziell die Christenverfolgung, indem es dem Christentum religiöse Freiheit gewährte.
Was besagte das „Mailänder Edikt“ von 313?
Es war eine Vereinbarung zwischen Konstantin und Licinius, die die vollständige Gleichstellung des Christentums mit den heidnischen Kulten festlegte.
Wie entwickelte sich Konstantins persönlicher Glaube?
Konstantin wandte sich von traditionellen Göttern ab, verehrte zunächst den Sol Invictus und bekannte sich schließlich zum Christengott.
Wurde das Heidentum unter Konstantin verboten?
Nein, Konstantin verbot das Heidentum nicht, verschob jedoch die staatliche Förderung und Bevorzugung massiv zugunsten der christlichen Kirche.
Was ist das „Lehrschreiben über die Toleranz“ von 324?
In diesem Schreiben bekannte sich Konstantin offen zum Christentum und festigte dessen Status als faktische Reichsreligion nach seinem Sieg über Licinius.
- Citar trabajo
- Hans Martin Golz (Autor), 2009, Die Konstantinische Wende - Eine Betrachtung zu drei Toleranzedikten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169922