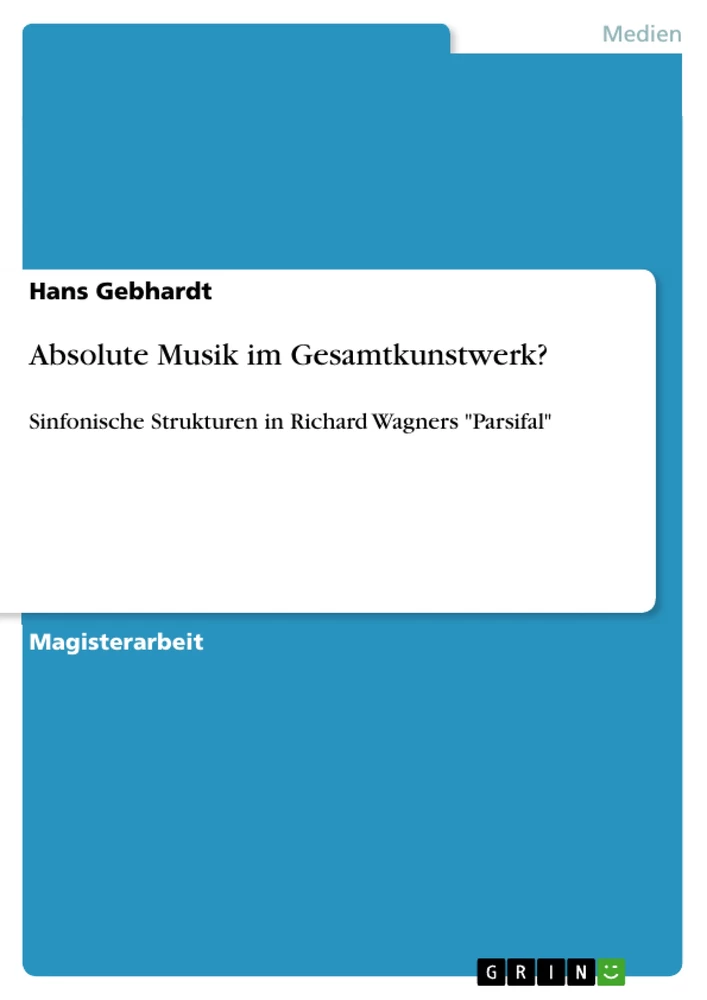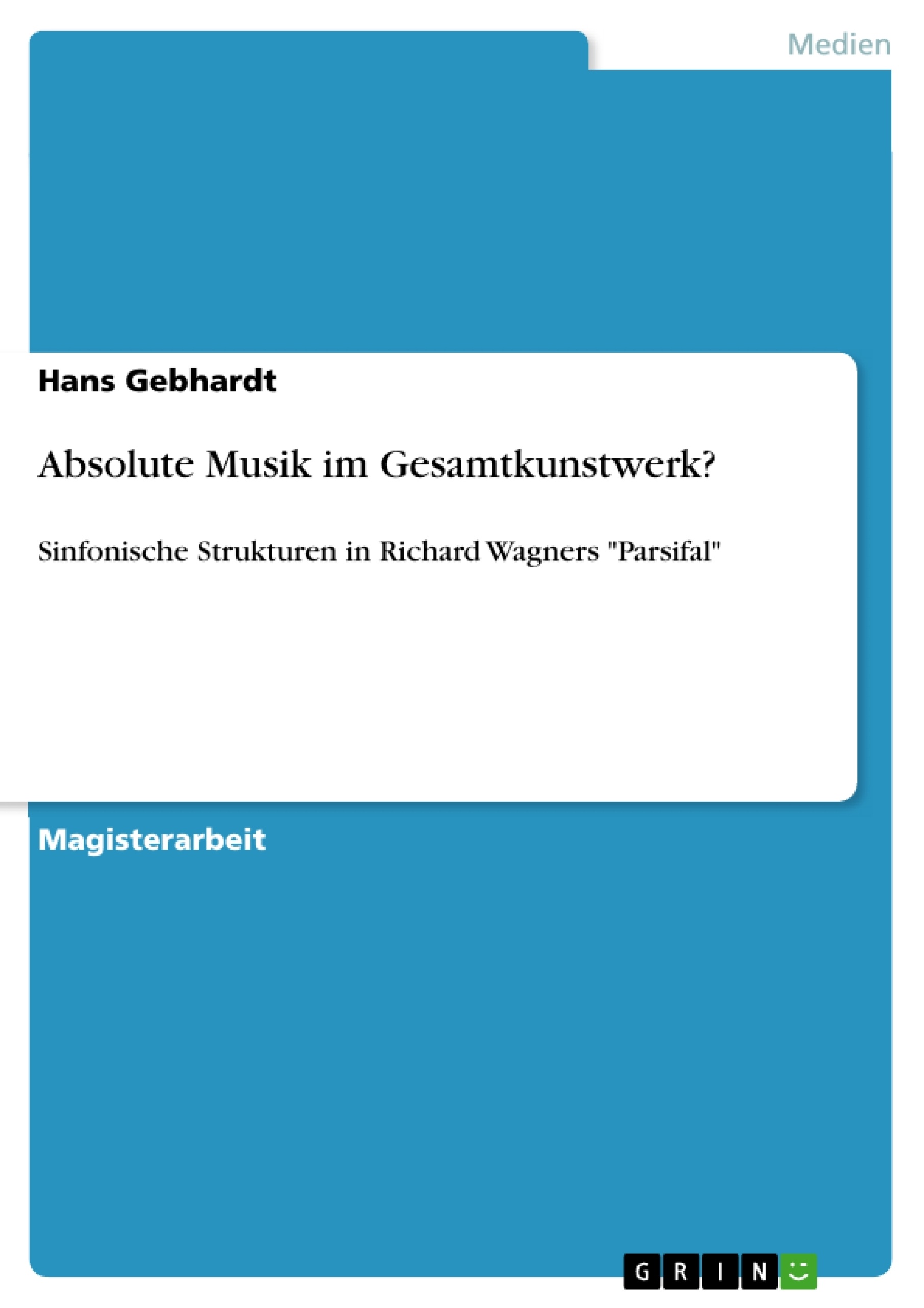Richard Wagners letztes Musikdrama "Parsifal" entstand in den fünf Jahren von 1877 bis 1882. Mehr noch als bei anderen seiner Werke legte Wagner während der Komposition Wert auf musikalische Geschlossenheit und Eigenständigkeit. Ein weiterer zentraler Gesichtspunkt, der den Parisfal von vorherigen Werken unterscheidet, ist der Stellenwert des Ritus darin. - Im Ergebnis schuf Wagner das wohl am wenigsten dramatische, jedoch am stärksten von religiösem Kult geprägte musikalische Drama seines Œuvres. Die Musik aber ist ungemein stark vom Autonomiegedanken geprägt.
Ausgehend von Wagners schöpferischer Verfahrensweise, die für die Arbeit am Parsifal Dank der Tagebuchaufzeichnungen Cosimas außergewöhnlich detailliert dokumentiert wurde, wird der Blick auf die Machart der Musik gelenkt. Der Schwerpunkt liegt also nicht auf dem musikalischen Drama als Gesamtkunstwerk, sondern auf seiner Musik als einer eigenständigen Entität. Eine solche Betrachtungsweise legitimiert sich bereits durch den dezidiert sinfonischen Anspruch des Komponisten. Im Parsifal kam dieser Anspruch besonders zum Tragen, denn je älter Wagner wurde, desto entschiedener verfolgte er instrumentalmusikalische Prinzipien. – Das vorliegende Buch stellt sich dem Versuch, die Musik des Wagnerschen Dramas nicht aus der Sicht des Musiktheaters zu beurteilen (was zwangsläufig ein Stehenbleiben bei den in ihrer Erklärungskraft beschränkten Leitmotiven zur Folge hätte), sondern sie aus einem Blickwinkel zu betrachten, der dem ideellen und qualitativen Anspruch der Musik gerecht wird. Versucht wird eine musikalische (Form-)Analyse des Parsifal unter Einbeziehung von Wagners Arbeitsweise und seiner bedeutendsten ästhetischen Ansichten.
Nicht nur die zahlreichen Abschnitte reiner Instrumentalmusik im Bühnenweihfestspiel zeigen, dass es sich bei diesem Werk um mehr als eine Oper im konventionellen Sinn handelt: Wagner erschuf gleichsam ein von sinfonischen Prinzipien geprägtes Musiktheater. - Das Ziel des Autors ist es, zu einem angemesseneren Blick auf Wagners "Opern", besonders auf seine letzte, beizutragen. Dies aber kann nur durch eine veränderte Methodik in der Charakterisierung der Musik darin erreicht werden. Deren analytische Beurteilung steht deshalb im Mittelpunkt. So wird die Komposition des Parsifal auch in denjenigen Kontext gestellt, in dem sie Wagner selbst gedanklich verortete – nämlich in jenen der Instrumentalmusik seiner großen Vorbilder Johann Sebastian Bach und Ludwig van Beethoven.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Musik des Parsifal
- 2.1 Themen und Motive
- 2.2 Expositionen und Reprisen
- 2.3 Diatonik und Chromatik
- 2.4 Durchführung und musikalische Arbeit
- 2.5 Form - Musik, Szene und die Konzeption des Ganzen
- 3. Das Bühnenweihfestspiel - Musiktheater mit sinfonischen Prinzipien
- 4. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sinfonischen Strukturen in Richard Wagners "Parsifal" und hinterfragt die gängige Bezeichnung des Werks als "Oper". Ziel ist es, die Einzigartigkeit des Bühnenweihfestspiels im Kontext von Wagners Gesamtwerk herauszuarbeiten und die musikalische Gestaltung im Verhältnis zur Handlung und der Gesamtkonzeption zu analysieren.
- Die sinfonische Gestaltung des Parsifal
- Die Beziehung zwischen Musik, Szene und der Gesamtkonzeption
- Die Abgrenzung des Parsifal vom traditionellen Musikdrama bzw. der Oper
- Die Bedeutung des Bühnenweihfestspiels als rituelles Werk
- Analyse von Themen und Motiven in ihrer musikalischen Funktion
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die besondere Stellung des Parsifal im Œuvre Richard Wagners. Sie problematisiert die gängige Bezeichnung als "Oper" und führt den Begriff "Bühnenweihfestspiel" als präzisere Beschreibung der Intention Wagners ein. Der Fokus liegt auf der Einzigartigkeit des Werkes und dem Willen Wagners, dieses durch die Namensgebung selbst zu definieren und von anderen Werken abzugrenzen. Die Diskussion um die Einmaligkeit des Dramas und Wagners Abkehr von diesem Ideal im Parsifal wird hier bereits angerissen. Der Autor kündigt an, den Begriff "Bühnenweihfestspiel" kritisch zu hinterfragen, jedoch nicht zu ignorieren, und ihn im weiteren Verlauf der Arbeit den Begriffen "Musikdrama" und "Oper" vorzuziehen.
2. Die Musik des Parsifal: Dieses Kapitel widmet sich einer detaillierten Analyse der musikalischen Strukturen des Parsifal. Es untersucht die Themen und Motive, ihre Expositionen und Reprisen, den Umgang mit Diatonik und Chromatik sowie die Durchführung und die musikalische Arbeit im Werk. Die Analyse umfasst die komplexen musikalischen Verflechtungen und die Rolle der Musik in der Gestaltung der Szene und der Gesamtkonzeption. Es wird die spezifische Art und Weise untersucht, in der Wagner die Musik verwendet, um die Handlung voranzutreiben, die Stimmung zu erzeugen und die übergeordneten Themen des Werkes zu unterstützen. Die einzelnen Unterkapitel untersuchen verschiedene Aspekte der musikalischen Struktur, um ein umfassendes Bild der musikalischen Gestaltung zu erstellen.
3. Das Bühnenweihfestspiel - Musiktheater mit sinfonischen Prinzipien: Dieses Kapitel dürfte die Synthese der vorherigen Kapitel darstellen und den Gesamtcharakter des Parsifal als Bühnenweihfestspiel beleuchten. Es dürfte die Verbindung zwischen den sinfonischen Prinzipien und dem rituellen Charakter des Musiktheaters untersuchen und die Frage nach der Einzigartigkeit und der Abgrenzung von anderen Werken Wagners weiter vertiefen. Wahrscheinlich werden die Ergebnisse der musikalischen Analyse auf die Gesamtkonzeption des Werkes bezogen und die Bedeutung der sinfonischen Strukturen im Kontext des rituellen Aspekts des Bühnenweihfestspiels diskutiert.
Schlüsselwörter
Richard Wagner, Parsifal, Bühnenweihfestspiel, Oper, Musikdrama, Sinfonische Strukturen, Themen und Motive, Musiktheater, Ritus, Gesamtkonzeption, musikalische Arbeit, Diatonik, Chromatik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Die sinfonischen Strukturen in Richard Wagners Parsifal"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die sinfonischen Strukturen in Richard Wagners "Parsifal" und hinterfragt die gängige Bezeichnung des Werks als "Oper". Sie untersucht die Einzigartigkeit des Bühnenweihfestspiels im Kontext von Wagners Gesamtwerk und analysiert die musikalische Gestaltung im Verhältnis zur Handlung und der Gesamtkonzeption.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die sinfonische Gestaltung des Parsifal, die Beziehung zwischen Musik, Szene und Gesamtkonzeption, die Abgrenzung des Parsifal vom traditionellen Musikdrama/der Oper, die Bedeutung des Bühnenweihfestspiels als rituelles Werk und die Analyse von Themen und Motiven in ihrer musikalischen Funktion.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zur detaillierten musikalischen Analyse des Parsifal (einschließlich Themen, Motive, Expositionen, Reprisen, Diatonik, Chromatik und musikalischer Arbeit), einem Kapitel, das den Parsifal als Bühnenweihfestspiel mit sinfonischen Prinzipien beleuchtet, und einem Literaturverzeichnis.
Wie wird der Parsifal in dieser Arbeit bezeichnet?
Die Arbeit problematisiert die gängige Bezeichnung "Oper" und bevorzugt den Begriff "Bühnenweihfestspiel" als präzisere Beschreibung von Wagners Intention. Der Autor kündigt an, den Begriff kritisch zu hinterfragen, ihn aber dennoch im weiteren Verlauf der Arbeit den Begriffen "Musikdrama" und "Oper" vorzuziehen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, die Einzigartigkeit des Bühnenweihfestspiels "Parsifal" im Kontext von Wagners Gesamtwerk herauszuarbeiten und die musikalische Gestaltung im Verhältnis zur Handlung und der Gesamtkonzeption zu analysieren.
Welche Aspekte der Musik werden analysiert?
Die Analyse umfasst Themen und Motive, ihre Expositionen und Reprisen, den Umgang mit Diatonik und Chromatik, die Durchführung und die musikalische Arbeit im Werk. Es wird untersucht, wie Wagner die Musik verwendet, um die Handlung voranzutreiben, die Stimmung zu erzeugen und die übergeordneten Themen des Werkes zu unterstützen.
Wie wird das dritte Kapitel die vorherigen Kapitel zusammenfassen?
Das dritte Kapitel soll die Synthese der vorherigen Kapitel darstellen und den Gesamtcharakter des Parsifal als Bühnenweihfestspiel beleuchten. Es wird die Verbindung zwischen den sinfonischen Prinzipien und dem rituellen Charakter des Musiktheaters untersuchen und die Frage nach der Einzigartigkeit und Abgrenzung von anderen Werken Wagners vertiefen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Richard Wagner, Parsifal, Bühnenweihfestspiel, Oper, Musikdrama, Sinfonische Strukturen, Themen und Motive, Musiktheater, Ritus, Gesamtkonzeption, musikalische Arbeit, Diatonik, Chromatik.
- Quote paper
- Hans Gebhardt (Author), 2010, Absolute Musik im Gesamtkunstwerk?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169902