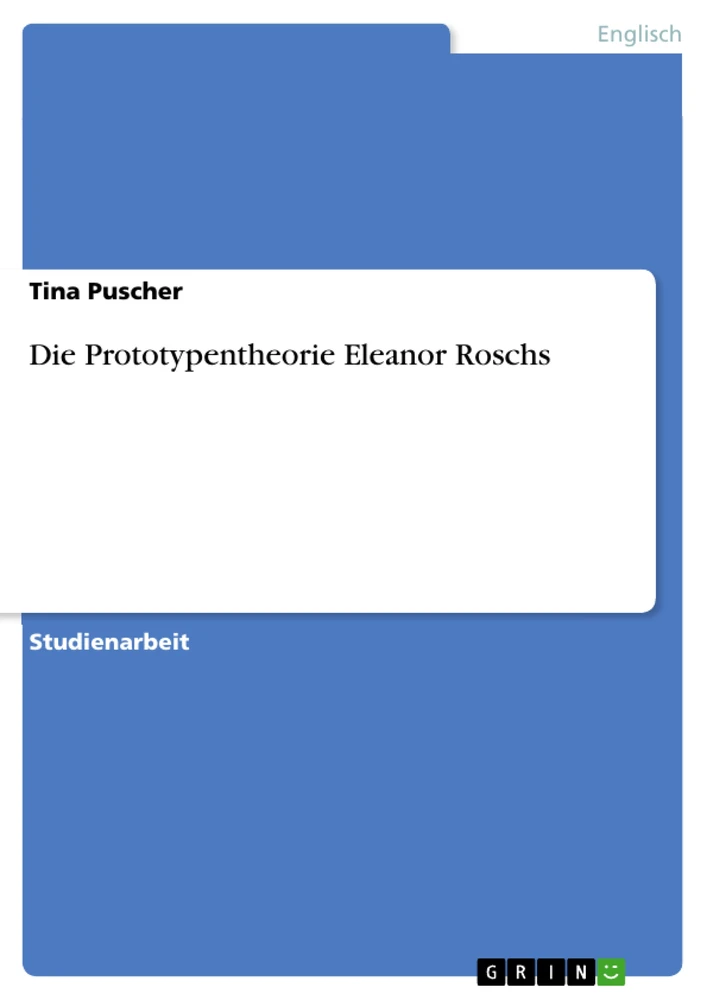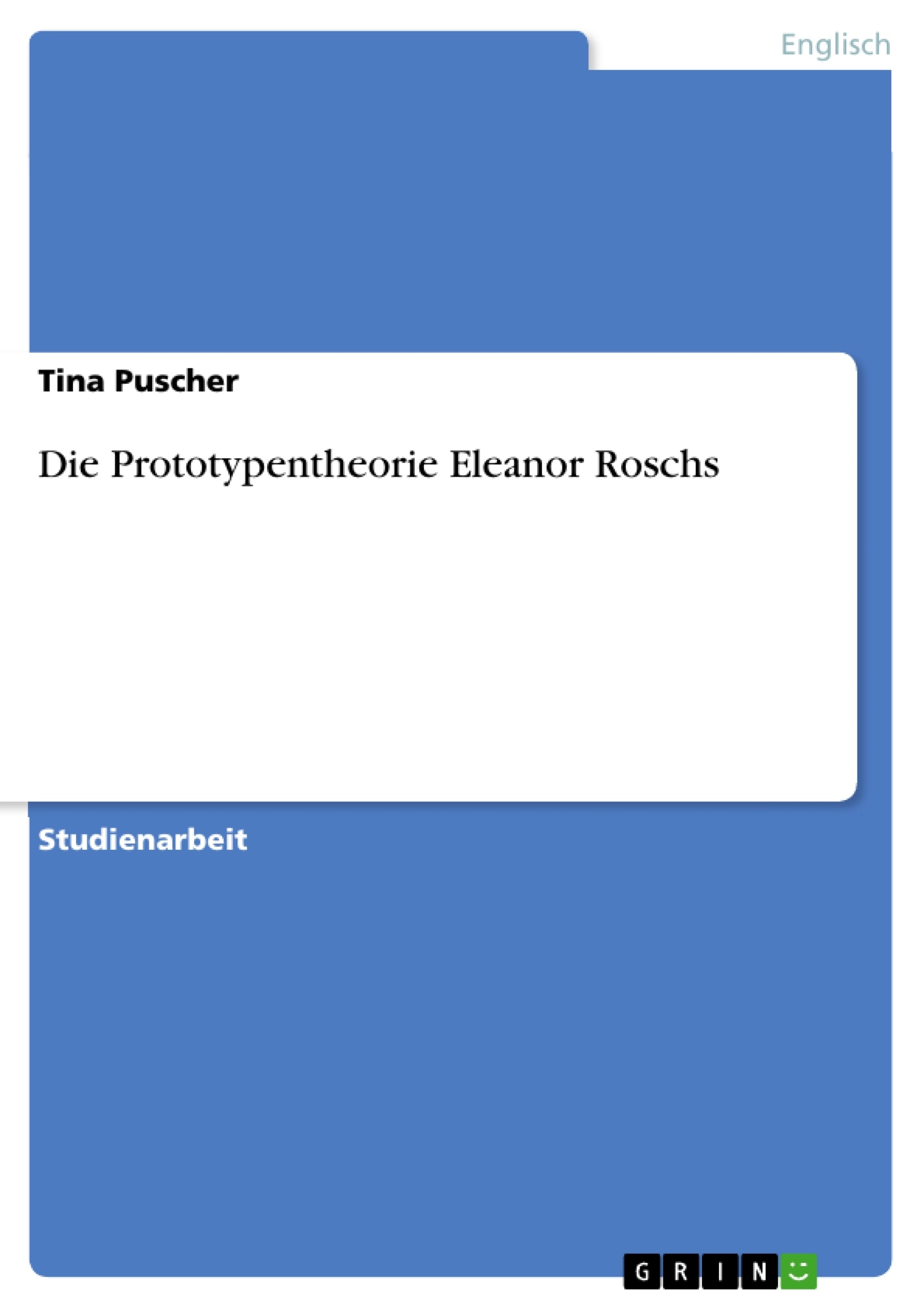Solange der Mensch denken kann, ist er bestrebt, die ihn umgebende Welt zu
verstehen und zum Teil sogar nachzubilden. Daher führten zum Beispiel
physikalische Experimente und Studien Anfang des 20. Jahrhunderts dazu,
dass er sich den lang gehegten Traum vom Fliegen erfüllen konnte. Ebenso
bietet heute, am Anfang des 21. Jahrhunderts, die nun offen gelegte DNAStruktur
verschiedener Lebewesen dem Menschen die Möglichkeit, diese
genetisch zu verändern und somit vom erschafften Wesen zum Erschaffenden
selbst zu werden. Im Zuge dieser Geschichte ist auch die so genannte KIForschung
zu sehen, also die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Die ständige
Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Computern scheint derartige
Vorhaben in absehbarer Zeit möglich zu machen, dennoch darf nicht vergessen
werden, dass es sich hierbei lediglich um eine Erweiterung des
Arbeitsspeichers, bzw. eine Verringerung der Arbeitszeit, von Computern
handelt. Viel wichtiger jedoch erscheint ein Verständnis dafür, was letztendlich
„Intelligenz“ bedeutet. Das Lexikon beschreibt sie zum Beispiel als Fähigkeit,
anschauliche und abstrakte Beziehungen herzustellen und diese zur
Bewältigung neuer Situationen und Probleme einzusetzen.1 Diese in sich
ebenfalls abstrakte Definition stellt allerdings keine Grundlage für die
Programmierung einer derartigen Fähigkeit dar. Deshalb bedarf es der
wissenschaftlichen Arbeit der Psychologie, der Linguistik und anderer
Disziplinen, um die Denkweise des Menschen zu entschlüsseln und um sie
anhand dieser konkreten Ergebnisse nachzubilden.
Im folgenden soll nun dargelegt werden, inwiefern das in den 70er Jahren des
20. Jahrhunderts von der Psychologin Eleanor Rosch entwickelte Modell der
Prototypensemantik menschliches Denken beschreiben kann und welchen
Stellenwert es in der Linguistik gegenüber der von Aristoteles beeinflussten
Komponentenanalyse einnimmt. Da sich bei beiden Modellen die Beispiele
häufig auf Substantive beschränken, wird sich die folgende Arbeit auch damit
beschäftigen, ob eventuell im Bereich der Verben eine prototypische Struktur
nachzuweisen ist. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Notwendigkeit der Linguistik und der kognitiven Psychologie für die KI-Forschung
- Die Ausgangsbasis für die Prototypentheorie
- Das klassische Modell
- Die Gliederung der Umwelt in Kategorien
- Das Aristotelische Modell der Kategorisierung – Komponentenanalyse
- Kritik am Aristotelischen Modell
- Wittgensteins Gedanken der „Familienähnlichkeit“ und der offenen Grenzen von Kategorien
- Unscharfe Grenzen von Kategorien
- Grad der Zugehörigkeit zur Kategorie
- Hyponymie und „basic level categories“
- Das Ziel einer einheitlichen Theorie
- Das klassische Modell
- Die Prototypentheorie Eleanor Roschs
- Übernahme der Theorie aus der Psychologie
- Grundzüge der Prototypentheorie
- Die innere und äußere Struktur der Kategorien
- Die Zugehörigkeit zur Kategorie
- Prototypensemantik und Verben
- Was die Prototypensemantik im Bereich der Verben leisten kann
- Die Kategorie „to kill“
- Die Verbkategorie „to cook“
- Schlussfolgerung
- Rivalität zwischen Komponentenanalyse und Prototypensemantik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Modell der Prototypensemantik, welches von der Psychologin Eleanor Rosch in den 1970er Jahren entwickelt wurde. Die Arbeit untersucht, wie dieses Modell menschliches Denken beschreibt und welchen Stellenwert es in der Linguistik im Vergleich zur Komponentenanalyse, die von Aristoteles beeinflusst ist, einnimmt. Die Arbeit befasst sich auch mit der Frage, ob im Bereich der Verben eine prototypische Struktur nachgewiesen werden kann.
- Die Grenzen klassischer Kategorisierungstheorien und die Kritik am Aristotelischen Modell
- Die Prototypentheorie als Alternative zur Komponentenanalyse, basierend auf Wittgensteins Konzept der „Familienähnlichkeit“ und dem Gedanken unscharfer Kategorien
- Die innere Struktur von Kategorien, die auf einem prototypischen Element basieren, und die graduelle Zugehörigkeit von Elementen zur Kategorie
- Die Anwendbarkeit der Prototypensemantik auf Verben und die Untersuchung von Beispielen wie „to kill“ und „to cook“
- Der Vergleich und die gegenseitige Ergänzung von Komponentenanalyse und Prototypensemantik für die Linguistik und die KI-Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel untersucht die Notwendigkeit der Linguistik und der kognitiven Psychologie für die KI-Forschung und stellt die Bedeutung des Verständnisses von „Intelligenz“ für die Entwicklung künstlicher Intelligenz heraus.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Ausgangsbasis für die Prototypentheorie, indem es das klassische Modell der Kategorisierung, die Komponentenanalyse, und deren Kritik beleuchtet. Es stellt Wittgensteins Gedanken der „Familienähnlichkeit“ und der unscharfen Grenzen von Kategorien vor und erklärt das Konzept des „basic level categories“.
Das dritte Kapitel widmet sich der Prototypentheorie Eleanor Roschs, die als Alternative zum klassischen Modell der Kategorisierung angesehen wird. Es erläutert die Übernahme der Theorie aus der Psychologie, die Grundzüge der Prototypentheorie, die innere und äußere Struktur der Kategorien und die Frage der Zugehörigkeit zur Kategorie.
Das vierte Kapitel untersucht die Prototypensemantik im Bereich der Verben und stellt die Kategorie „to kill“ sowie die Kategorie „to cook“ mit ihren prototypischen Strukturen vor.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit umfassen: Prototypentheorie, Eleanor Rosch, Kategorien, Komponentenanalyse, Familienähnlichkeit, unscharfe Grenzen, basic level categories, Hyponymie, Prototypensemantik, Verben, to kill, to cook, KI-Forschung.
- Quote paper
- Tina Puscher (Author), 2001, Die Prototypentheorie Eleanor Roschs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169863