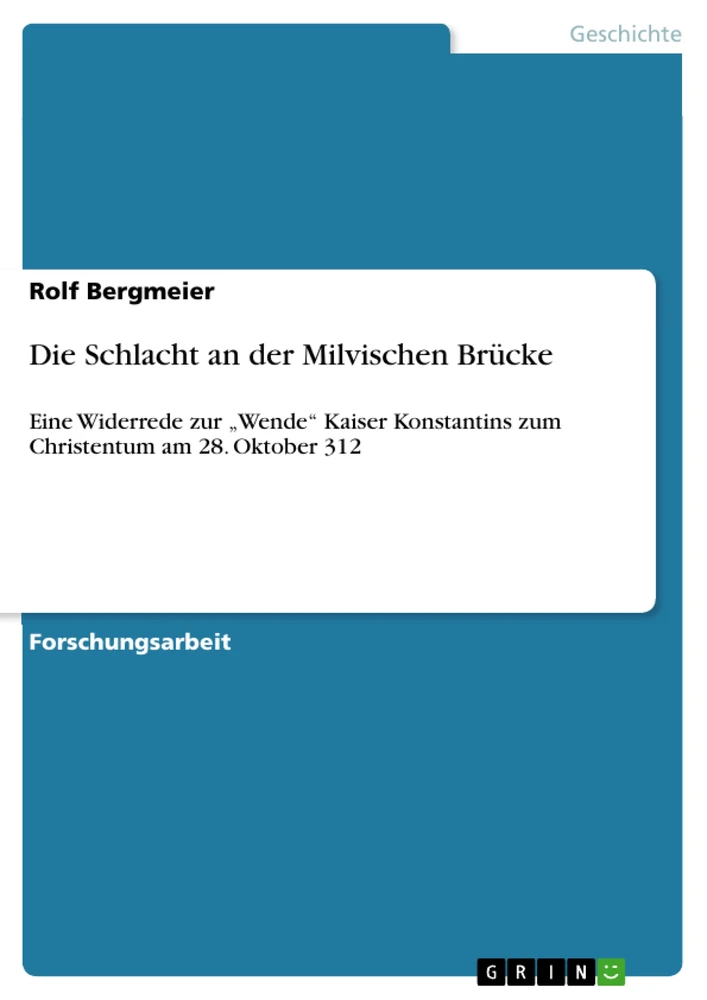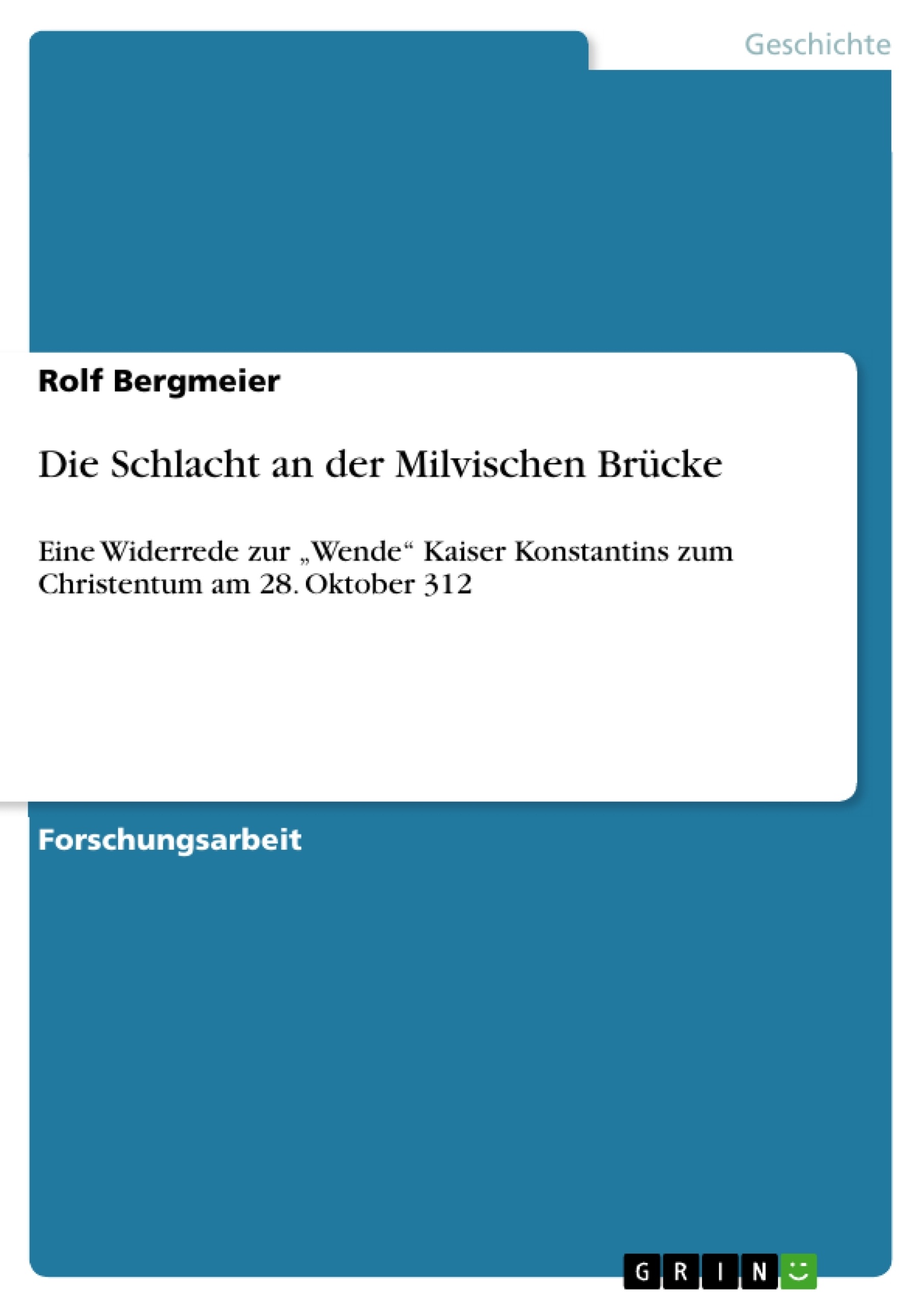Am 28. Oktober 2012 werden die Freunde Konstantins I. die hundertjährige Wiederkehr der Schlacht an der Milvischen Brücke (Rom) feiern. Am Vorabend dieses Tages, respektive in der Nacht vor der Schlacht, soll Konstantin eine Kreuzerscheinung ("in diesem Zeichen siege") gehabt und dadurch erkannt haben, dass sein bisheriger göttlicher Wegbegleiter, der Sonnengott Sol, ihm nicht mehr den Sieg garantieren könne. Und so habe er sich, wie die damaligen christlichen Berichterstatter und eine Anzahl moderner Althistoriker zu berichten wissen, dem christlichen Gott zugewandt.
Das klingt zwar ein wenig merkwürdig, denn immerhin ist der Kaiser bisher unter dem Schutz heidnischer Götter von Sieg zu Sieg geeilt, auch ist der christliche Gott innerhalb der christlichen Gemeinden noch heftig umstritten und daher vermutlich wenig attraktiv, gleichwohl meinen die meisten Althistoriker, Konstantins Bekehrung zum Christentum sei ein "weltgeschichtliches Ereignis" gewesen. Und so feiern sie den Herrscher in regelmäßigen Publikationen und ehrfurchtsvollen Ausstellungen als „ersten christlichen Kaiser“ und auch der Vatikan mag nicht nachstehen und gedenkt seiner in prachtvollen Gemälden im Sala di Constantino des Vatikanischen Palastes.
Aber die „konstantinische Wende“ ist keine. „Christlich“ im Sinne des trinitarischen Christentums war der Kaiser nie, die „konstantinische Wende“ ist eine Legende.
Der folgende Text faßt die Ergebnisse einer vorbereitenden Detailstudie zusammen, die für das umfassende Werk „Kaiser Konstantin und die wilden Jahre des Christentums. Die Legende vom ersten christlichen Kaiser“ benötigt wurde. (ISBN 978 86569 064 7, 350 S., Aschaffenburg 2010. Dort auch detaillierte Quellen- und Literaturnachweise.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- 1 Vor der Schlacht an der Milvischen Brücke
- 2 Träume, Visionen und Symbole vor der großen Schlacht
- 2.1 Laktanz und das Christus-Monogramm
- 2.2 Eusebius und die Kreuzlegende
- 3 Widerrede: Die vergessene Symbolforschung
- 3.1 Das Christogramm zu Beginn des vierten Jahrhunderts
- 3.2 Das Kreuz-Symbol
- 3.3 Ergebnis
- 4 Eine bizarre nächtliche Malerei
- 5 Die Schlacht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die „konstantinische Wende“ und widerlegt die Legende vom ersten christlichen Kaiser. Er analysiert die Quellen und Hintergründe des Ereignisses am 28. Oktober 312, bei dem Kaiser Konstantin I. vor der Schlacht an der Milvischen Brücke eine christliche Offenbarung erlebt haben soll. Die Arbeit beleuchtet die Rolle von Träumen, Visionen und Symbolen in der damaligen Zeit und hinterfragt die Interpretation der historischen Ereignisse im Kontext der christlichen Überlieferung.
- Die Rolle von Träumen und Visionen in der Antike
- Die Entwicklung und Bedeutung des Christus-Monogramms
- Die Interpretation von Quellen und ihre historische Zuverlässigkeit
- Die „konstantinische Wende“ im Kontext der römischen Religionsgeschichte
- Die Bedeutung von Symbolen und Zeichen in der Antike
Zusammenfassung der Kapitel
Die Vorbemerkung gibt einen kurzen Überblick über die Thematik des Werkes und stellt die These der Legende vom ersten christlichen Kaiser in Frage. Das erste Kapitel beleuchtet die Situation vor der Schlacht an der Milvischen Brücke und beschreibt Konstantins militärische Strategie sowie die Lage seines Gegners Maxentius. Im zweiten Kapitel werden die Träume und Visionen, die Konstantin vor der Schlacht gehabt haben soll, analysiert. Insbesondere wird das Christus-Monogramm behandelt, das Konstantin in einem Traum gezeigt worden sein soll. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Symbolforschung und hinterfragt die verbreitete Interpretation des Christogramms als eindeutiges Symbol des Christentums. Es werden alternative Deutungen des Zeichens und seine Verwendung im römischen Kontext untersucht.
Schlüsselwörter
Kaiser Konstantin I., Milvische Brücke, „konstantinische Wende“, Christentum, Traum, Vision, Symbol, Christogramm, Kreuz, römische Religion, Quellenkritik, Symbolforschung
- Quote paper
- Rolf Bergmeier (Author), 2011, Die Schlacht an der Milvischen Brücke, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169813