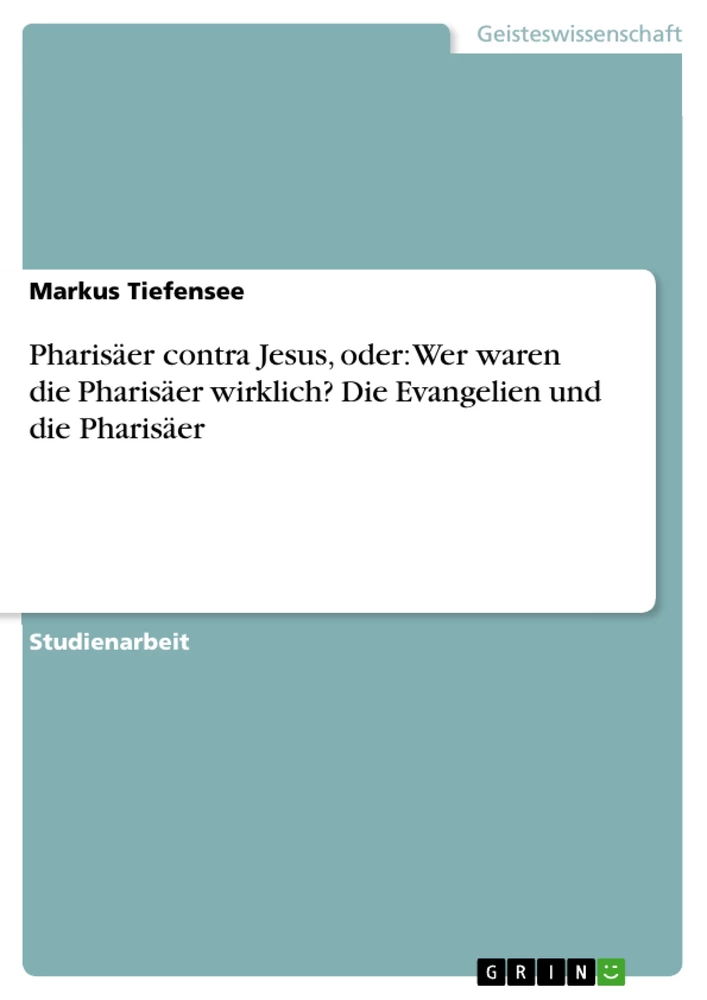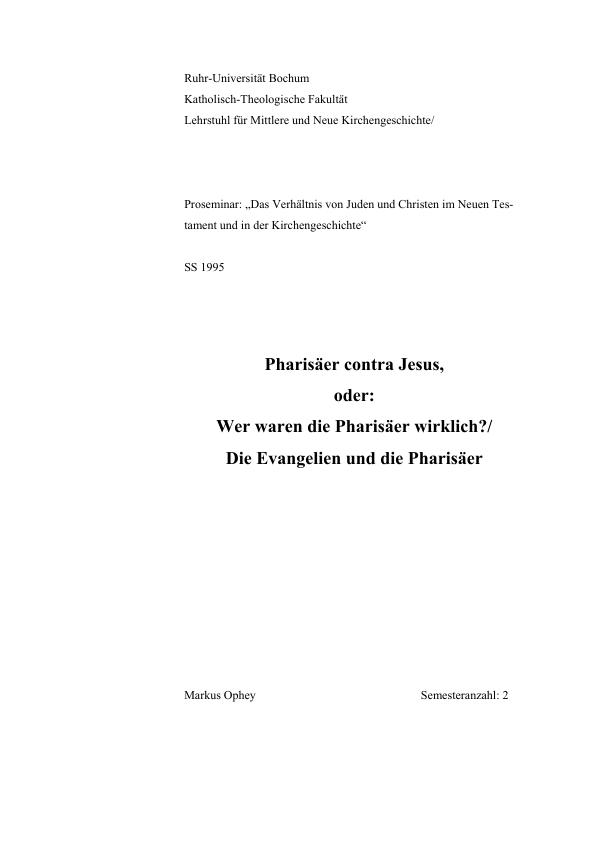Im heutigen Kanon des Neuen Testaments befinden sich vier Evangelien. Ihre Überschriften lauten seit dem 2. Jahrhundert: Das Evangelium nach Matthäus, nach Markus, nach Lukas und nach Johannes. Obwohl das Matthäusevangelium an erster Stelle steht, ist das Markusevangelium das älteste. Die frühe Kirche ordnete diese vier Bücher wahrscheinlich nach der damals angenommenen Abfassungszeit. Die Evangelien sind sogenannte Sammelwerke. Ihre Autoren, die Evangelisten, sammelten ursprünglich einzeln weitergegebene Überlieferungsstücke über Worte und Taten Jesu und fügten sie durch redaktionelle Überleitungen zu einem Ganzen zusammen. Das Wort "Evangelium" stammt aus dem Griechischen ("euangelion") und bedeutet "gute Nachricht", "frohe Botschaft". Mit diesem Wort bezeichneten die Christen ihre Verkündigung von dem endgültigem Heil, das Gott durch Jesus Christus allen Menschen anbietet. Die ersten drei Evangelien liegen untereinander nach Inhalt, Aufbau und Sprache eng beieinander und werden deshalb "synoptische" Evangelien (von griechisch: synopsis, Zusammenschau) genannt. Alle vier erzählen von Jesus und somit auch von den Leuten, mit denen er zu tun hatte. Doch hatte er nicht nur Anhänger, sondern auch Gegner, nämlich politische, priesterliche und religiöse. Zu den ersteren gehörten die Ältesten und die Herodianer, die priesterlichen waren der Hohepriester, die Oberpriester und die Sadduzäer. Seine religiösen Gegner waren die Schriftgelehrten und die schließlich auch die Pharisäer. Dabei müßten diese von der Häufigkeit der Nennungen die Hauptgegner Jesus und seiner Jüngerschaft gewesen sein.1 Doch wer waren die Pharisäer? Sie waren abgesonderte, fromme Juden, die seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. gegen die Sadduzäer Partei ergriffen. Doch sie bildeten im Gegensatz zu diesen keine Elite, sondern waren dem Volk und dessen mündlichen Glaubenstraditionen ebenso verbunden wie der schriftlichen Überlieferung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Markusevangelium
- Einführung
- Darstellung der Pharisäer
- Das Matthäusevangelium
- Einführung
- Darstellung der Pharisäer
- Das Lukasevangelium
- Einführung
- Darstellung der Pharisäer
- Die Pharisäer in der Apostelgeschichte
- Das Johannesevangelium
- Einführung
- Darstellung der Pharisäer
- Folgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der Pharisäer in den vier Evangelien des Neuen Testaments. Ziel ist es, die jeweiligen Perspektiven der Evangelisten auf die Pharisäer zu analysieren und deren unterschiedliche Darstellungen zu vergleichen. Die Arbeit beleuchtet auch den historischen Kontext und die möglichen Gründe für die unterschiedlichen Bilder der Pharisäer in den Evangelien.
- Die Darstellung der Pharisäer im Markusevangelium
- Die Darstellung der Pharisäer im Matthäusevangelium
- Die Darstellung der Pharisäer im Lukasevangelium
- Die Darstellung der Pharisäer im Johannesevangelium
- Der historische Kontext und die theologischen Implikationen der verschiedenen Darstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert den Kontext der Untersuchung. Sie beschreibt die vier Evangelien als Sammelwerke, die verschiedene Überlieferungen über Jesus und seine Begegnungen mit verschiedenen Gruppen, darunter die Pharisäer, zusammenfassen. Die Einleitung hebt die Bedeutung der Pharisäer als Hauptgegner Jesu hervor und stellt die Frage nach ihrer wahren Identität in den Mittelpunkt der Analyse.
Das Markusevangelium: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung der Pharisäer im Markusevangelium, dem ältesten Evangelium. Es beschreibt Markus als Dolmetscher des Petrus und untersucht die Zielgruppe und den Kontext des Evangeliums. Die Analyse konzentriert sich auf die zwölf Nennungen der Pharisäer und ihre Rolle als Gesetzesausleger im Konflikt mit Jesus. Das Kapitel diskutiert die Frage, ob Markus historische Genauigkeit anstrebte oder eher eine schematische negative Darstellung der Pharisäer als Kontrast zu Jesus präsentierte.
Das Matthäusevangelium: Dieses Kapitel befasst sich mit der Darstellung der Pharisäer im Matthäusevangelium, das die Pharisäer dreissigmal erwähnt, häufiger als in allen anderen Schriften des Neuen Testaments. Es beleuchtet die Frage nach der Authentizität der Zuschreibung an Matthäus und untersucht den Kontext der Gemeinde, für die das Evangelium geschrieben wurde. Die Analyse konzentriert sich auf die Art und Weise, wie Matthäus die Pharisäer als ständige und zentrale Gegner Jesu präsentiert und die Verbindungen zu den Sadduzäern darstellt. Das Kapitel analysiert Matthäus' Darstellung als feindseliges Feindbild innerhalb des christlichen Kontextes.
Das Lukasevangelium: Dieses Kapitel untersucht die Darstellung der Pharisäer im Lukasevangelium, welches ein differenzierteres Bild der Pharisäer zeichnet als Markus und Matthäus. Es hebt Lukes positive Darstellung der Pharisäer in der Apostelgeschichte hervor und kontrastiert dies mit den weniger negativen Schilderungen im Evangelium. Die Analyse fokussiert auf die Gastfreundschaft, die Jesus bei Pharisäern erfährt, und die komplexeren Beziehungen zwischen Jesus und den Pharisäern in Lukes Darstellung. Das Kapitel diskutiert die mögliche theologische Bedeutung dieser differenzierten Darstellung.
Das Johannesevangelium: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung der Pharisäer im Johannesevangelium, in welchem "die Juden" pauschal als Gegner Jesu dargestellt werden, wobei die Pharisäer eine entscheidende Rolle spielen. Es untersucht die unterschiedlichen Rollen der Pharisäer, von der Gesandtschaft zu Johannes dem Täufer bis hin zu ihrer Rolle bei der Verhaftung Jesu. Das Kapitel diskutiert die Funktion der Pharisäer als Chiffre für jüdische Kräfte im Kontext der christlichen Missionsarbeit. Die Analyse verdeutlicht die stark schematisierte Darstellung der Pharisäer als globale Repräsentanten des Judentums im Konflikt mit dem Christentum.
Schlüsselwörter
Pharisäer, Evangelien, Neues Testament, Judentum, Christentum, Gesetzesauslegung, Konflikt, Reich Gottes, Heuchelei, Apostelgeschichte, Synoptische Evangelien, Johannesevangelium, Heidenmission, Judenchristentum, Historischer Kontext, Theologische Interpretation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Darstellung der Pharisäer in den Evangelien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung der Pharisäer in den vier Evangelien des Neuen Testaments (Markus, Matthäus, Lukas und Johannes). Sie untersucht die jeweiligen Perspektiven der Evangelisten und vergleicht deren unterschiedliche Schilderungen der Pharisäer. Der historische Kontext und die Gründe für die unterschiedlichen Darstellungen werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung der Pharisäer in jedem der vier Evangelien einzeln. Sie untersucht die Häufigkeit ihrer Erwähnung, ihre Rolle im Konflikt mit Jesus, und die Art und Weise, wie sie von den jeweiligen Evangelisten charakterisiert werden. Zusätzlich wird der historische Kontext und die theologischen Implikationen der verschiedenen Darstellungen analysiert. Die Beziehungen zu anderen Gruppen wie den Sadduzäern werden ebenfalls betrachtet.
Wie werden die Pharisäer im Markusevangelium dargestellt?
Das Markusevangelium erwähnt die Pharisäer etwa zwölf Mal. Die Analyse konzentriert sich auf ihre Rolle als Gesetzesausleger im Konflikt mit Jesus. Die Arbeit untersucht, ob Markus eine historisch genaue Darstellung anstrebte oder eher eine schematische, negative Darstellung der Pharisäer als Kontrast zu Jesus präsentierte.
Wie werden die Pharisäer im Matthäusevangelium dargestellt?
Im Matthäusevangelium werden die Pharisäer etwa dreissigmal erwähnt, häufiger als in allen anderen Schriften des Neuen Testaments. Die Analyse untersucht, wie Matthäus die Pharisäer als ständige und zentrale Gegner Jesu präsentiert und die Verbindungen zu den Sadduzäern darstellt. Die Arbeit analysiert Matthäus' Darstellung als feindseliges Feindbild im christlichen Kontext.
Wie werden die Pharisäer im Lukasevangelium dargestellt?
Das Lukasevangelium zeichnet ein differenzierteres Bild der Pharisäer als Markus und Matthäus. Die Arbeit hebt Lukes positive Darstellung der Pharisäer in der Apostelgeschichte hervor und kontrastiert dies mit den weniger negativen Schilderungen im Evangelium. Der Fokus liegt auf der Gastfreundschaft, die Jesus bei Pharisäern erfährt, und den komplexeren Beziehungen zwischen Jesus und den Pharisäern in Lukes Darstellung.
Wie werden die Pharisäer im Johannesevangelium dargestellt?
Im Johannesevangelium werden "die Juden" pauschal als Gegner Jesu dargestellt, wobei die Pharisäer eine entscheidende Rolle spielen. Die Analyse untersucht die unterschiedlichen Rollen der Pharisäer, von der Gesandtschaft zu Johannes dem Täufer bis hin zu ihrer Rolle bei der Verhaftung Jesu. Die Arbeit diskutiert die Funktion der Pharisäer als Chiffre für jüdische Kräfte im Kontext der christlichen Missionsarbeit und ihre stark schematisierte Darstellung als globale Repräsentanten des Judentums im Konflikt mit dem Christentum.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen aus dem Vergleich der vier Evangelien und analysiert die verschiedenen Perspektiven und Darstellungen der Pharisäer. Die Ergebnisse beleuchten die komplexen Beziehungen zwischen Judentum und Christentum und die Herausbildung des christlichen Selbstverständnisses im Kontext des Konflikts mit dem Judentum.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Pharisäer, Evangelien, Neues Testament, Judentum, Christentum, Gesetzesauslegung, Konflikt, Reich Gottes, Heuchelei, Apostelgeschichte, Synoptische Evangelien, Johannesevangelium, Heidenmission, Judenchristentum, Historischer Kontext, Theologische Interpretation.
- Citar trabajo
- Markus Tiefensee (Autor), 1995, Pharisäer contra Jesus, oder: Wer waren die Pharisäer wirklich? Die Evangelien und die Pharisäer, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16971