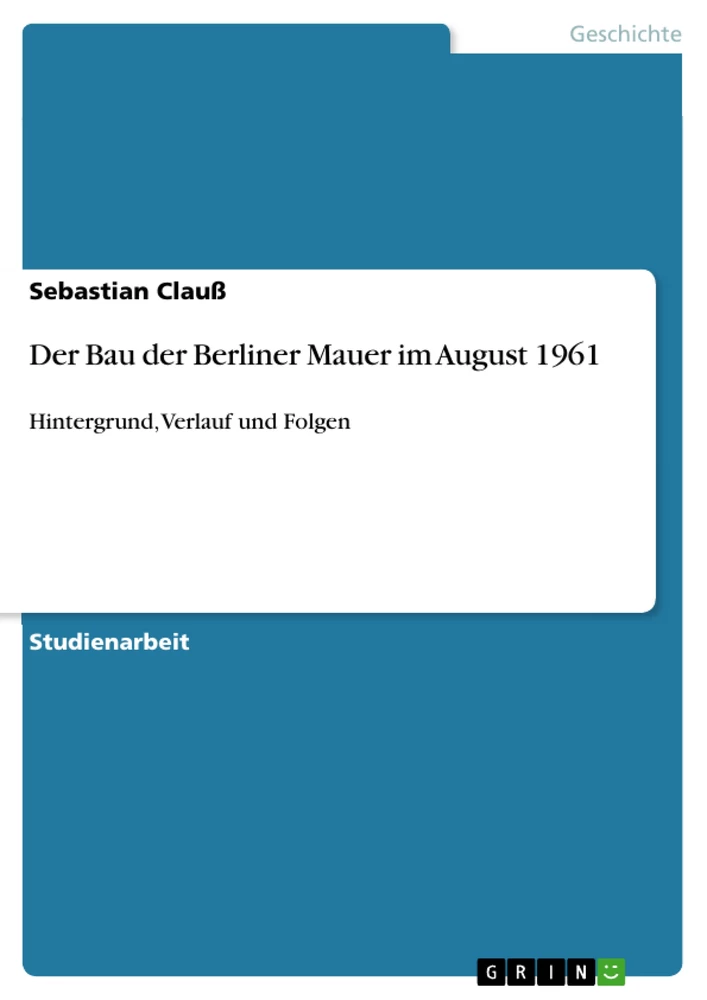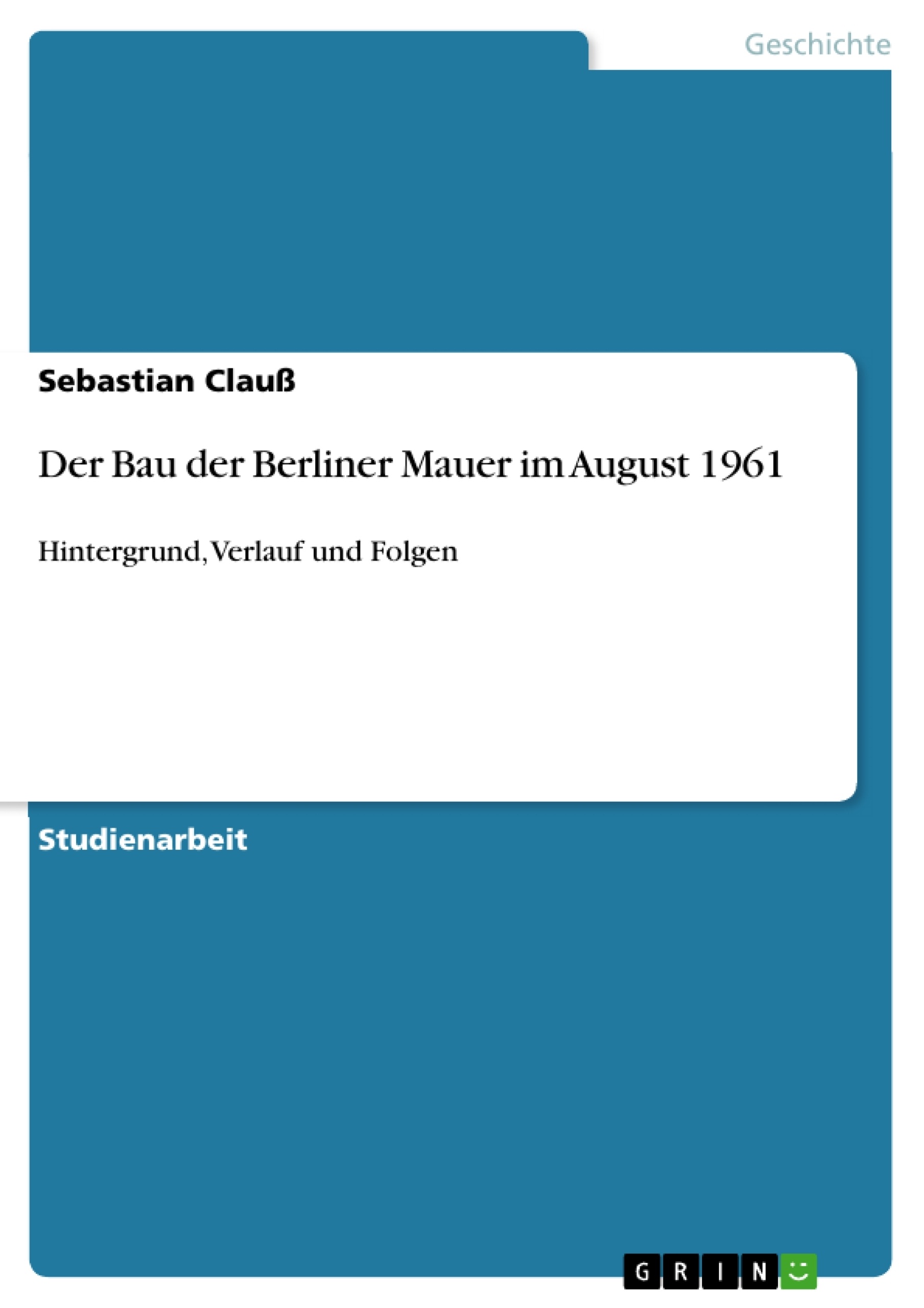I. Einleitung
Die deutsche Frage, die seit dem 19. Jahrhundert auf die politische Gestalt Deutschlands vor allem im Rahmen der anderen europäischen Staaten abzielt, wird von Historikern häufig in eingeengter Bedeutung auf die Entwicklung der beiden Staaten auf deutschem Boden nach Ende des zweiten Weltkriegs bezogen. Sie umfasst sowohl die kontroversen politischen Systeme der Bundesrepublik Deutschland auf der einen und der Deutschen Demokratischen Republik auf der anderen Seite, als auch die Hintergründe und Maßnahmen, die zur Teilung Deutschlands und schließlich zur Wiedervereinigung 1989/90 führten.
Nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg 1945 erfuhr Deutschland eine Aufteilung. Wurden zunächst vier Besatzungszonen der Siegermächte eingerichtet, so entstanden 1949 daraus die beiden getrennten Staaten Bundesrepublik und DDR. Beide Staaten entwickel-ten sich immer weiter auseinander, sodass sie über 40 Jahre lang unvereinbar nebeneinander existierten. Hinzu kam, dass sich beide Staaten an der Frontlinie der von den beiden Supermächten USA und UdSSR angeführten feindlichen Blöcke gegenüberstanden. Erst durch die Lockerung der Blockstrukturen in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts und einer Annäherungen der beiden deutschen Staaten, aber auch durch innere Probleme der Ostblockstaaten und speziell der DDR wurde schließlich eine Wiedervereinigung 1989/90 möglich.
Die Errichtung der Berliner Mauer 1961 schuf im Rahmen dieser Entwicklung neue Verhältnisse , die in verschiedene Dimensionen einzuordnen sind. So bedeutet der Mauerbau das Eingeständnis des Versagens des SED-Systems , aber auch die Herstellung einer gewissen Normalität in der Mitte Europas. Andere Autoren betonen in diesem Zusammen-hang die symbolische Bedeutung der Mauer für die Zementierung der deutschen Teilung und die Zerstrittenheit der beiden Blöcke in Europa nach 1945. Wenn man jedoch eher im Rahmen der Gesamtentwicklung von 1961 bis 1989 nach der Rolle des Mauerbaus sucht, so stellt sich die Frage, ob sie lediglich als ein kurzfristig geschickt genutztes Werkzeug der Ulbricht-Regierung zu sehen ist, um die politische Führung der DDR und den Staat selber zu stabilisieren, oder doch längerfristig als Anfang vom Ende der sozialistischen SED-Herrschaft.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Ursachen des Mauerbaus
- 1. Die kontroverse Deutschlandpolitik der beiden deutschen Staaten vor 1961
- 2. Die Entwicklung der DDR in den 50er Jahren
- III. Der Mauerbau vom 13. August 1961 und seine unmittelbaren Folgen
- IV. Vom Mauerbau zur Wiedervereinigung Deutschlands
- 1. Entwicklung des Verhältnisses zwischen BRD und DDR bis 1989
- 2. Von der Stabilisierung der DDR nach 1961 bis zur Krise und dem Zerfall des SED-Regimes Ende der 80er Jahre
- V. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Errichtung der Berliner Mauer im August 1961, beleuchtet die Ursachen, den Verlauf und die Folgen dieses Ereignisses. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der deutsch-deutschen Beziehungen und der inneren Entwicklung der DDR vor und nach dem Mauerbau. Die Arbeit analysiert, inwieweit der Mauerbau ein kurzfristiges Werkzeug zur Stabilisierung des SED-Regimes oder der Beginn des Endes der sozialistischen Herrschaft war.
- Die kontroverse Deutschlandpolitik der beiden deutschen Staaten vor 1961
- Die innere Entwicklung der DDR in den 50er Jahren
- Der Mauerbau als Ausdruck des Scheiterns des SED-Systems
- Die Entwicklung des Verhältnisses zwischen BRD und DDR nach dem Mauerbau
- Der Mauerbau als Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Teilung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die "deutsche Frage" im Kontext der Nachkriegsentwicklung dar und betont die kontroversen politischen Systeme der BRD und DDR. Sie skizziert die Entwicklung von der Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Wiedervereinigung 1989/90 und positioniert den Mauerbau als ein Schlüsselereignis in diesem Prozess. Die Autorin/der Autor kündigt die Gliederung der Arbeit an, die sich auf die Vor- und Nachgeschichte des Mauerbaus konzentriert und die innerstaatliche Entwicklung der DDR im Fokus hat, wobei internationale Einflüsse berücksichtigt werden.
II. Ursachen des Mauerbaus: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen des Mauerbaus, wobei die kontroverse Deutschlandpolitik beider Staaten vor 1961 im Mittelpunkt steht. Es werden die divergierenden politischen und ideologischen Interessen der Westalliierten und der Sowjetunion beleuchtet, die zu einer zunehmenden Entfremdung und schließlich zum Kalten Krieg führten. Das Kapitel beschreibt auch die Versuche beider deutscher Staaten, die Legitimität des jeweils anderen Staates zu bestreiten und die begrenzten Handlungsspielräume der DDR unter der Kontrolle der UdSSR. Die anfänglichen Ziele der DDR, ein sozialistisches geeintes Deutschland zu schaffen, wurden durch diese Umstände zunichte gemacht.
Schlüsselwörter
Berliner Mauer, Deutschlandpolitik, DDR, BRD, Kalter Krieg, SED, Wiedervereinigung, deutsche Teilung, sozialistisches System, internationale Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Der Mauerbau - Ursachen, Verlauf und Folgen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht den Mauerbau in Berlin im August 1961. Sie beleuchtet die Ursachen, den Verlauf und die Folgen dieses historischen Ereignisses. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der deutsch-deutschen Beziehungen und der inneren Entwicklung der DDR vor und nach dem Mauerbau. Analysiert wird, ob der Mauerbau ein kurzfristiges Stabilisierungswerkzeug des SED-Regimes oder der Beginn seines Endes war.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die kontroverse Deutschlandpolitik der beiden deutschen Staaten vor 1961; die innere Entwicklung der DDR in den 50er Jahren; den Mauerbau als Ausdruck des Scheiterns des SED-Systems; die Entwicklung des Verhältnisses zwischen BRD und DDR nach dem Mauerbau; und den Mauerbau als Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Teilung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Ursachen des Mauerbaus, Der Mauerbau vom 13. August 1961 und seine unmittelbaren Folgen, Vom Mauerbau zur Wiedervereinigung Deutschlands, und Schluss. Jedes Kapitel befasst sich mit spezifischen Aspekten des Mauerbaus und seiner historischen Einbettung.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt die "deutsche Frage" im Kontext der Nachkriegsentwicklung dar und hebt die unterschiedlichen politischen Systeme der BRD und DDR hervor. Sie skizziert die Entwicklung von der Teilung Deutschlands bis zur Wiedervereinigung und positioniert den Mauerbau als Schlüsselereignis. Die Gliederung der Arbeit wird vorgestellt, wobei der Fokus auf der Vor- und Nachgeschichte des Mauerbaus sowie der innerstaatlichen Entwicklung der DDR liegt.
Wie werden die Ursachen des Mauerbaus analysiert?
Das Kapitel "Ursachen des Mauerbaus" analysiert die kontroverse Deutschlandpolitik beider Staaten vor 1961. Es beleuchtet die divergierenden politischen und ideologischen Interessen der Westalliierten und der Sowjetunion, die zum Kalten Krieg führten. Die Versuche beider deutscher Staaten, die Legitimität des jeweils anderen zu bestreiten, und die begrenzten Handlungsspielräume der DDR unter sowjetischer Kontrolle werden beschrieben. Die anfänglichen Ziele der DDR, ein sozialistisches geeintes Deutschland zu schaffen, werden im Kontext dieser Umstände betrachtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Berliner Mauer, Deutschlandpolitik, DDR, BRD, Kalter Krieg, SED, Wiedervereinigung, deutsche Teilung, sozialistisches System, internationale Beziehungen.
- Quote paper
- Sebastian Clauß (Author), 2006, Der Bau der Berliner Mauer im August 1961, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169584