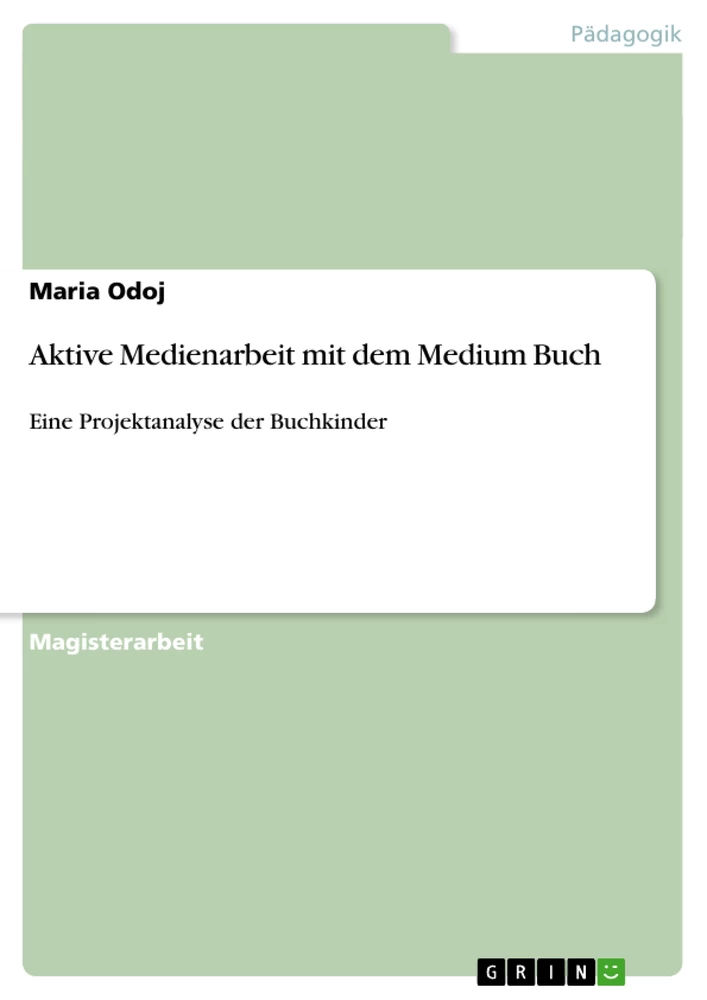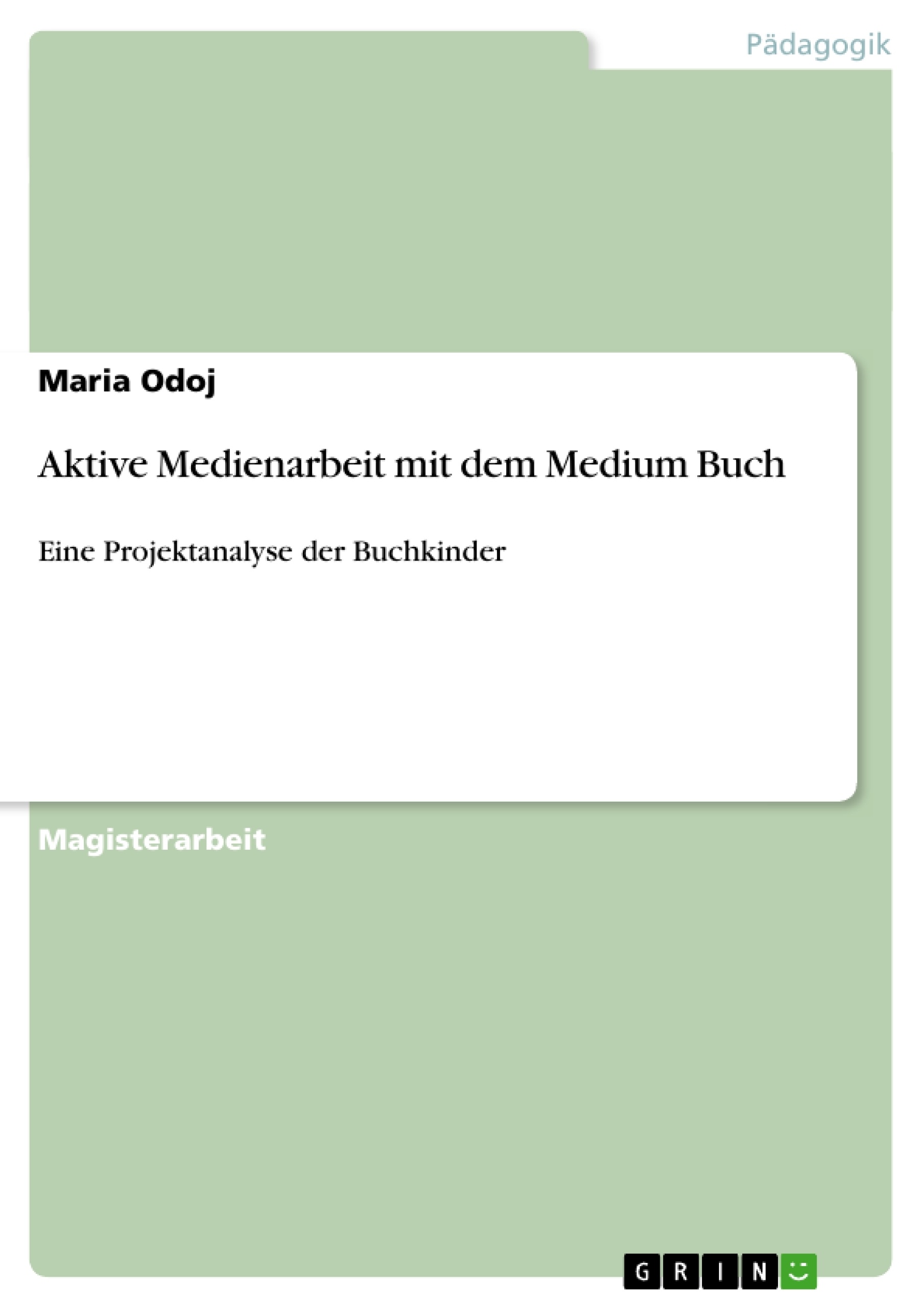„Das Buch ist (auch) ein Medium“, wirbt 2009 die Fakultät für Buchwissenschaft der Universität Nürnberg/Erlangen für ihren Studiengang. Spricht man von Medien, so meint man tatsächlich meist die elektronischen. Auch Kinder nutzen das breite Angebot der elektronischen Medien.1 Fernsehen und Computer sind bei ihnen besonders beliebt. Doch was ist mit dem ältesten Kindermedium: dem Buch? Für über 50% Prozent gehört es noch dazu, auch neben der Schule zu lesen. Auch wenn insgesamt die Nutzung der elektronischen Medien angestiegen ist, so ist die Buchnutzung seit den 50er Jahren stabil geblieben.2 Bücher bestehen neben den neuen Medien und bleiben beliebt. Zudem vermittelt die Rezeption mit dem verstaubten Medium Schlüsselqualifikationen, welche für die aktive Teilnahme an der heutigen Lebenswelt unerlässlich sind. Zweifellos ist die Lesekompetenz die entscheidende Qualifikation für den Umgang mit fast allen Medien. Die Fähigkeit, komplizierte Informationen zu lesen und zu verstehen ist für den Erfolg in der Ausbildung, am Arbeitsplatz und im Alltagsleben unverzichtbar, ebenso der Umgang mit Büchern. In medienpädagogischen Projekten liegt der Schwerpunkt jedoch deutlich auf dem Erlernen eines kompetenten Umgangs mit den neuen oder elektronischen Medien. Dies wird auch von politischer Seite erkannt und unterstützt. Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation für die Informations- und Kommunikationsgesellschaft soll vor allem über die neuen Medien bezogen werden. Die Medienarbeit mit dem Buch ist rückläufig, schon aus dem Grund, dass die Forderung nach Medienpädagogik meist erst mit einem öffentlichen Aufbegehren gegen potenzielle Mediengefahren wach wird. Und diese verkörpern momentan die elektronischen Medien. Das Buch wird zum vernachlässigten Medium.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1 Ausgangslage und Problembeschreibung
- 1.2 Ziel der wissenschaftlichen Untersuchung
- 1.3 Fragestellung und Thesen
- 1.4 Gliederung der Arbeit
- 2. MEDIENKINDHEIT
- 2.1 Medienausstattung und -nutzung der Kinder
- 2.2 Kontextuelle Verständnis der Medienaneignung
- 2.3 Definition von Kindermedien
- 2.4 Der Kindermedienmarkt
- 3. MEDIENKOMPETENZ
- 3.1 Kindliche Medienkompetenzen
- 3.2 Die Forderung nach Medienkompetenz
- 3.3 Handlungsorientierte Medienpädagogik
- 4. AKTIVE MEDIENARBEIT
- 4.1 Mündigkeit und Emanzipation
- 4.2 Adressaten- und Lebensweltorientierung
- 4.3 Kommunikative Kompetenz
- 4.4 Handlungskompetenz
- 4.5 Handelndes Lernen
- 4.5.1 Interaktives Lernen
- 4.5.2 Lernen als Prozessuale Emanzipation
- 4.5.3 Gruppenarbeit
- 4.5.4 Exemplarisch Lernen
- 4.5.5 Lernen in authentischer Erfahrung
- 4.6 Ziele und Grenzen der Aktiven Medienarbeit
- 4.7 Aktive Medienarbeit ohne „alte\" Medien
- 5. BUCH PROBLEMLAGE UND FORSCHUNGSINTERESSE
- 5.1 Ein altes Medium mit modernem Gesicht
- 5.2 Der Wandel des Buches
- 5.3 Die Stellung des Buches
- 5.4 Lesehäufigkeit von Kindern
- 5.5 Lesekompetenz in Deutschland
- 5.6 Perspektiven der Leseförderung
- 5.7 Buch- Ein vertrauenserweckendes Medium?
- 5.8 Buch- Ein vernachlässigtes Medium?
- 5.9 Buchprojekte
- 6. KONZEPT UND DURCHFÜHRUNG DER WISS. UNTERSUCHUNG
- 6.1 Auswahl des Forschungsgegenstandes
- 6.2 Eine qualitative Studie
- 6.3 Triangulation
- 6.4 Literatur- und Produktanalyse
- 6.5 Teilnehmende Beobachtung
- 6.5.1 Beobachtungsprotokoll
- 6.5.2 Beobachtung anderer Bereiche der Buchkinderarbeit
- 6.6 Interview
- 6.6.1 Experteninterview
- 6.6.2 Mitarbeiterinterviews
- 6.6.3 Interviews mit Buchkindern
- 7. DARSTELLUNG DES PROJEKTES
- 7.1 Entstehung der Buchkinder
- 7.2 Struktur und Aufbau
- 7.3 Finanzierung
- 7.4 Mitarbeiter
- 7.5 Zielgruppe
- 7.6 Die Buchkinderbücher
- 7.7 Die Werkstatt Grafische Höfe
- 7.8 Kursablauf Grafische Höfe
- 7.9 Die Werkstatt Lindenau
- 7.10 Kursablauf Lindenau
- 7.11 Lesungen
- 7.12 Ausgangspunkt: Freinet-Pädagogik
- 7.13 Ablauf einer Buchentstehung
- 7.14 Die vier Buchkinderregeln
- 7.15 Theorie vs. Praxis
- 8. AUSWERTUNG
- 8.1 Zur Vorgehensweise der Auswertung
- 8.1.1 Das Kategoriensystem
- 8.1.2 Auswahl und Charakterisierung des Materials
- 8.2 Adressatenorientierung
- 8.2.1 Zielgruppenkenntnisse
- 8.2.2 Konzept und Arbeitsmethoden
- 8.3 Lebensweltorientierung
- 8.3.1 Themen der Kinder
- 8.3.2 Einbezug der Lebenswelt in die Arbeitsmethode
- 8.4 Medienkompetenz
- 8.4.1 Medienwissen
- 8.4.1.1 Funktionswissen
- 8.4.1.2 Strukturwissen
- 8.4.1.3 Orientierungswissen
- 8.4.1.4 Zusammenfassung Medienwissen
- 8.4.2 Medienanalyse und Medienkritik
- 8.4.3 Medienhandeln
- 8.5 Weitere emanzipierende Kompetenzen
- 8.5.1 Selbstbewusstsein fördern
- 8.5.2 Kommunikative Kompetenz
- 8.5.2.1 Schreiben
- 8.5.2.2 Lesen
- 8.5.2.3 Ausdruck fördern
- 8.5.2.4 Kritik geben und nehmen lernen
- 8.5.3 Handlungskompetenz
- 8.6 Handelndes Lernen
- 8.6.1 Interaktives Lernen
- 8.6.2 Lernen als prozessuale Emanzipation
- 8.6.3 Gruppenarbeit
- 8.6.4 Exemplarisches Lernen
- 8.6.5 Zusammenfassung Handelndes Lernen
- 8.7 Lernen in authentischer Erfahrung
- 8.7.1 Die Erprobung in der Erwachsenenwelt
- 8.7.2 Medienproduzent sein
- 8.7.3 Kritisch seine Weltsicht äussern
- 8.7.4 Reichweite des Projektes
- 8.7.5 Grenzen des Projektes
- Adressatenorientierung und Lebensweltorientierung in der aktiven Medienarbeit
- Entwicklung von Medienkompetenz und Handlungskompetenz bei Kindern
- Die Rolle des Buches als Medium in der digitalen Welt
- Der Einfluss von Freinet-Pädagogik auf die aktive Medienarbeit mit dem Buch
- Bewertung der Wirksamkeit und der Grenzen des Buchkinder-Projekts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit analysiert das Projekt „Buchkinder" mit dem Ziel, die aktive Medienarbeit mit dem Medium Buch in der Praxis zu untersuchen. Dabei wird der Fokus auf die Förderung von Medienkompetenz bei Kindern gelegt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Ausgangslage und die Problematik der aktiven Medienarbeit mit dem Buch beschreibt. Anschließend werden die Konzepte der Medienkindheit und der Medienkompetenz vorgestellt. Im vierten Kapitel wird die aktive Medienarbeit mit ihren Zielen und Grenzen erläutert. Das fünfte Kapitel widmet sich der Problemlage und dem Forschungsinteresse des Buches als Medium. Das sechste Kapitel beschreibt das Konzept und die Durchführung der wissenschaftlichen Untersuchung. Im siebten Kapitel wird das Buchkinder-Projekt vorgestellt. Das achte Kapitel analysiert die Ergebnisse der Untersuchung, wobei die Schwerpunkte auf Adressatenorientierung, Lebensweltorientierung, Medienkompetenz und weiteren emanzipierenden Kompetenzen liegen. Das neunte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und zieht ein Fazit. Das zehnte Kapitel beinhaltet eine Forschungsevaluation und einen Ausblick.
Schlüsselwörter
Aktive Medienarbeit, Buchkinder, Medienkompetenz, Adressatenorientierung, Lebensweltorientierung, Handlungskompetenz, Freinet-Pädagogik, Kinderliteratur, Mediennutzung, Lesekompetenz, Medienpädagogik.
- Quote paper
- Maria Odoj (Author), 2010, Aktive Medienarbeit mit dem Medium Buch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169577