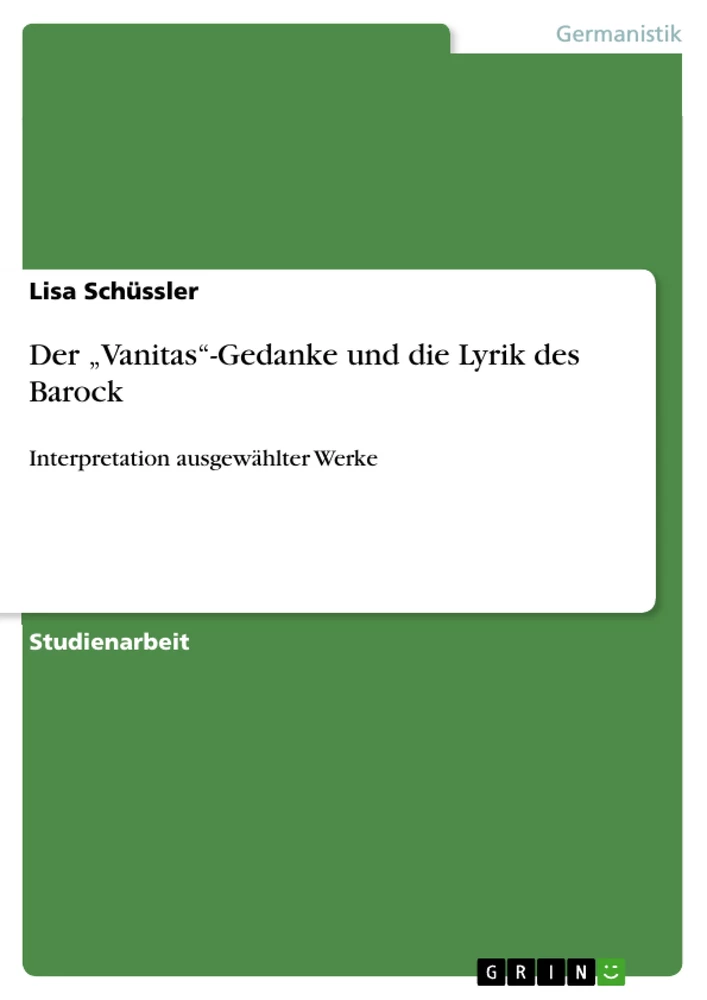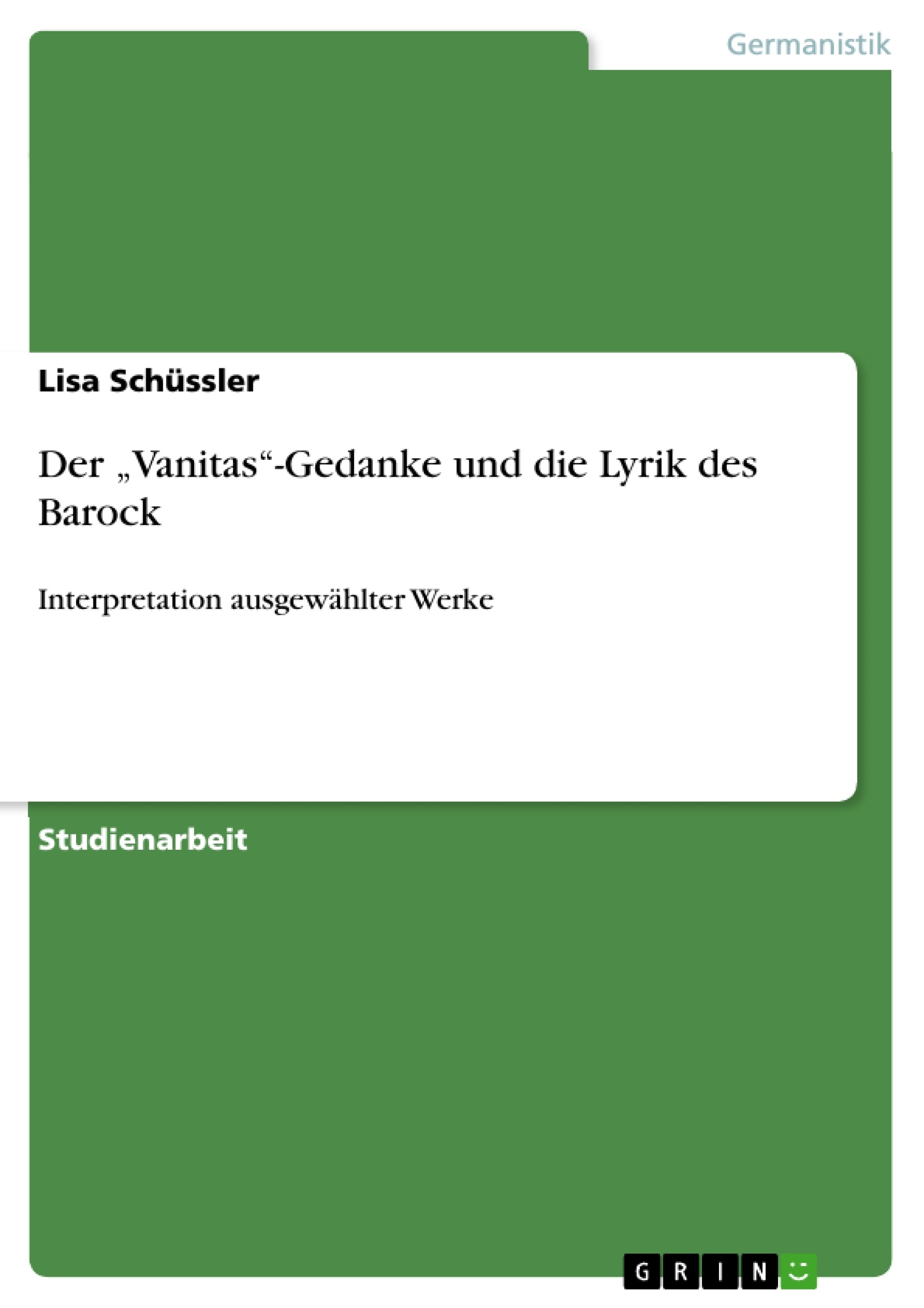Die folgende Untersuchung der „Vanitas“ und des „Memento mori“ in der Lyrik des Barockzeitalters soll Aufschluss geben, welche bedeutende Rolle beide Begriffe in der Epoche von 1600 bis 1720 gespielt haben.
Meine Analyse soll die Zerrissenheit der Menschen und deren pessimistische Grundeinstellung aufzeigen.
Anhand der ausgewählten Gedichte möchte ich die Lebensauffassung berühmter Lyriker des Barock verdeutlichen und darstellen, welche Gedanken das Leben von Andreas Gryphius oder Martin Opitz beeinflusst und geprägt haben. Die Lyrik des Barock ist von großer Tiefe und sprachlicher Schönheit, was im Laufe dieser Hausarbeit anhand von Beispielen aufgezeigt werden soll. Dichter dieser Epoche stammten hauptsächlich aus gelehrten, bürgerlichen Kreisen und sprachen Leser desselben Niveaus an. Lyrikervereinigungen, wie die Fruchtbringende Gesellschaft widmeten sich der „Pflege der dt. Sprache“ , darunter auch die Gesellschaft, der Gryphius später angehören sollte.
In Deutschland hatten sich die Gegensätze seit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 verschärft. Die katholische Kirche hatte für den alten Glauben große Gebiete zurückgewonnen, neben den Lutheranern gab es auch reformierte Gemeinden. Es herrschte enorme Spannung zwischen den einzelnen Religionsparteien und der eigentlich unbedeutende Zwischenfall des „Prager Fenstersturz“ löste den Dreißigjährigen Krieg auf deutschem Boden aus. Zunächst ein Religionskrieg, wurde er allmählich zu einem Machtkampf zwischen Kaiser und Fürsten. Da Lyriker wie Opitz und Gryphius in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges aufgewachsen waren, war ihnen strenge Ordnung ihrer Werke oberstes Gebot. Dies spiegelt sich vor allem in ihren Gedichten wieder. Die drei von mir ausgewählten Gedichte „Es ist alles eitel“ und „Thränen des Vaterlandes. Anno 1636.“ von Andreas Gryphius, sowie das Gedicht „Ach „Liebste / las vns eilen“ von Martin Opitz lassen sich auf Grund ihrer für den Barock typischen Merkmale als eindeutig dieser Zeit angehörig identifizieren. Werkinterpretation und Literaturgeschichte bedingen und ergänzen sich dabei gegenseitig. Immens wichtig ist aber auch die Betrachtung der historischen Zusammenhänge in denen Werk und Autor stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Gliederung
- Einleitung
- Theoretisches
- Der Begriff „Barock“
- „Vanitas“
- Ursprung und Entwicklung
- Interpretationen an ausgewählten Beispielen
- „Es ist alles eitel“ (Andreas Gryphius)
- Formales
- Analyse
- „Ach Liebste, laß uns eilen“ (Martin Opitz)
- Formales
- Analyse
- „Tränen des Vaterlandes, Anno 1636“ (Andreas Gryphius)
- Formales
- Analyse
- „Es ist alles eitel“ (Andreas Gryphius)
- Bilanz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Untersuchung der „Vanitas“ und des „Memento mori“ in der Lyrik des Barockzeitalters soll Aufschluss geben, welche bedeutende Rolle beide Begriffe in der Epoche von 1600 bis 1720 gespielt haben. Die Analyse soll die Grundeinstellung aufzeigen, die Zerrissenheit der Menschen und deren pessimistische Lebensauffassung verdeutlichen.
- Die Bedeutung von „Vanitas“ und „Memento mori“ in der Barocklyrik
- Die Zerrissenheit des Menschen im Barock
- Die pessimistische Lebensauffassung der Barocklyriker
- Die Rolle der Sprache in der Barocklyrik
- Die Bedeutung des historischen Kontextes für die Barocklyrik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Untersuchung der „Vanitas“ und des „Memento mori“ in der Barocklyrik vor und skizziert den historischen Kontext. Der theoretische Teil beleuchtet den Begriff „Barock“ und die Bedeutung von „Vanitas“. Der Hauptteil der Arbeit analysiert drei Gedichte: „Es ist alles eitel“ und „Tränen des Vaterlandes. Anno 1636.“ von Andreas Gryphius, sowie „Ach Liebste, laß uns eilen“ von Martin Opitz. Die Bilanz fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen.
Schlüsselwörter
Barock, Vanitas, Memento mori, Lyrik, Andreas Gryphius, Martin Opitz, Dreißigjähriger Krieg, Pessimismus, Zerrissenheit, Sprache, Stil, Form, Inhalt, Historischer Kontext.
- Quote paper
- Lisa Schüssler (Author), 2009, Der „Vanitas“-Gedanke und die Lyrik des Barock, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169566