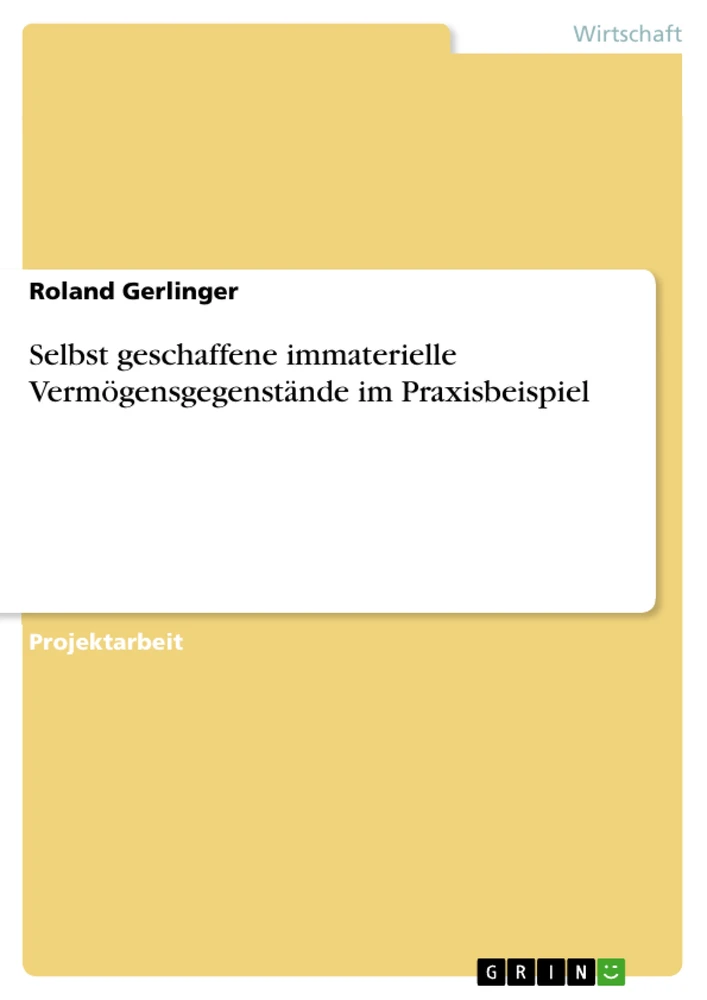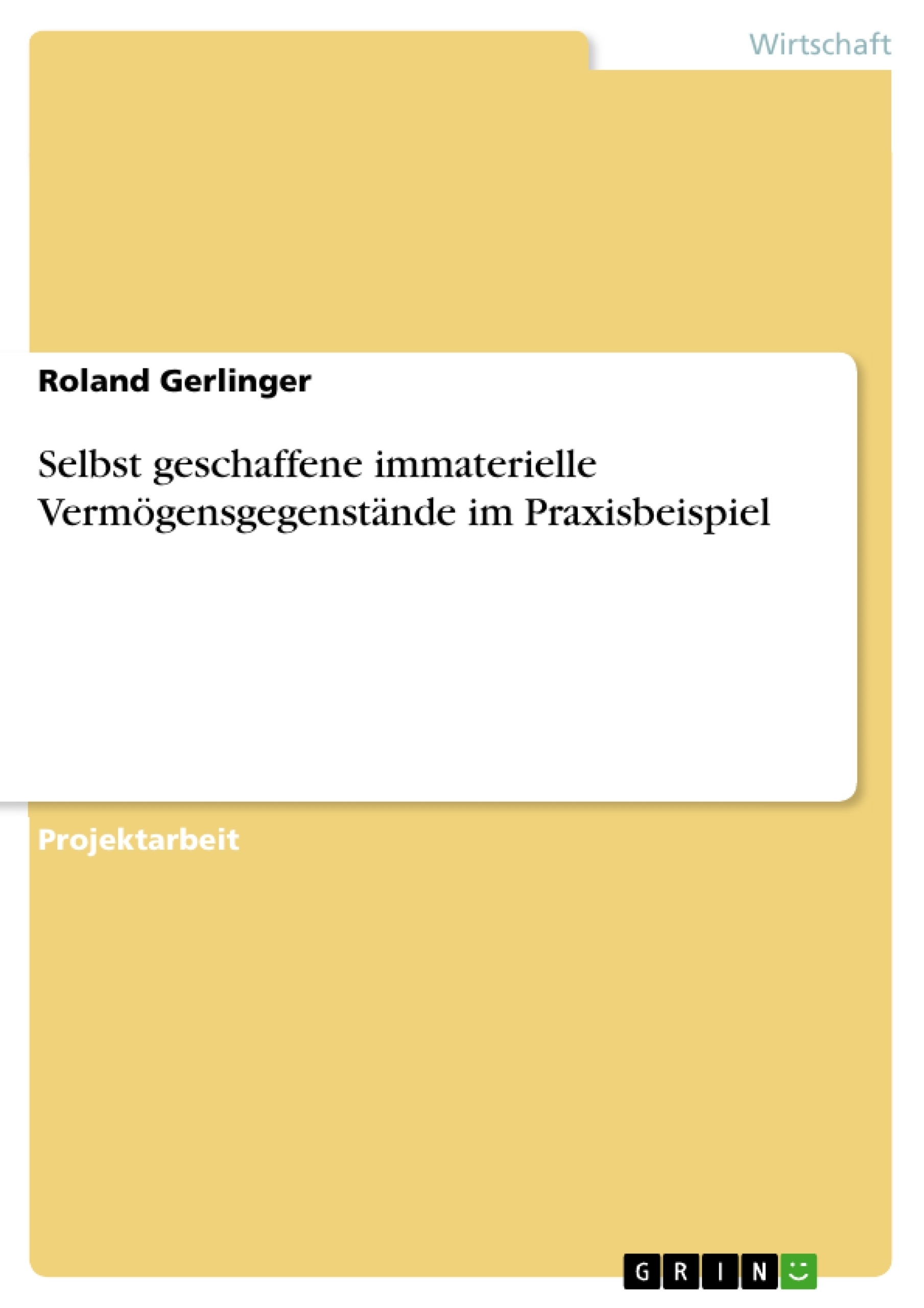Einleitung
Durch die Verabschiedung des Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechtes am 28. Mai 2009 – Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzt (BilMoG) - ist die größte Bilanzrechtsreform seit dem Bilanzrichtlinien-Gesetz (BilRiG) vom 18. Dezember 2005 abgeschlossen worden.(1;2)
Sinn dieser Reform ist eine Deregulierung die den deutschen Unternehmen eine moderne Bilanzierungsgrundlage schaffen soll, die sich nach internationalen Methoden der Rechnungslegung richtet, wie den International Financial Reporting Standards (IFRS).
Der handelsrechtliche Jahresabschluss soll an Aussagekraft gewinnen und international vergleichbarer werden. Ferner wurde eine Erleichterung des Bilanzierungsaufwandes vorgesehen, die sich insbesondere für mittelständische Einzelkaufleute aber auch für die rechnungspflichtigen Unternehmen positiv hinsichtlich des Bilanzierungsaufwand und Kosten auswirkt.(3) Im Rahmen der Reform wurde darauf geachtet das bewährte System, dass die HGB-Bilanz Grundlage der Ausschüttungsbemessung und der steuerlichen Gewinnermittlung bleibt. Das bisherige System der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung wurde nicht aufzugeben.(4)
Es wird hier an dem Unternehmen X GmbH aufgezeigt ab wann es sich lohnt selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren oder ob es sogar negative Auswirkungen auf eines der Unternehmen haben kann wenn man das Wahlrecht ausübt.
Dass immaterielle Vermögensgegenstände bedeutend sind, stellte Hiroyuki Itami schon im Jahre 1987 bei seinen wissenschaftlichen Untersuchungen fest. „Der Erfolg eines Unternehmens hängt auch von der Fähigkeit ab, immaterielle Vermögensgegenstände - der Marke, technisches Wissen und Informationen zur Kundenbasis - zu mobilisieren.“ (5)
[...]
______
(1) Vgl. (Böcking, 2010)
(2) Vgl. (Finanzen, 2009)
(3) Vgl. (Finanzen B. d., RefE des BilmoG, 2008)
(4) Vgl. (Finanzen B. d., 2008)
(5) Zitat (Itami, 1987)
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Firmenportraits
- 2.1. X GmbH
- 2.1.1. Info zu Y GmbH
- 3. Bilanzierung und Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen
- 3.1. Immaterielle Vermögensgegenstände und selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände
- 3.2. Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände
- 3.3. Ausweispflicht
- 3.4. Herstellungskosten
- 3.4.1. Forschungs- und Entwicklungskosten
- 3.5. Passive latente Steuern, Ertragssteuersatz und die Ausschüttungssperre
- 3.5.1. Passive latente Steuern im Fall selbst erstellter immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- 3.5.2. Ertragssteuersatz im Bezug auf den Standort Nördlingen
- 3.5.3. Ausschüttungssperre
- 3.6. Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände in der Handelsbilanz
- 4. Projektarbeit
- 4.1. Aufgabenstellung
- 4.2. X GmbH
- 4.2.1. Bilanzklärung X GmbH
- 4.2.2. Problembeschreibung
- 4.2.3. Auswirkungen der Aktivierung auf die Bilanz und die Gewinnausschüttung/-thesaurierung
- 4.3. Schlussfolgerung / Auswertung
- 5. Anhang
- 5.1. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit untersucht die Auswirkungen des Aktivierungswahlrechts für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände auf die X GmbH. Das Hauptziel besteht darin, zu analysieren, unter welchen Bedingungen die Aktivierung dieser Vermögensgegenstände vorteilhaft ist und ob negative Folgen, beispielsweise hinsichtlich der Gewinnausschüttung, entstehen können. Die Arbeit berücksichtigt dabei die Relevanz immaterieller Vermögensgegenstände für den Unternehmenserfolg und die Auswirkungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG).
- Auswirkungen des BilMoG auf die Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände
- Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände: Vor- und Nachteile
- Einfluss der Aktivierung auf die Gewinnausschüttung und -thesaurierung
- Bewertung und Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände
- Fallstudie am Beispiel der X GmbH
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Projektarbeit ein und erläutert den Hintergrund der Bilanzrechtsreform durch das BilMoG. Sie hebt die Bedeutung der Modernisierung der Bilanzierungsgrundlagen und die angestrebte internationale Vergleichbarkeit hervor. Die Arbeit fokussiert sich auf die Frage, unter welchen Bedingungen die Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände für die X GmbH vorteilhaft ist und ob negative Auswirkungen zu erwarten sind. Die Bedeutung immaterieller Vermögensgegenstände für den Unternehmenserfolg wird betont, wobei ein Zitat von Hiroyuki Itami die Relevanz dieser Vermögenswerte unterstreicht, auch wenn deren Ansatz nach deutscher Gesetzgebung eingeschränkt ist.
2. Firmenportraits: Dieses Kapitel beschreibt die X GmbH und gegebenenfalls weitere relevante Unternehmen, die für die Arbeit relevant sind (z.B. Y GmbH). Es stellt den Kontext der Fallstudie bereit und liefert wichtige Informationen über das untersuchte Unternehmen, die für die Bewertung der Auswirkungen des Aktivierungswahlrechts unerlässlich sind. Details zur Struktur, Geschäftsaktivitäten und Finanzlage der X GmbH werden präsentiert um das Verständnis der weiteren Analyse zu erleichtern.
3. Bilanzierung und Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen: Dieses Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen der Bilanzierung und Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände, insbesondere selbstgeschaffener. Es analysiert die gesetzlichen Regelungen, die Aktivierungspflicht, die Bestimmung der Herstellungskosten und die Behandlung von Forschungs- und Entwicklungskosten. Ein besonderer Fokus liegt auf den Auswirkungen auf passive latente Steuern, den Ertragssteuersatz und etwaige Ausschüttungssperren. Die verschiedenen Aspekte der Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände werden ausführlich erläutert und miteinander verknüpft, um ein umfassendes Bild des Themas zu liefern.
4. Projektarbeit: Dieses Kapitel präsentiert die Aufgabenstellung der Projektarbeit und wendet die in Kapitel 3 dargestellten theoretischen Grundlagen auf die X GmbH an. Es analysiert die Bilanz der X GmbH, beschreibt die Problemstellung und untersucht die Auswirkungen der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände auf die Bilanz und die Gewinnausschüttung bzw. -thesaurierung. Die gewonnenen Ergebnisse und Schlussfolgerungen werden detailliert dargestellt und diskutiert. Die Problembeschreibung fokussiert sich auf die spezifischen Herausforderungen der X GmbH im Kontext des Aktivierungswahlrechts.
Schlüsselwörter
Aktivierungswahlrecht, immaterielle Vermögensgegenstände, Bilanzierung, BilMoG, X GmbH, Gewinnausschüttung, thesaurierung, Herstellungskosten, Forschungs- und Entwicklungskosten, passive latente Steuern, Abschreibung.
Häufig gestellte Fragen zur Projektarbeit: Auswirkungen des Aktivierungswahlrechts für selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände auf die X GmbH
Was ist der Gegenstand dieser Projektarbeit?
Die Projektarbeit untersucht die Auswirkungen des Aktivierungswahlrechts für selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände auf die X GmbH. Das Hauptziel ist die Analyse der Vorteile und potenziellen Nachteile der Aktivierung dieser Vermögensgegenstände, insbesondere hinsichtlich der Gewinnausschüttung. Die Arbeit berücksichtigt das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG).
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bilanzierung und Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände, insbesondere selbstgeschaffener. Schwerpunkte sind die Auswirkungen des BilMoG, die Vor- und Nachteile der Aktivierung, der Einfluss auf die Gewinnausschüttung und -thesaurierung, die Bewertung und Abschreibung sowie eine Fallstudie am Beispiel der X GmbH. Die theoretischen Grundlagen werden ausführlich erläutert und auf die X GmbH angewendet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Firmenportraits (mit Fokus auf die X GmbH und gegebenenfalls Y GmbH), Bilanzierung und Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände, die Projektarbeit selbst (mit Aufgabenstellung, Bilanzanalyse der X GmbH, Problembeschreibung und Auswertung) und Anhang (mit Literaturverzeichnis).
Was wird im Kapitel "Bilanzierung und Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen" behandelt?
Dieses Kapitel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Bilanzierung und Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände, einschließlich der gesetzlichen Regelungen, der Aktivierungspflicht, der Herstellungskosten, Forschungs- und Entwicklungskosten, passiver latenter Steuern, des Ertragssteuersatzes, eventueller Ausschüttungssperren und der Abschreibung.
Wie wird die X GmbH in der Arbeit behandelt?
Die X GmbH dient als Fallstudie. Die Arbeit analysiert deren Bilanz, beschreibt die Problemstellung im Kontext des Aktivierungswahlrechts und untersucht die Auswirkungen der Aktivierung auf die Bilanz und die Gewinnausschüttung/-thesaurierung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Aktivierungswahlrecht, immaterielle Vermögensgegenstände, Bilanzierung, BilMoG, X GmbH, Gewinnausschüttung, Thesaurierung, Herstellungskosten, Forschungs- und Entwicklungskosten, passive latente Steuern, Abschreibung.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel besteht darin, zu analysieren, unter welchen Bedingungen die Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände für die X GmbH vorteilhaft ist und ob negative Folgen, beispielsweise hinsichtlich der Gewinnausschüttung, entstehen können. Die Arbeit soll die Relevanz immaterieller Vermögensgegenstände für den Unternehmenserfolg aufzeigen und die Auswirkungen des BilMoG berücksichtigen.
Wie ist die Struktur des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis ist hierarchisch aufgebaut und gliedert die Arbeit in Kapitel und Unterkapitel, beginnend mit einer Einleitung und endend mit einem Anhang, der ein Literaturverzeichnis enthält. Es deckt alle Aspekte der Thematik von der Einführung über die theoretischen Grundlagen bis zur Fallstudie und Schlussfolgerung ab.
- Arbeit zitieren
- Roland Gerlinger (Autor:in), 2010, Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände im Praxisbeispiel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169519