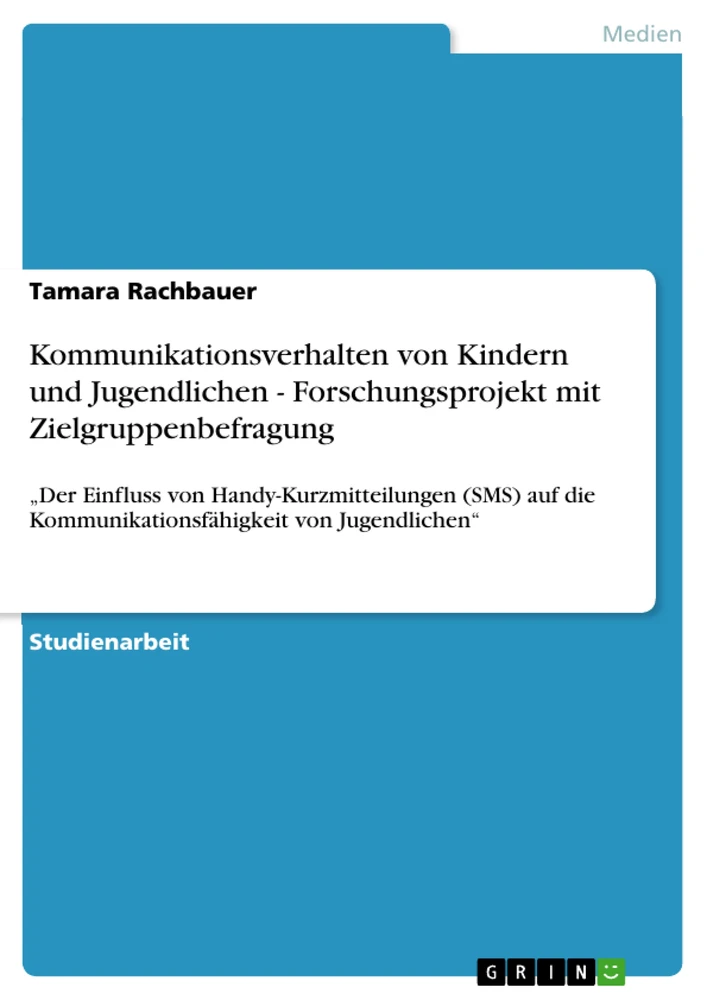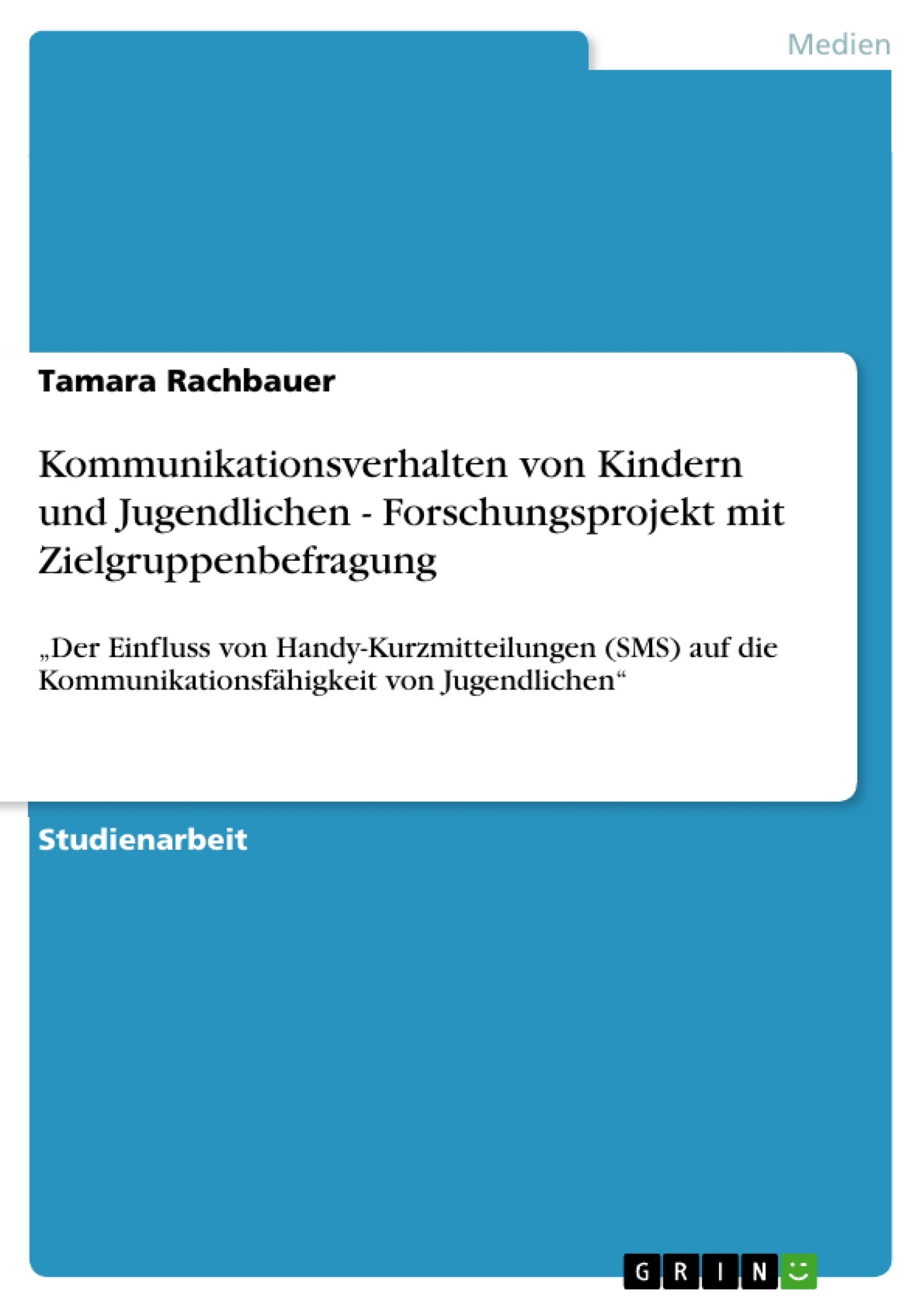Niemand hat bei der Geburtsstunde des Handys damit gerechnet, dass die SMS einen derartigen Beliebtheitsgrad erreichen würde. Denn ursprünglich waren diese Kurzmitteilungen nur als „Abfallprodukt“ gedacht und wurden sogar kostenlos angeboten. Mittlerweile ist die SMS aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.
Tagtäglich wird sie verschickt, um Bekannten und FreundInnen kurze Nachrichten zukommen zu lassen, sie über Neuigkeiten zu informieren, oder einfach über Belanglosigkeiten zu tratschen. Laut Jim-Studie 2009 nutzen Jugendliche die SMS-Funktion des Handys am häufigsten, dabei sind 30 SMS und mehr pro Tag keine Seltenheit.
Dabei wird laut Döring (2006) die interpersonale SMS-Kommunikation vor allem zur Pflege bestehender privater Beziehungen (Verabredungen, Medienwechsel, Grüße, Sprüche) eingesetzt, nicht umsonst ist die meistgenutzte Abkürzung in deutschsprachigen SMS-Botschaften HDL (hab dich lieb) mit entsprechenden Varianten (HDGGDL: hab dich ganz ganz doll lieb).
Aber gerade weil man sich mit einer SMS kurz fassen kann, ohne kurz angebunden zu wirken, weil Abkürzungen, Symbole und auch Tippfehler toleriert und oft sogar als Teil der SMS-Kultur verstanden werden, weil Groß- und Kleinschreibung kaum eine Rolle spielen und Gefühle und Stimmungen häufig mit so genannten Emoticons ausgedrückt werden, machen sich Erwachsene Sorgen, dass diese Art der schriftlichen Kommunikation einen schlechten Einfluss auf den Sprach- und Schreibstil der Heranwachsenden hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Das Forschungsprojekt „Der Einfluss von Handy-Kurzmitteilungen (SMS) auf die Kommunikationsfähigkeit von Jugendlichen“
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Forschungsfragen und Hypothesen
- 1.3 Die befragte Zielgruppe
- 2 Ablauf des Forschungsprojektes
- 2.1 Schritt 1: die Auswahl geeigneter Datenerhebungsmethoden
- 2.1.1 Gruppendiskussion
- 2.1.2 Leitfadeninterview
- 2.1.3 SMS-Nachrichten-Textanalyse
- 2.2 Schritt 2: die Auswahl geeigneter Datenauswertungsmethoden
- 2.2.1 Datendokumentation
- 2.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse
- 2.3 Schritt 3: Auswertung der den Überschriften zugeordneten Aussagen
- 2.4 Schritt 4: Die Auswertung der SMS-Nachrichten-Textanalyse
- 2.4.1 Schreibstil
- 2.4.2 Höflichkeitsformen
- 2.4.3 Einsatz von Emoticons, Bildern und Abkürzungen
- 2.4.4 Fehler (Grammatik- und Rechtsschreibfehler)
- 2.5 Schritt 5: Interpretation der den Überschriften zugeordneten Aussagen und der Ergebnisse der SMS-Nachrichten-Textanalyse
- 3 Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studie untersucht den Einfluss von SMS-Kommunikation auf die Kommunikationsfähigkeit von Jugendlichen. Es wird analysiert, warum SMS bei Jugendlichen so beliebt sind und ob die intensive Nutzung und der damit verbundene Schreibstil negative Auswirkungen auf die Beherrschung der Schriftsprache und Grammatik haben.
- Beliebtheit von SMS-Kommunikation bei Jugendlichen
- Auswirkungen des SMS-Schreibstils auf die Schriftsprache
- Analyse von SMS-Nachrichten hinsichtlich Schreibstil, Höflichkeit, Emoticons und Fehlern
- Qualitative und quantitative Methoden der Datenerhebung und -auswertung
- Zusammenhang zwischen SMS-Kommunikation und Sprachkompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
1 Das Forschungsprojekt „Der Einfluss von Handy-Kurzmitteilungen (SMS) auf die Kommunikationsfähigkeit von Jugendlichen“: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet die immense Popularität von SMS bei Jugendlichen. Es werden Forschungsfragen formuliert, die sich mit der Beliebtheit von SMS und deren potenziellen negativen Auswirkungen auf die Sprach- und Schreibkompetenz auseinandersetzen. Die Studie untersucht die Sorgen Erwachsener über den Einfluss von SMS auf den Sprachstil von Jugendlichen und formuliert Hypothesen zu diesen Fragen. Der Abschnitt umreißt die Zielgruppe der Studie – 20 Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren, die AHS oder BHS besuchen. Die Einleitung liefert den Kontext und den Hintergrund der Untersuchung. Die dargestellten Statistiken der JIM-Studie unterstreichen die hohe SMS-Nutzungsrate bei Jugendlichen.
2 Ablauf des Forschungsprojektes: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den methodischen Ablauf der Studie. Es werden die gewählten Datenerhebungsmethoden (Gruppendiskussionen, Leitfadeninterviews, SMS-Textanalyse) erläutert und begründet. Die Kapitel erläutern den Prozess der Datenauswertung, inklusive Datendokumentation und qualitativer Inhaltsanalyse. Die Schritte der Auswertung der den Überschriften zugeordneten Aussagen und die Analyse der SMS-Nachrichten selbst (Schreibstil, Höflichkeitsformen, Emoticons, Fehler) werden chronologisch und detailliert dargestellt. Es wird deutlich, wie die verschiedenen Methoden kombiniert wurden, um ein umfassendes Bild der SMS-Kommunikation bei Jugendlichen zu erhalten.
Schlüsselwörter
SMS, Kurzmitteilungen, Jugendliche, Kommunikationsfähigkeit, Sprachkompetenz, Schreibstil, Grammatik, Rechtschreibung, Emoticons, Qualitative Inhaltsanalyse, Datenerhebung, Datenauswertung, JIM-Studie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Forschungsprojekt: "Der Einfluss von Handy-Kurzmitteilungen (SMS) auf die Kommunikationsfähigkeit von Jugendlichen"
Was ist das Thema des Forschungsprojekts?
Das Forschungsprojekt untersucht den Einfluss von SMS-Kommunikation auf die Kommunikationsfähigkeit von Jugendlichen. Es analysiert die Beliebtheit von SMS bei Jugendlichen und mögliche negative Auswirkungen des SMS-Schreibstils auf die Schriftsprache und Grammatik.
Welche Forschungsfragen werden untersucht?
Die Studie untersucht, warum SMS bei Jugendlichen so beliebt sind und ob die intensive Nutzung und der damit verbundene Schreibstil negative Auswirkungen auf die Beherrschung der Schriftsprache und Grammatik haben. Konkret werden Fragen zur Beliebtheit von SMS, Auswirkungen auf den Schriftsprachstil, die Analyse von SMS-Nachrichten (Schreibstil, Höflichkeit, Emoticons, Fehler) und den Zusammenhang zwischen SMS-Kommunikation und Sprachkompetenz gestellt.
Welche Methoden wurden zur Datenerhebung verwendet?
Das Projekt verwendet qualitative Methoden wie Gruppendiskussionen, Leitfadeninterviews und eine SMS-Nachrichten-Textanalyse. Die Auswahl dieser Methoden wird im Detail im Kapitel 2 erläutert und begründet.
Welche Methoden wurden zur Datenauswertung verwendet?
Die Datenauswertung umfasst eine Datendokumentation und eine qualitative Inhaltsanalyse. Die Auswertung beinhaltet die Analyse der den Überschriften zugeordneten Aussagen sowie eine detaillierte Untersuchung der SMS-Nachrichten hinsichtlich Schreibstil, Höflichkeitsformen, Einsatz von Emoticons, Bildern und Abkürzungen und der Fehler (Grammatik und Rechtschreibung).
Welche Zielgruppe wurde in der Studie untersucht?
Die Studie untersucht 20 Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren, die eine AHS oder BHS besuchen.
Wie ist der Aufbau des Forschungsberichts?
Der Bericht gliedert sich in drei Hauptteile: 1. Das Forschungsprojekt (Einleitung, Forschungsfragen, Zielgruppe), 2. Ablauf des Forschungsprojektes (Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden, detaillierte Beschreibung der Auswertungsschritte) und 3. Abschließende Bemerkungen. Zusätzlich enthält der Bericht ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Ergebnisse werden im Bericht dargestellt?
Der Bericht präsentiert die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse der Gruppendiskussionen, Leitfadeninterviews und der SMS-Textanalyse. Die Ergebnisse zeigen den Zusammenhang zwischen SMS-Kommunikation und den Aspekten der Sprachkompetenz auf, wie sie in den Forschungsfragen formuliert wurden. Die Interpretation der Ergebnisse wird im Kapitel 2.5 detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Forschungsprojekt?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: SMS, Kurzmitteilungen, Jugendliche, Kommunikationsfähigkeit, Sprachkompetenz, Schreibstil, Grammatik, Rechtschreibung, Emoticons, Qualitative Inhaltsanalyse, Datenerhebung, Datenauswertung, JIM-Studie.
- Citar trabajo
- BSc Tamara Rachbauer (Autor), 2010, Kommunikationsverhalten von Kindern und Jugendlichen - Forschungsprojekt mit Zielgruppenbefragung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169401