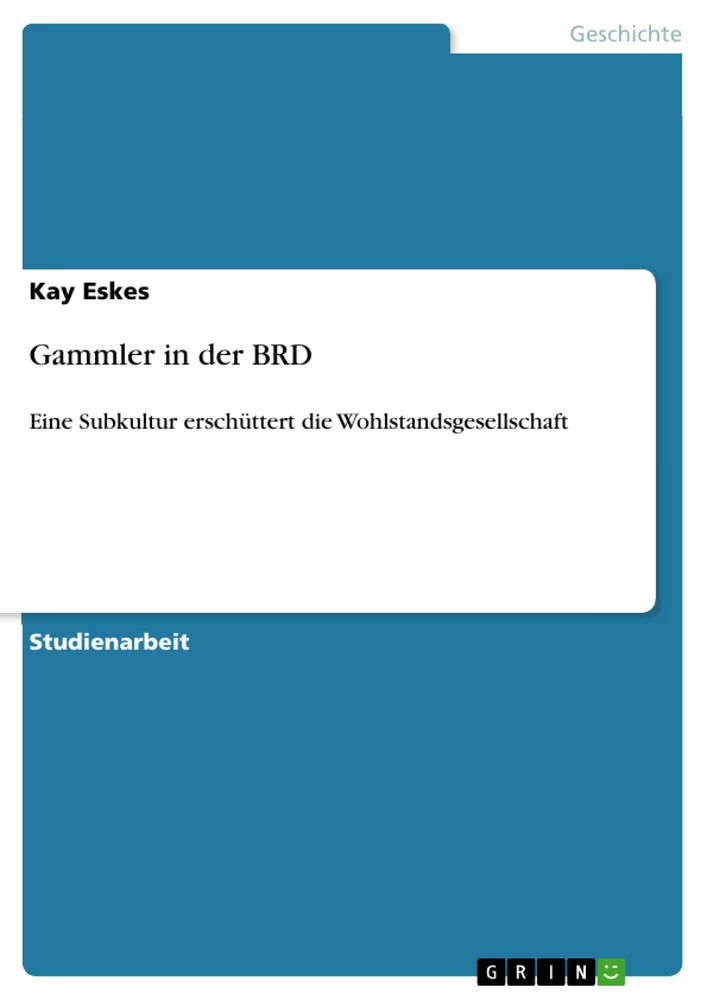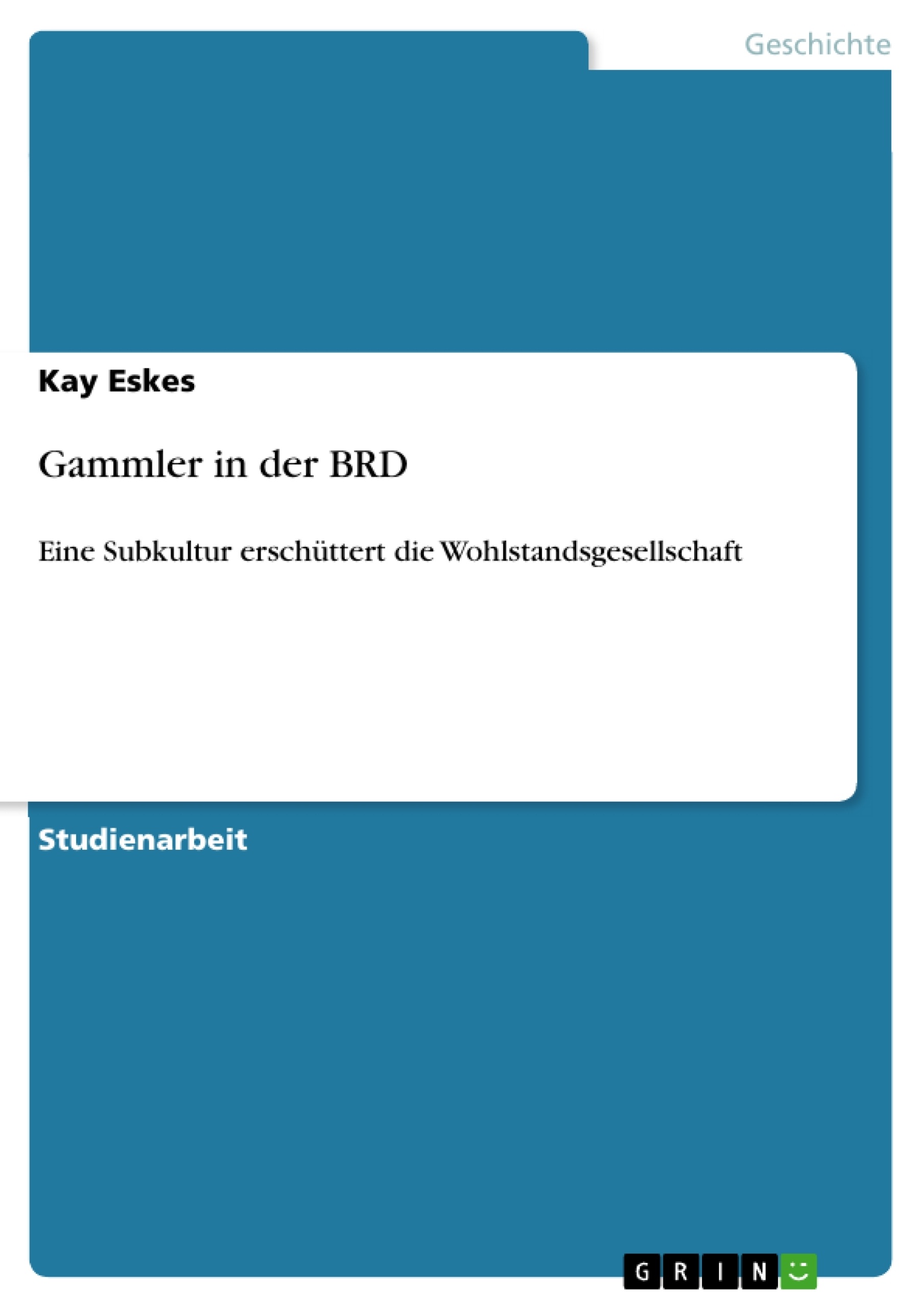Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung 3
1.1 Literatur zum Thema 4
2. Hauptteil 6
2.1 Die Gammler: Eine nonkonformistische Subkultur 6
2.1.1 Wer waren die Gammler? 6
2.1.2 Leitmotive der Gammler: Nonkonformismus und Individualismus 8
2.1.3 Waren die Gammler eine politische Bewegung? 9
2.1.4 Wie sahen Gammler aus? 10
2.1.5 Versammlungsorte und Treffpunkte 12
2.2 Kulturelle Praktiken der Gammler 15
2.2.1 Mobilität und Reisen 15
2.2.2 Müssigkeit und Nichtstun 17
2.2.3 Besitzlosigkeit und Konsumverweigerung 19
2.3 Reaktionen auf die Gammler 22
3. Zusammenfassung und Fazit 25
4. Quellenverzeichnis 28
1. Einleitung
"Dann kamen die Gammler. Sie probten keinen Aufstand, sie erhoben sich nicht. Sie legten sich nieder. Die jungen Helden waren müde. Sie kreierten die langsamste Jugendbewegung aller Zeiten: den Müssiggang."
Im Zuge der soziokulturellen Veränderungen während der „langen Sechziger Jahre“ , entstanden immer wieder unterschiedliche gegenkulturelle Subkulturen, welche die gesellschaftliche Ordnung in verschiedener Weise und in unterschiedlichem Ausmass zu bedrohen schienen. Aber kaum eine andere Subkultur vermochte die breite Öffentlichkeit derart in Aufregung zu versetzen, wie dies die sogenannten Gammler taten, die sich zwischen 1965 und 1967 auf öffentlichen Plätzen westdeutscher Grossstädte trafen und ihre Zeit mit Herumsitzen und Nichtstun verbrachten. Mit ihrer offen zur Schau gestellten Müssigkeit erregten sie Ärger und Neugier der Bundesbürger. Dabei waren die Gammler weder aggressiv noch laut. Sie wollten die Welt nicht programmatisch verändern, sondern im Grunde nur in Ruhe gelassen werden.
Doch wer waren diese Jugendlichen, die gemäss einer Umfrage 56% der Westdeutschen zur Arbeit zwingen lassen wollten? Wie konnte es also sein, dass diese neue jugendliche Sozialfigur mit langen Haaren, zerfransten Jeans und verschiedenfarbigen Socken , die nur wenig politisches Engagement an den Tag legte , in weiten Kreisen der westdeutschen Gesellschaft eine derart hysterische Reaktion auslöste, dass gar Bundeskanzler Ludwig Erhard meinte, dass, solange er regiere, er alles tun würde, um dieses „Unwesen“ zu zerstören?
Diese und andere Fragen sollen in vorliegender Arbeit beantworten werden. Der Fokus richtet sich dabei einerseits darauf, die subkulturellen Eigenheiten der Gammlerkultur zu umreissen und darzulegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Literatur zum Thema
- Hauptteil
- Die Gammler: Eine nonkonformistische Subkultur
- Wer waren die Gammler?
- Leitmotive der Gammler: Nonkonformismus und Individualismus
- Waren die Gammler eine politische Bewegung?
- Wie sahen Gammler aus?
- Versammlungsorte und Treffpunkte
- Kulturelle Praktiken der Gammler
- Mobilität und Reisen
- Müssigkeit und Nichtstun
- Besitzlosigkeit und Konsumverweigerung
- Reaktionen auf die Gammler
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gammler-Subkultur der 1960er Jahre in Westdeutschland. Ziel ist es, die Eigenheiten dieser Kultur zu beschreiben und ihre soziopolitische Bedeutung zu analysieren. Die Arbeit geht der Frage nach, warum die Gammler, trotz ihres vermeintlich unpolitischen Verhaltens, eine so starke gesellschaftliche Reaktion hervorriefen.
- Soziale Zusammensetzung und Merkmale der Gammler-Subkultur
- Ideologie und Motive der Gammler
- Kulturelle Praktiken und Lebensweisen der Gammler
- Gesellschaftliche Reaktionen auf die Gammler-Subkultur
- Die Bedeutung der Gammler als Ausdruck von Nonkonformität
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Gammler-Subkultur ein und stellt die Forschungsfrage nach den Gründen für die starke gesellschaftliche Reaktion auf diese Gruppe. Sie hebt die relative Forschungslücke zum Thema hervor und benennt wichtige Quellen, die im weiteren Verlauf der Arbeit herangezogen werden. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und formuliert die These, dass die Ablehnung der Gammler auf ihrer demonstrativen Ablehnung der Konformität der Wohlstandsgesellschaft beruhte.
Die Gammler: Eine nonkonformistische Subkultur: Dieses Kapitel charakterisiert die Gammler-Subkultur. Es beschreibt die soziale Zusammensetzung der Gruppe (breite soziale Herkunft, überwiegend männlich, Alter zwischen 16 und 24 Jahren), ihre Ideologie (Nonkonformismus, Individualismus, Ablehnung der Leistungsgesellschaft), ihr Erscheinungsbild und ihre kulturellen Praktiken (Müssigkeit, Reisen, Besitzlosigkeit). Es wird analysiert, ob die Gammler eine politische Bewegung darstellten, und ihre bevorzugten Versammlungsorte werden beleuchtet. Der Abschnitt synthetisiert die Informationen aus den Unterkapiteln zu einem Gesamtbild der Gammler-Kultur und ihrer zentralen Merkmale.
Kulturelle Praktiken der Gammler: Dieses Kapitel untersucht die kulturellen Ausdrucksformen der Gammler, wie Mobilität und Reisen, Müssigkeit und Nichtstun, sowie Besitzlosigkeit und Konsumverweigerung. Es analysiert die Bedeutung dieser Praktiken als Ausdruck der Ablehnung der Konsum- und Leistungsgesellschaft und deren Rolle in der Entstehung des Konfliktes mit der Mehrheitsgesellschaft. Die einzelnen Unterkapitel werden im Kontext der Gesamtentwicklung der Gammler-Kultur und ihrer zentralen Botschaft interpretiert.
Reaktionen auf die Gammler: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Reaktionen auf die Gammler-Subkultur in der westdeutschen Gesellschaft. Es analysiert die gesellschaftliche Besorgnis und die Ängste, die durch die offen zur Schau gestellte Müssigkeit und Nonkonformität ausgelöst wurden. Der Abschnitt setzt diese Reaktionen in den Kontext der Zeit und analysiert sie als Spiegelbild der gesellschaftlichen Spannungen und des Konflikts zwischen etablierter Ordnung und jugendlicher Gegenkultur. Die Reaktion des Bundeskanzlers wird hier ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Gammler, Subkultur, Nonkonformismus, 1960er Jahre, Westdeutschland, Jugendkultur, Gegenkultur, Müssigkeit, Leistungsgesellschaft, Wohlstandsgesellschaft, gesellschaftliche Reaktionen, Individualismus, Konformität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Die Gammler – Eine nonkonformistische Subkultur der 1960er Jahre in Westdeutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Gammler-Subkultur der 1960er Jahre in Westdeutschland. Sie beschreibt die Eigenheiten dieser Kultur und analysiert deren soziopolitische Bedeutung. Ein zentraler Aspekt ist die Frage, warum die Gammler trotz ihres vermeintlich unpolitischen Verhaltens eine so starke gesellschaftliche Reaktion hervorriefen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die soziale Zusammensetzung und Merkmale der Gammler-Subkultur, die Ideologie und Motive der Gammler, deren kulturelle Praktiken und Lebensweisen, die gesellschaftlichen Reaktionen auf die Gammler-Subkultur und die Bedeutung der Gammler als Ausdruck von Nonkonformität.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und ein Fazit. Der Hauptteil umfasst Kapitel über die Charakterisierung der Gammler-Subkultur, deren kulturelle Praktiken und die gesellschaftlichen Reaktionen auf diese Gruppe. Die Einleitung führt in das Thema ein und benennt die Forschungsfrage und die wichtigsten Quellen. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Wer waren die Gammler?
Die Gammler waren eine nonkonformistische Subkultur der 1960er Jahre in Westdeutschland, überwiegend männlich, im Alter zwischen 16 und 24 Jahren und mit breiter sozialer Herkunft. Ihren Lebensstil kennzeichneten Nonkonformismus, Individualismus und die Ablehnung der Leistungsgesellschaft. Ob sie eine politische Bewegung darstellten, wird in der Arbeit diskutiert.
Welche kulturellen Praktiken hatten die Gammler?
Zu den kulturellen Praktiken der Gammler gehörten Mobilität und Reisen, Müssigkeit und Nichtstun sowie Besitzlosigkeit und Konsumverweigerung. Diese Praktiken sind als Ausdruck der Ablehnung der Konsum- und Leistungsgesellschaft zu verstehen.
Wie reagierte die Gesellschaft auf die Gammler?
Die Gesellschaft reagierte mit Besorgnis und Angst auf die Gammler, ausgelöst durch deren zur Schau gestellte Müssigkeit und Nonkonformität. Diese Reaktionen spiegeln gesellschaftliche Spannungen und den Konflikt zwischen etablierter Ordnung und jugendlicher Gegenkultur wider. Die Reaktion des Bundeskanzlers wird ebenfalls thematisiert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit argumentiert, dass die Ablehnung der Gammler auf deren demonstrativen Verzicht auf Konformität in der Wohlstandsgesellschaft beruhte. Die genauen Ergebnisse und die These der Arbeit werden im Fazit zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Gammler, Subkultur, Nonkonformismus, 1960er Jahre, Westdeutschland, Jugendkultur, Gegenkultur, Müssigkeit, Leistungsgesellschaft, Wohlstandsgesellschaft, gesellschaftliche Reaktionen, Individualismus, Konformität.
- Citar trabajo
- Kay Eskes (Autor), 2011, Gammler in der BRD, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169390