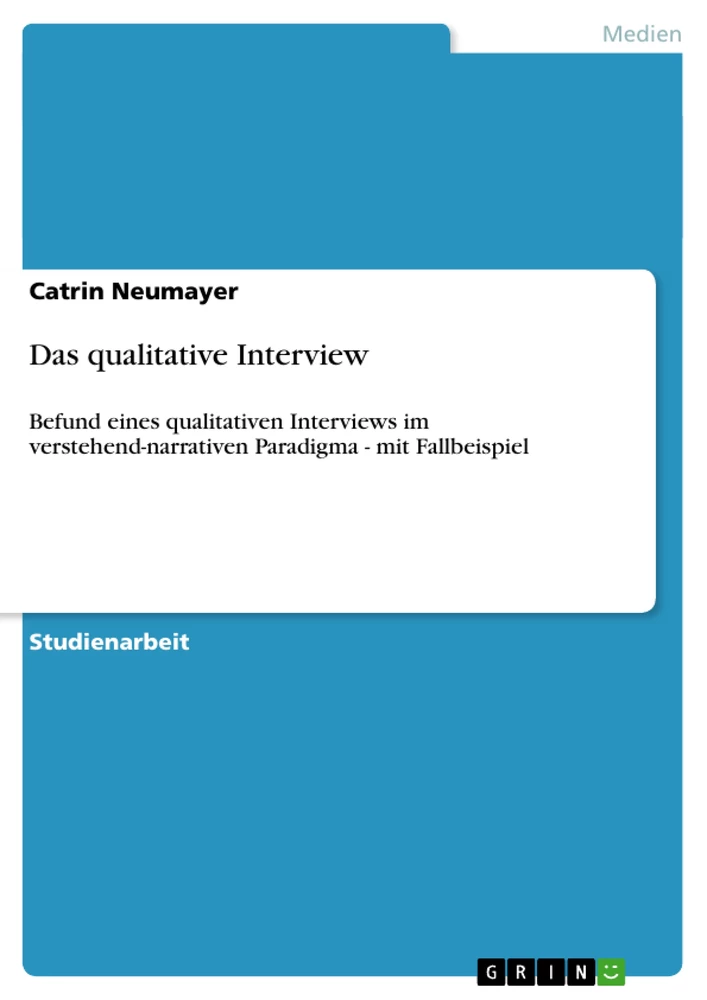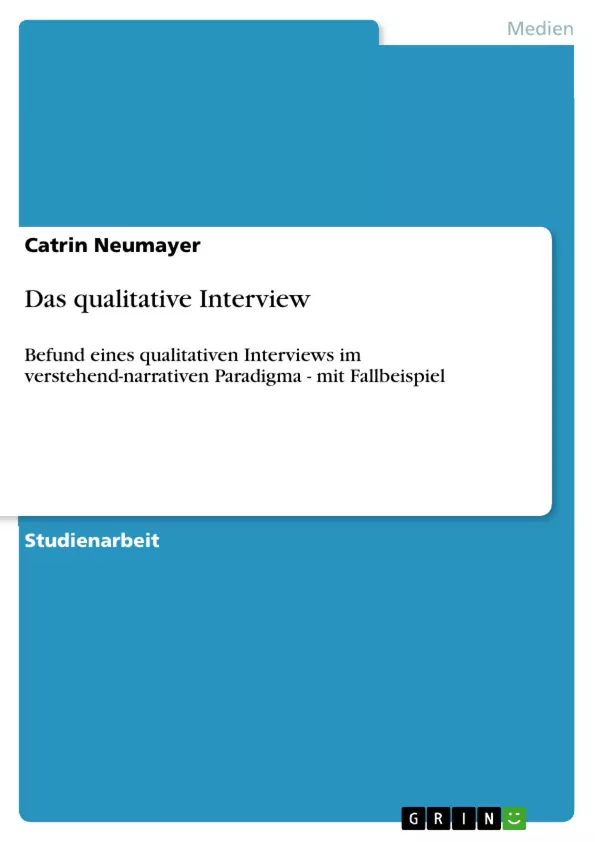Ziel dieser Arbeit ist es, ein von mir, im Zuge der Lehrveranstaltung „das qualitative
Interview“, durchgeführtes Interview in transkribierter Form darzustellen. Im Anschluss
daran sollen die bedeutungsvollen, narrativen Strukturen des Gesagten herausgearbeitet
werden, um zu hinterfragen welche Thematiken und Schwierigkeiten sich für Jugendliche,
die sich im Übergangsstadium zwischen Schule und Arbeit, somit im Arbeitsfindungsprozess,
befinden, welche als Probanden innerhalb dieser Untersuchung befragt wurden,
ergeben. Als Vorgangsweise wurde dafür ein offenes Leitfadeninterview, mit der
Zielsetzung dem Befragten möglichst viel Erzählungsfreiraum zu geben, verwendet, da sich
durch Selbiges die „subjektiven Bedeutungsstrukturen, die sich im freien Erzählen […]
herausschälen [lassen], sich [ jedoch in] einem systematischen Abfragen aber verschließen
[würden]“ (Mayring, 2002: S.72), herausgearbeitet werden können. „Ziel des
Intensivinterviews ist es im Rahmen […] der Forschung genaue Informationen vom
Befragten, unter besonderer Berücksichtigung von Sprache und Bedürfnissen zu erlangen.
[…]“ (Friedrichs 1985: S. 247f) Somit sucht diese Arbeit das durchgeführte Interview
möglichst genau zu beschreiben, ferner die sich daraus ergebenden Vor- und
Durchführungsschritte, sowie damit verbundene Problematiken zu beschreiben und im
letzten Teil der Arbeit das Gesagte anhand der Analysemethode der „grounded theory“ zu
hinterfragen.
1. Einleitung 1
2. Zugang zum Feld 1
2.1. Gatekeeper 1
2.2. Anfangssituation 2
2.3. Befragungsatmosphäre 2
3. Methode 3
3.1. Kriterien eines qualitativen Interviews 3
4. Leitfaden 4
4.3. Pretest 4
4.4. Rolle des Forschers 4
4.5 Problematiken 5
5. Hauptteil 6
5.1. Transkriptionsverfahren 6
5.2. grounded theory 6
6. Interpretation 7
6.1. zentrales Thema 8
6.2. Kontext 8
6.3. ursächliche Bedingungen 9
6.4. intervenierende Bedingungen 11
6.5. Handlungsstrategien 13
6.6. Konsequenzen 13
7. Schlussfolgerungen 14
8. Konklusion 14
9. Literaturnachweiß 15
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zugang zum Feld
- 2.1. Gatekeeper
- 2.2. Anfangssituation
- 2.3. Befragungsatmosphäre
- 3. Methode
- 3.1. Kriterien eines qualitativen Interviews
- 4.2. Der Leitfaden
- 4.3. Pretest
- 4.4. Rolle des Forschers
- 4.5. Problematiken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit präsentiert ein transkribiertes qualitatives Interview mit Jugendlichen im Übergang zwischen Schule und Beruf. Ziel ist die Analyse der narrativen Strukturen, um Schwierigkeiten und Themen dieser Phase zu beleuchten. Es wurde ein offenes Leitfadeninterview verwendet, um den Erzählfluss und die subjektiven Bedeutungsstrukturen der Befragten zu erfassen.
- Herausforderungen im Übergang Schule-Beruf
- Narrative Strukturen und subjektive Bedeutungszuschreibungen
- Methodische Aspekte qualitativer Interviews
- Rolle des Forschers und Herausforderungen der Interviewführung
- Analyse mittels „grounded theory“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Darstellung eines transkribierten Interviews mit Jugendlichen im Übergang Schule-Beruf und die anschließende Analyse der narrativen Strukturen. Es wird die Methode des offenen Leitfadeninterviews begründet, um den Erzählraum der Befragten zu maximieren und somit subjektive Bedeutungsstrukturen aufzudecken. Die Arbeit soll das Interview detailliert beschreiben, die Durchführungsschritte beleuchten, aufgetretene Problematiken darstellen und abschließend eine Analyse mittels „grounded theory“ vornehmen. Die methodische Herangehensweise wird durch Zitate von Mayring (2002) und Friedrichs (1985) untermauert, die die Bedeutung des freien Erzählens und die Gewinnung genauer Informationen im Interview betonen.
2. Zugang zum Feld: Dieses Kapitel beschreibt den Zugang der Autorin zum Forschungsfeld. Durch ihr persönliches Netzwerk („Gatekeeper“) konnte sie unkompliziert Kontakt zu Jugendlichen im Berufsfindungsprozess herstellen. Der Abschnitt 2.1 beschreibt den positiven Einfluss der „Gatekeeper“ auf den Zugang und die positive Resonanz auf das Interviewvorhaben. Abschnitt 2.2 detailliert die Kennenlernphase mit potentiellen Probandinnen in einer ungezwungenen Atmosphäre, um Vertrauen aufzubauen und Gesprächsbereitschaft, Redefluss und Offenheit zu beurteilen. Abschnitt 2.3 beleuchtet die positive und entspannte Atmosphäre des Interviews in der Wohnung der Forscherin, die durch das Vorgespräch und die gewählte Umgebung begünstigt wurde. Die positive Erfahrung des Zugangs zum Feld und der Interviewsituation wird betont, wobei die Rolle der „Gatekeeper“ als wesentlicher Faktor hervorgehoben wird.
3. Methode: Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Grundlagen des qualitativen Interviews. Abschnitt 3.1 erläutert die Kriterien eines qualitativen Interviews nach Merton, Fiske und Kendall (zitiert nach Heinze 2004): maximale Reichweite, Spezifität, Tiefe der Äußerungen und Neutralität des Forschers. Die Bedeutung der uneingeschränkten Aussagefreiheit zur Erschließung der subjektiven Lebenswelt der Befragten wird unterstrichen. Abschnitt 4.2 beschreibt den Einsatz eines im Vorfeld entwickelten Leitfadens mit offenen Fragestellungen, der die Vergleichbarkeit der Interviews und die Reduktion von Unsicherheiten bei den Jugendlichen gewährleisten sollte.
4.3. Pretest: Dieses Kapitel behandelt den Pretest, der durchgeführt wurde, um den Frageleitfaden zu testen und die Interviewerfahrung der Autorin zu verbessern. Die Notwendigkeit des Pretests wird aufgrund der fehlenden Interviewerfahrung der Autorin begründet. Der Pretest diente der Klärung der Praktikabilität des Fragebogens und dem Sammeln von Erfahrung im Umgang mit Probandinnen und der Interviewtechnik.
4.4. Rolle des Forschers: Dieses Kapitel fokussiert auf die Rolle der Forscherin und die Herausforderungen der Interviewführung. Es wird betont, dass der Erfolg des Interviews von den Fähigkeiten der Interviewerin abhängt. Wichtige Qualifikationen sind soziale Kompetenz, spontanes Kodieren, richtiges Nachfragen und ad-hoc-Entscheidungen in komplexen Situationen. Der Einfluss nonverbaler Gesprächssignale auf die Gesprächsatmosphäre und den Aufbau einer positiven Beziehung zwischen Interviewerin und Probandin wird beschrieben. Die Bedeutung von „Fremdverstehen“ (Helfferich 2005) und die Notwendigkeit, eigene Deutungen zurückzustellen, werden hervorgehoben. Fachliche und persönliche Kompetenzen der Interviewerin (Heinze 2004) werden ebenfalls genannt.
4.5. Problematiken: Der letzte beschriebene Abschnitt beleuchtet auftretende Problematiken während der Interviews. Die Autorin beschreibt einen dominierenden Gesprächsstil, partielle Urteile und die anfängliche Unsicherheit, (teil-)suggestive Fragen zu stellen. Die Angst vor verkürzten Antworten und Unterbrechungen des Redeflusses führte zu längeren Überlegungspausen bei der Formulierung der Fragen.
Schlüsselwörter
Qualitatives Interview, Narratives Paradigma, Jugendlicher Übergang Schule-Beruf, Berufsfindung, Subjektive Bedeutungsstrukturen, Grounded Theory, Methodologie, Interviewführung, Gatekeeper.
Häufig gestellte Fragen zum qualitativen Interview: Übergang Schule-Beruf
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert ein transkribiertes qualitatives Interview mit Jugendlichen im Übergang zwischen Schule und Beruf. Der Fokus liegt auf der Analyse der narrativen Strukturen und der Herausforderungen dieser Lebensphase.
Welche Methode wurde angewendet?
Es wurde ein offenes Leitfadeninterview verwendet, um den natürlichen Erzählfluss der Jugendlichen und ihre subjektiven Bedeutungszuschreibungen zu erfassen. Die Analyse erfolgt mittels „grounded theory“.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Einleitung, dem Zugang zum Feld (inkl. Gatekeeper, Anfangssituation und Befragungsatmosphäre), der Methode (Kriterien qualitativer Interviews und Leitfaden), dem Pretest, der Rolle des Forschers, auftretenden Problematiken und den Schlüsselbegriffen.
Wie wurde der Zugang zum Feld hergestellt?
Der Zugang zu den Jugendlichen erfolgte über ein persönliches Netzwerk („Gatekeeper“), was den Kontakt und die positive Resonanz auf das Interviewvorhaben erleichterte. Die Kennenlernphase fokussierte auf Vertrauensaufbau und die Beurteilung der Gesprächsbereitschaft.
Welche methodischen Aspekte werden beleuchtet?
Die Arbeit beschreibt die Kriterien qualitativer Interviews nach Merton, Fiske und Kendall (maximale Reichweite, Spezifität, Tiefe, Neutralität), den Einsatz eines offenen Leitfadens, den durchgeführten Pretest zur Verbesserung der Interviewführung und die Herausforderungen der Interviewführung, wie z.B. den Umgang mit einem dominierenden Gesprächsstil.
Welche Rolle spielte der Forscher?
Die Rolle des Forschers wird als essentiell für den Erfolg des Interviews hervorgehoben. Soziale Kompetenz, spontanes Kodieren, richtiges Nachfragen, ad-hoc-Entscheidungen und das Verständnis für nonverbale Signale sind wichtige Aspekte. Die Bedeutung von „Fremdverstehen“ und das Zurückstellen eigener Deutungen werden ebenfalls betont.
Welche Problematiken traten auf?
Während der Interviews traten Problematiken wie ein dominierender Gesprächsstil bei den Jugendlichen, partielle Urteile und die anfängliche Unsicherheit der Interviewerin auf (teil-)suggestive Fragen zu stellen. Die Angst vor verkürzten Antworten und Unterbrechungen des Redeflusses führte zu längeren Überlegungspausen bei der Formulierung der Fragen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Qualitatives Interview, Narratives Paradigma, Jugendlicher Übergang Schule-Beruf, Berufsfindung, Subjektive Bedeutungsstrukturen, Grounded Theory, Methodologie, Interviewführung, Gatekeeper.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist die Analyse der narrativen Strukturen im Interview, um Schwierigkeiten und Themen im Übergang von Schule zum Beruf bei Jugendlichen zu beleuchten und methodische Aspekte qualitativer Interviews zu diskutieren.
Welche Literatur wurde verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Werke von Mayring (2002), Friedrichs (1985), Heinze (2004) und Helfferich (2005).
- Quote paper
- MMag. Catrin Neumayer (Author), 2010, Das qualitative Interview, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169372