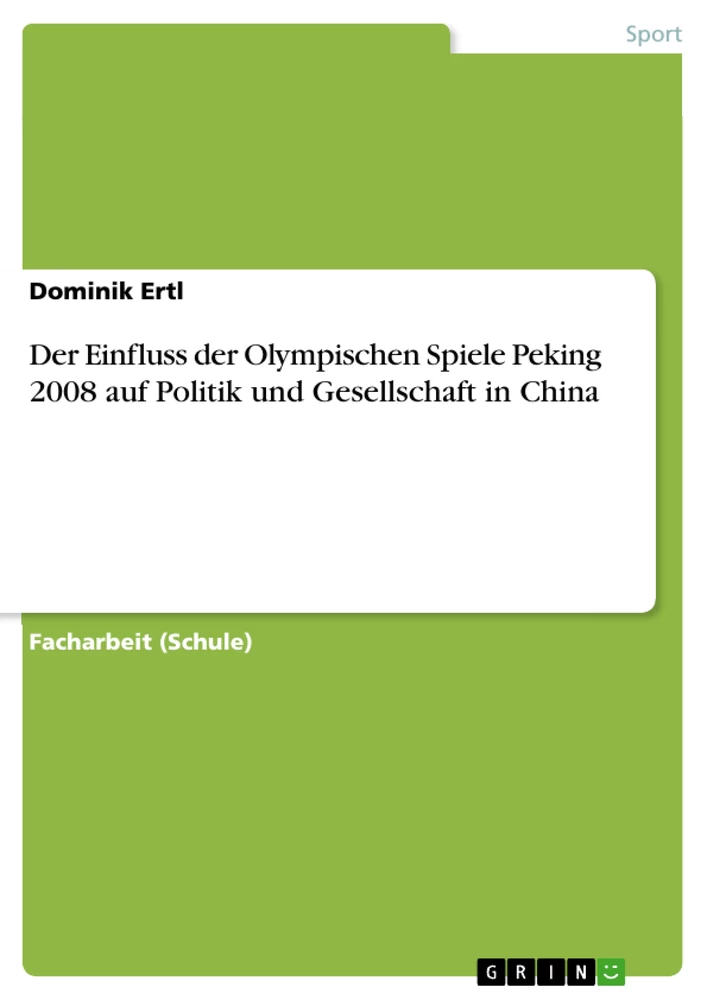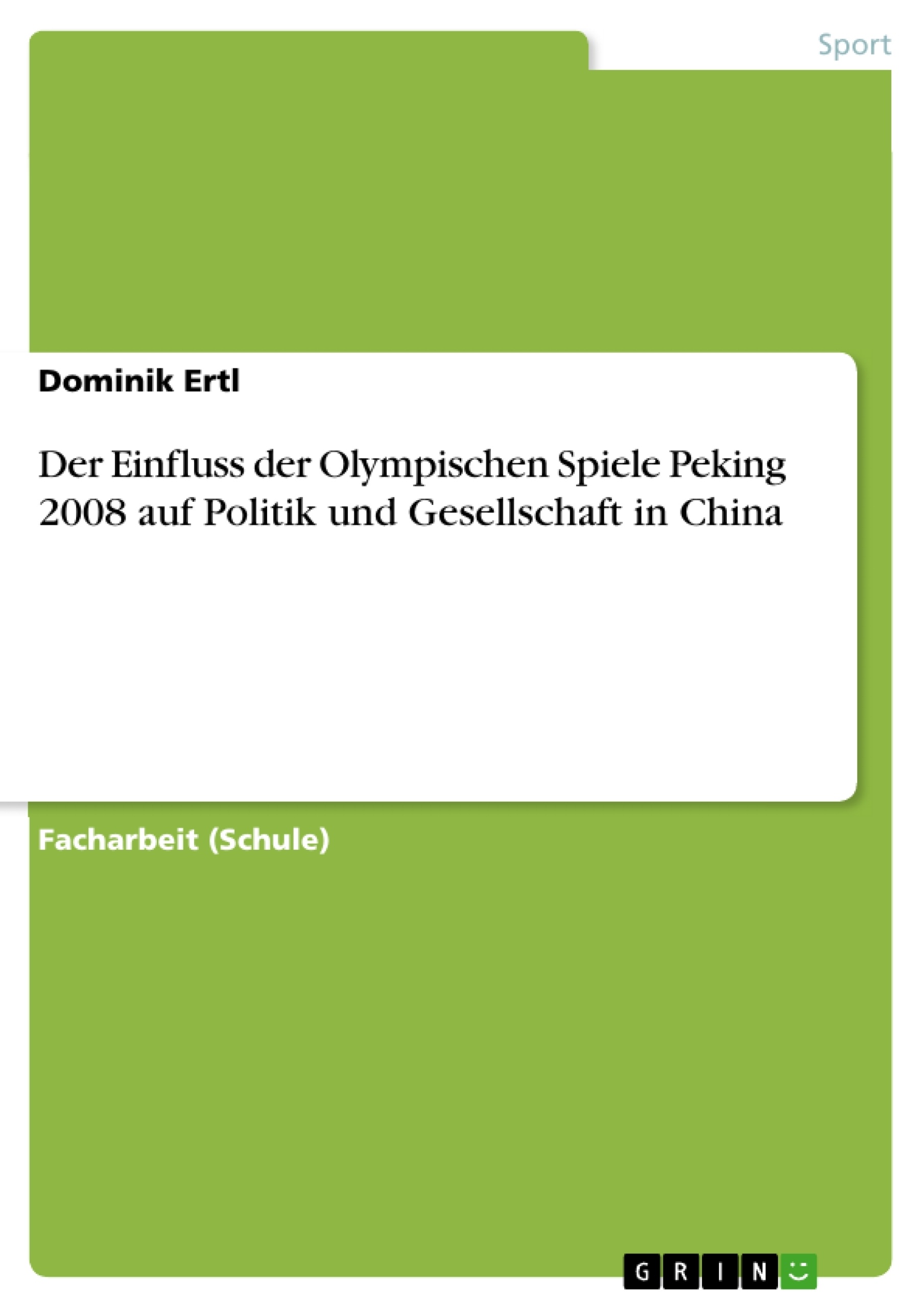„Von den Völkern zu verlangen, dass sie einander lieben, ist eine Art von Kinderei. Von ihnen zu fordern, einander zu achten, ist keines-wegs Utopie; aber um einander zu achten, muss man sich erst kennen lernen.“ Dieses Zitat von Pierre de Coubertin gibt in wenigen Sätzen den Grundgedanken der Olympischen Idee wieder. Coubertin, der als Begründer der neuzeitlichen Olympischen Spiele gilt, sah diese als einen Ort, bei dem verschiedene Kulturen aufeinander treffen. Durch sie soll es zu einer Völkerverständigung kommen. In Anlehnung an die Waffenruhe, die während der Olympischen Spiele der Antike herrschte, wollte er einen Frieden für die Spiele erreichen. Erst im Laufe der Zeit wurde aus der Aussage „Frieden für die Spiele“ die Aussage „Frieden durch die Spiele“. Durch die äußerst umstrittene Vergabe der Olympischen Spiele 2008 nach Peking, „in den weltweit inzwischen mächtigsten Hort von Menschenrechtsverletzungen, Demokratiefeindlichkeit und Umweltverschmutzung“ , versuchte das IOC diesen Grundgedanken zu verwirklichen. China sollte sich durch dieses mediale Großereignis für die Welt öffnen und durch die Sorge um das eigene Image empfänglicher für Kritik an ihrer Menschenrechtspolitik werden. Aber können durch Olympische Spiele die Verhältnisse in einem von Diktatur geprägten Land überhaupt verbessert werden? Das Beispiel der Olympischen Spiele 1988 in Seoul zeigt, dass dies durchaus möglich ist. „Die einstige Militärdiktatur ist heute eine lebendige, gefestigte Demokratie. Der Durchbruch aber kam mit einem sportlichen Ereignis. Die überaus erfolgreichen Olympischen Spiele von 1988 waren Südkoreas erster gewaltiger Schritt in die Welt, heraus aus dem tiefen Schatten Japans und des Koreakriegs.“
Doch welchen Einfluss hatten die Olympischen Spiele 2008 in Peking auf Gesellschaft und Politik in China?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ausgangslage in China
- 2.1 Grundwesenszüge der chinesischen Kultur
- 2.1.1 Harmonie
- 2.1.2 Gesicht
- 2.1.3 Gruppendenken
- 2.1.4 Hierarchiebewusstsein und Ritualisierung
- 2.1.5 Sinozentrismus
- 2.2 Situation Chinas vor der Vergabe der Olympischen Spiele
- 2.2.1 Politisches System
- 2.2.2 Umweltpolitik
- 2.2.3 Menschenrechtssituation
- 2.2.3.1 Todesstrafe
- 2.2.3.2 Unterdrückung spiritueller und religiöser Gruppen
- 2.2.3.3 Konzentrationslager (Laogai)
- 2.2.3.4 Zensur
- 3. Von der Vergabe bis zur Eröffnung der Olympischen Spiele
- 3.1 Vorbereitung auf die Olympischen Spiele
- 3.2 Maßnahmen zum Umweltschutz
- 3.3 Entwicklung der Menschenrechte
- 3.3.1 Todesstrafe
- 3.3.2 Zensur
- 3.3.3 Der Tibet-Konflikt
- 3.4 Der Fackellauf
- 4. Die Olympischen Spiele – Ein Fest der Lügen
- 4.1 Umweltschutz während der Spiele
- 4.2 Menschenrechte während der Spiele
- 4.2.1 Zensur
- 4.2.2 „Säuberung“ Pekings
- 4.2.3 Todesstrafe
- 4.2.4 Chinas Lügenolympiade
- 4.2.5 Der Fall „Fang Zheng“
- 5. China nach den Olympischen Spielen
- 5.1 Todesstrafe
- 5.2 Liu Xiaobo
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit untersucht den Einfluss der Olympischen Spiele 2008 in Peking auf die Politik und Gesellschaft Chinas. Ziel ist es, zu analysieren, inwieweit das Großereignis zu Veränderungen in den Bereichen Menschenrechte, Umweltpolitik und dem politischen System geführt hat. Die Arbeit beleuchtet, ob die Erwartungen an eine Öffnung Chinas durch die Spiele erfüllt wurden.
- Die Grundzüge der chinesischen Kultur und ihre Relevanz für die politische und gesellschaftliche Entwicklung.
- Die Menschenrechtssituation in China vor, während und nach den Olympischen Spielen.
- Die Rolle der Olympischen Spiele als Instrument der internationalen Politik und des Image-Managements.
- Der Einfluss der Spiele auf die Umweltpolitik Chinas.
- Die Kontroversen und Widersprüche im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Peking.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss der Olympischen Spiele 2008 auf China. Sie verweist auf das Ideal der Olympischen Spiele als Ort der Völkerverständigung und kontrastiert dieses mit der umstrittenen Vergabe an Peking, einen Staat mit erheblichen Menschenrechtsproblemen. Die Einleitung stellt die These auf, dass die Spiele durchaus einen Einfluss auf die politische und gesellschaftliche Entwicklung Chinas haben könnten, wie am Beispiel Südkoreas gezeigt wird, und kündigt die Struktur der Arbeit an.
2. Ausgangslage in China: Dieses Kapitel beschreibt die kulturellen und politischen Gegebenheiten in China vor den Olympischen Spielen. Es analysiert grundlegende Wesenszüge der chinesischen Kultur wie Harmonie, Gesichtswahrung, Gruppendenken und Hierarchiebewusstsein. Weiterhin beleuchtet es die politische Situation, die Umweltpolitik und die Menschenrechtssituation, inklusive der Todesstrafe, der Unterdrückung religiöser Gruppen und der Zensur, um den Kontext für die anschließende Analyse des Einflusses der Spiele zu schaffen. Das Kapitel zeichnet ein umfassendes Bild des Status quo in China vor dem Großereignis.
3. Von der Vergabe bis zur Eröffnung der Olympischen Spiele: Dieses Kapitel analysiert die Phase der Vorbereitung auf die Spiele. Es befasst sich mit Maßnahmen zum Umweltschutz, der Entwicklung der Menschenrechte (insbesondere bezüglich der Todesstrafe und Zensur) und dem Tibet-Konflikt im Vorfeld des Ereignisses. Die Analyse des Fackellaufs zeigt die internationale Aufmerksamkeit, die auf die Menschenrechtslage gelenkt wurde. Das Kapitel untersucht also den Zeitraum zwischen der Vergabe und der Eröffnung der Spiele und wie China auf die damit verbundenen Herausforderungen reagierte.
4. Die Olympischen Spiele – Ein Fest der Lügen: Dieses Kapitel analysiert die Olympischen Spiele selbst kritisch und setzt sich mit den Widersprüchen zwischen dem propagierten Image und der Realität auseinander. Es beleuchtet den Umweltschutz während der Spiele, die Menschenrechtslage (einschließlich der Zensur und der "Säuberung" Pekings), und den Fall Fang Zheng als Beispiel für die Unterdrückung von Kritik. Der Titel des Kapitels deutet bereits auf eine kritische Bewertung der Veranstaltung hin, welche im Detail erläutert wird.
5. China nach den Olympischen Spielen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Situation in China nach Beendigung der Spiele. Es analysiert die anhaltende Anwendung der Todesstrafe und den Fall Liu Xiaobo als Beispiel für den Umgang mit politischem Widerstand. Der Fokus liegt auf der Frage, ob und inwiefern sich die Situation in Bezug auf Menschenrechte und politische Freiheiten nach dem Großereignis verändert hat.
Schlüsselwörter
Olympische Spiele Peking 2008, China, Menschenrechte, Umweltpolitik, Politisches System, Chinesische Kultur, Zensur, Todesstrafe, Tibet-Konflikt, Völkerverständigung, Image-Management, Liu Xiaobo, Fang Zheng.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Facharbeit: "Der Einfluss der Olympischen Spiele 2008 in Peking auf die Politik und Gesellschaft Chinas"
Was ist der Gegenstand dieser Facharbeit?
Die Facharbeit untersucht den Einfluss der Olympischen Spiele 2008 in Peking auf die Politik und Gesellschaft Chinas. Sie analysiert Veränderungen in den Bereichen Menschenrechte, Umweltpolitik und politisches System und bewertet, ob die Erwartungen an eine Öffnung Chinas durch die Spiele erfüllt wurden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Grundzüge der chinesischen Kultur und deren Relevanz, die Menschenrechtssituation vor, während und nach den Spielen, die Rolle der Spiele im internationalen Kontext und als Instrument des Image-Managements, den Einfluss auf die Umweltpolitik und die Kontroversen um die Spiele in Peking.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Ausgangslage in China, Von der Vergabe bis zur Eröffnung, Die Olympischen Spiele – Ein Fest der Lügen, China nach den Olympischen Spielen und Fazit. Jedes Kapitel beleuchtet einen spezifischen Aspekt des Themas.
Wie wird die chinesische Kultur in der Arbeit berücksichtigt?
Die Arbeit analysiert grundlegende Wesenszüge der chinesischen Kultur wie Harmonie, Gesichtswahrung, Gruppendenken und Hierarchiebewusstsein, um den Kontext für die politische und gesellschaftliche Entwicklung zu verstehen und den Einfluss der Spiele besser beurteilen zu können.
Wie wird die Menschenrechtssituation in China behandelt?
Die Menschenrechtssituation wird vor, während und nach den Spielen untersucht. Dabei werden Aspekte wie Todesstrafe, Unterdrückung religiöser Gruppen, Zensur, der Tibet-Konflikt und die "Säuberung" Pekings beleuchtet. Konkrete Fälle wie der von Fang Zheng und Liu Xiaobo werden als Beispiele angeführt.
Welche Rolle spielen die Olympischen Spiele im Kontext der internationalen Politik?
Die Arbeit betrachtet die Spiele als Instrument der internationalen Politik und des Image-Managements für China. Der Fackellauf wird als Beispiel für die internationale Aufmerksamkeit auf die Menschenrechtslage genannt. Die Arbeit hinterfragt die Diskrepanz zwischen dem propagierten Image und der Realität.
Wie wird die Umweltpolitik Chinas im Zusammenhang mit den Spielen betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Maßnahmen zum Umweltschutz vor, während und während der Spiele und bewertet deren Wirksamkeit. Sie untersucht, ob und inwieweit die Spiele einen positiven oder negativen Einfluss auf die Umweltpolitik Chinas hatten.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bewertet, inwieweit die Olympischen Spiele 2008 einen nachhaltigen Einfluss auf die Politik und Gesellschaft Chinas hatten. Es wird untersucht, ob die Erwartungen an eine Öffnung Chinas durch die Spiele erfüllt wurden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Olympische Spiele Peking 2008, China, Menschenrechte, Umweltpolitik, Politisches System, Chinesische Kultur, Zensur, Todesstrafe, Tibet-Konflikt, Völkerverständigung, Image-Management, Liu Xiaobo, Fang Zheng.
Wo finde ich mehr Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Zusammenfassung der Kapitel im Dokument bietet detailliertere Informationen zu den einzelnen Abschnitten und ihrer jeweiligen Thematik. Es wird der Inhalt jedes Kapitels prägnant beschrieben.
- Quote paper
- Dominik Ertl (Author), 2010, Der Einfluss der Olympischen Spiele Peking 2008 auf Politik und Gesellschaft in China, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169331