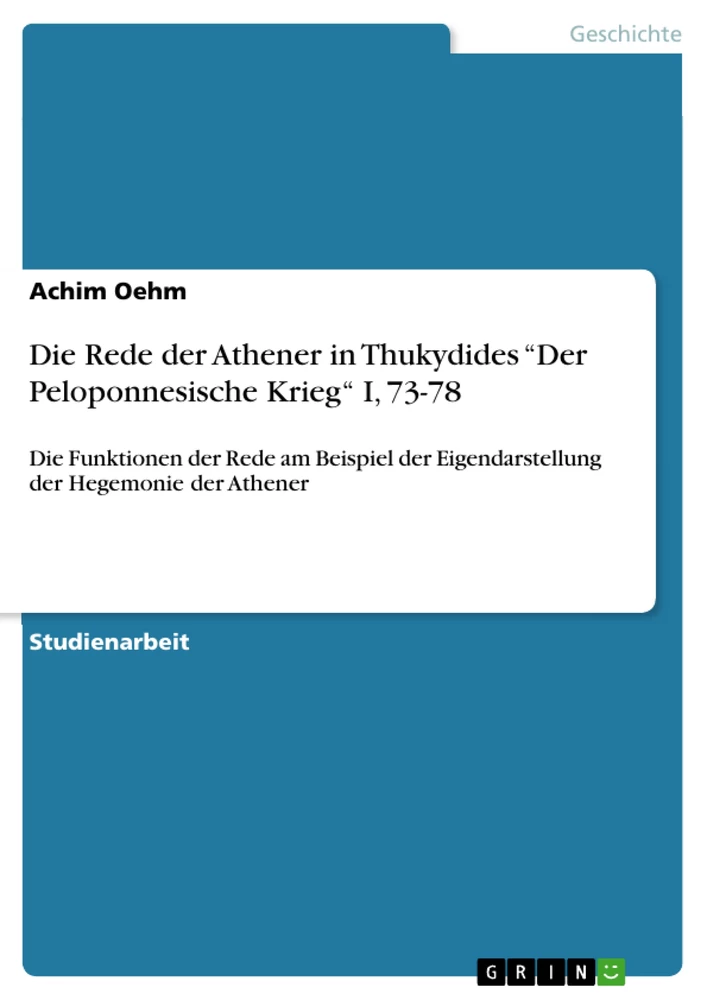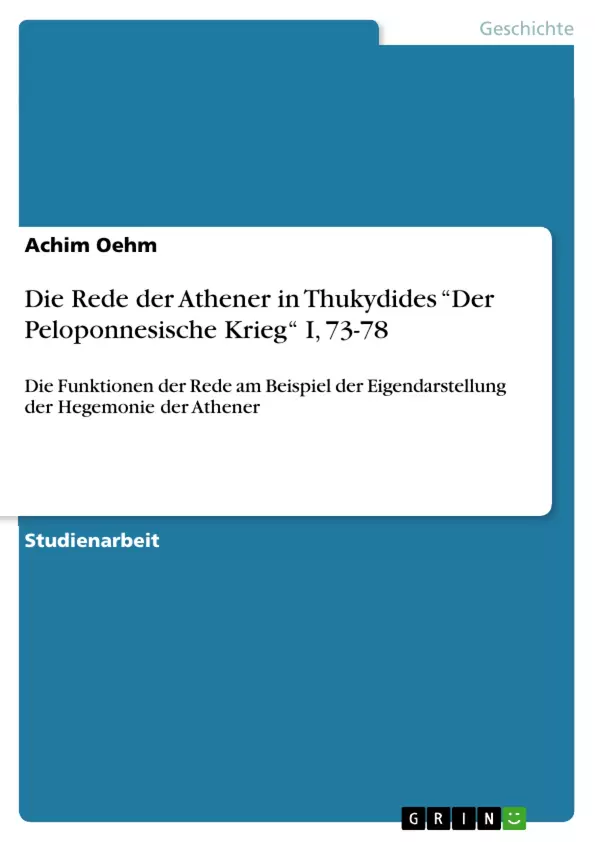Thukydides, griechischer Geschichtsschreiber, hinterlässt uns ein sehr wichtiges Werk der Antike: Der Peloponnesische Krieg. Bei der Lektüre fällt auf, dass der Autor seine methodischen Grundsätze der Geschichtsschreibung in den ersten Kapiteln (22 und 23 sollen hier betrachtet werden) seines Buches erklärt. Anfang des 22. Kapitels schreibt er, dass “was nun in Reden beide Gegner vorgebracht haben, teils während der Vorbereitungen zum Krieg, teils im Krieg selber, davon den genauen Wortlaut im Gedächtnis zu behalten, war schwierig, sowohl für [ihn], was [er] selber anhörte, als auch für [seine] Zeugen, die [ihm] von anderswo solche berichteten. Wie aber [seiner] Meinung nach jeder Einzelne über den jeweils vorliegenden Fall am ehesten sprechen musste, so sind die Reden wiedergegeben unter möglichst engem Anschluss an den Gesamtsinn des wirklich Gesagten.“. Man merkt auch, dass die Reden nicht wortwörtlich wiedergegeben wurden, da sie alle im gleichen, Thukydides eigenen, Stil verfasst sind. Aber sie spiegeln nicht seine eigenen Ansichten wieder. “Indem Thukydides das Gleichgewicht zwischen dem “allgemeinen Sinn des wirklich vorgetragenen“ und dem “nach seiner Meinung der Situation angemessenen“ aufrechterhält, schafft er aus den Reden ein vorzügliches Instrument einer Interpretation, die gleichsam in der Faktizität des realen Geschehens fest verankert bleibt.“
Des Weiteren beschreibt er in diesen “Methodenkapiteln“, dass er die Kriegsverlaufsschilderungen so detailgenau überprüft habe, wie möglich und somit “das erzählerische Element“ weitgehend fehlt. Man kann also sagen, dass Thukydides durchaus versucht hat, historisch korrekt und realistisch zu berichten, dennoch aber selbst einräumt, sich gerade bei den Reden (vermutlich vor allem, bei denen er nicht persönlich anwesend war) doch sehr seinen eigenen Vermutungen zu bedienen. Der Peloponnesische Krieg lässt sich formal also in zwei methodische Teile gliedern: 1. Die durchlaufende Kriegserzählung und
2. Die verschiedenen Reden der beteiligten Völker und Personen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Die Bedeutung der Reden im Peloponnesischen Krieg
- Exkurs: Quellen- und Literaturlage
- Einordnung der Rede der Athener in den historischen Kontext
- Die Rede der Athener in Sparta in Thukydides I, 73-78.
- Das Vorwort zur Rede
- Die Perserkriege - Heldentaten der Athener
- Die Hegemoniestellung und deren Begründung durch Athen
- Athens Herrschaftsausübung
- Epilog.
- Fazit....
- Bibliographie und Quellenverzeichnis.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht die Rede der Athener in Thukydides' "Der Peloponnesische Krieg" (I, 73-78). Das Ziel ist es, die Funktionen dieser Rede zu analysieren, insbesondere wie die Athener ihre Hegemonie im delisch-attischen Seebund darstellen und begründen.
- Die Bedeutung der Reden im Peloponnesischen Krieg
- Die Darstellung der attischen Hegemonie
- Die Begründung der attischen Hegemonie
- Die Funktionen der Rede als Instrument der Machtpolitik
- Der historische Kontext der Rede
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Reden im Peloponnesischen Krieg und die methodischen Grundsätze von Thukydides. Der Exkurs befasst sich mit der Quellen- und Literaturlage, wobei die Aktualität der Sekundärliteratur kritisch betrachtet wird. Die Einordnung der Rede der Athener in den historischen Kontext führt in die Thematik ein. Der Hauptteil analysiert die Rede selbst, wobei das Vorwort, die Darstellung der Perserkriege, die Begründung der Hegemonie und die Herrschaftsausübung der Athener im Fokus stehen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen des Peloponnesischen Krieges, der attischen Hegemonie, der Reden als Mittel der Machtpolitik, dem historischen Kontext der Rede und der Methodologie von Thukydides. Insbesondere die Rede der Athener im ersten Buch von Thukydides steht im Mittelpunkt der Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Wie authentisch sind die Reden in Thukydides' Werk „Der Peloponnesische Krieg“?
Thukydides gibt an, dass er die Reden unter möglichst engem Anschluss an den Gesamtsinn wiedergibt, räumt aber ein, dass er sie dem jeweiligen Fall angemessen stilistisch angepasst hat.
Was ist das Ziel der „Rede der Athener“ in Sparta (I, 73-78)?
Die Athener versuchen, ihre Hegemonie im delisch-attischen Seebund zu rechtfertigen, indem sie auf ihre Verdienste in den Perserkriegen verweisen.
Welche methodischen Grundsätze verfolgte Thukydides?
Er unterschied zwischen der detailgenauen Kriegserzählung und den Reden, die als Instrument der Interpretation und Darstellung politischer Macht dienen.
Wie begründet Athen seine Herrschaftsausübung?
Die Begründung basiert auf dem Recht des Stärkeren, dem Glanz ihrer Heldentaten gegen die Perser und der Notwendigkeit, ihre Machtposition zu sichern.
Welche Rolle spielen die Perserkriege in der Rede?
Sie dienen als moralische und historische Legitimation für den Führungsanspruch Athens gegenüber den anderen griechischen Stadtstaaten.
- Quote paper
- Achim Oehm (Author), 2009, Die Rede der Athener in Thukydides “Der Peloponnesische Krieg“ I, 73-78, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169270