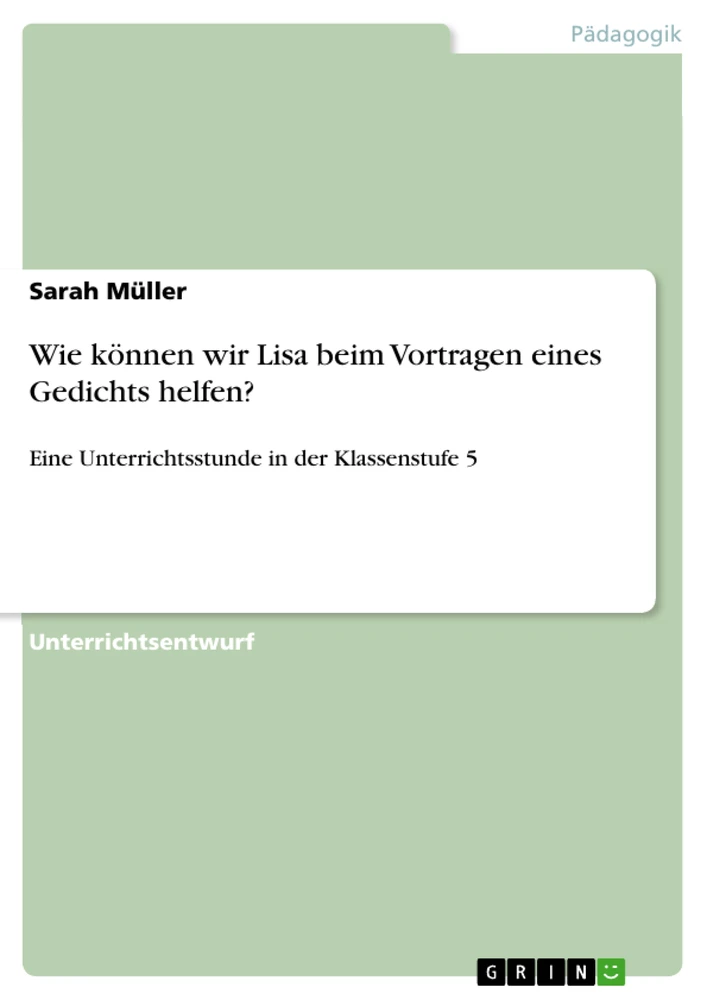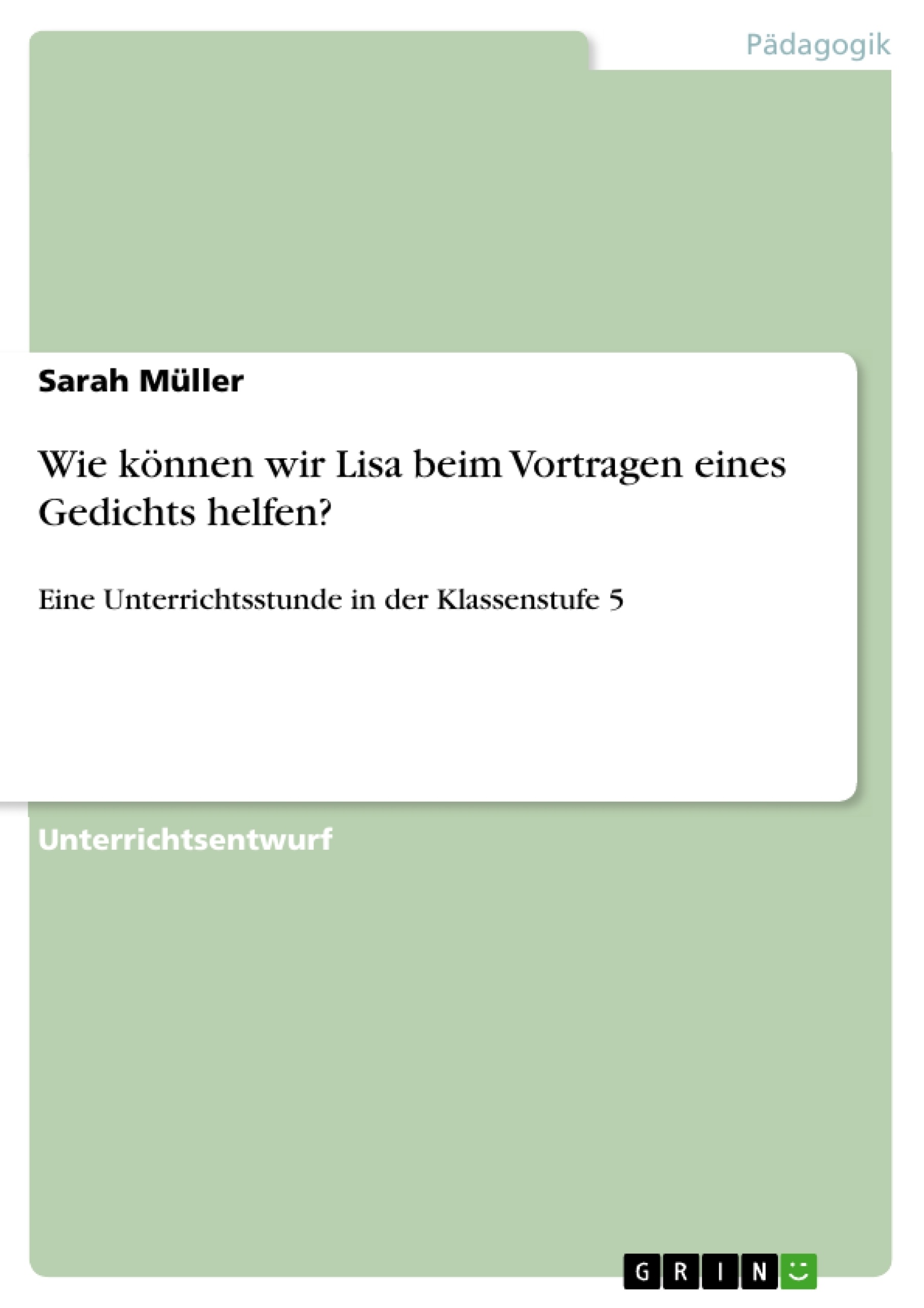Die heutige Stunde gliedert sich als 10. Stunde in die Einheit Welche Erfahrungen können wir beim Sprechen und Hören von lyrischen Texten machen? ein. Der Schwerpunkt der Unterrichtseinheit liegt auf dem Einfühlen in Gedichte. Die Handlungs- und Produktionsorientierung der Einheit bietet den SuS die Möglichkeit sich selbst auszuprobieren. Den SuS soll bewusst werden, dass aus der unterschiedlichen Betonung von Wörtern in Versen eine Bedeutungsveränderung resultierenden kann. Die SuS lernen, dass und warum es sinnvoll ist Pausen zu machen. Im Vordergrund steht dabei das Vortragen, denn „viele Gedichte kommen erst im Vortrag zur Wirkung“ . Spinner fordert , dass das spielerische und experimentierende Vortragen von Gedichten besondere Berücksichtigung finden soll. Durch das eigene Experimentieren mit Sprechweisen werden die subjektiven Anteile des Verstehensprozesses betont , denn es gibt immer verschiedene Möglichkeiten der Realisierung. Dabei spielen „das erlebnishafte Aneignen von Sprache […], das Ausprobieren von Betonungen, die Stimmmodulation und die Intonation von Gedichten“ eine Rolle. Jedes Vortragen ist immer schon ein Akt der Textdeutung und meist sind mehrere Lösungen möglich, wenn es auch wahrscheinlichere und unwahrscheinlichere Lösungen gibt. Durch das Ausprobieren verschiedener Sprechweisen wird auch der Forderung der Bildungsstandards Rechnung getragen, dass die SuS am Ende der Jahrgangsstufe 6 vorbereitete Redebeiträge leisten können, indem sie „bekannte und kurze unbekannte Texte zügig und gestaltend vorlesen und vortragen“ .
Inhaltsverzeichnis
- 1. Lernbedingungen
- 1.1 Lerngruppenbeschreibung
- 1.2 Lernvoraussetzungen – Lernausgangslage und Lernstand
- 2. Didaktische Überlegungen
- 2.1 Didaktische Begründung des Themas
- 2.2 Didaktische Analyse des Materials
- 2.3 Didaktisches Zentrum der Stunde
- 3. Methodische Überlegungen zur Stunde
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist die Darstellung einer Unterrichtsstunde zum Thema Gedichtvortrag in einer heterogenen 5. Klasse. Es wird gezeigt, wie die Lerngruppe und deren Voraussetzungen die methodische und didaktische Planung beeinflussen. Im Mittelpunkt steht die Unterstützung von Schülern beim Vortragen eines Gedichts und die Berücksichtigung der individuellen Lernstände.
- Heterogenität im Unterricht
- Didaktische und methodische Gestaltung des Gedichtvortrags
- Förderung der individuellen Lernstände
- Differenzierte Lernangebote
- Kooperatives Lernen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Lernbedingungen: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Lerngruppe, bestehend aus 14 Schülerinnen und 13 Schülern einer 5. Klasse. Die Heterogenität der Klasse wird hervorgehoben, wobei einige Schüler sehr interessiert und aufmerksam mitarbeiten, während andere große Schwierigkeiten haben, den Unterrichtsinhalten zu folgen. Es werden verschiedene Maßnahmen erwähnt, um der Heterogenität Rechnung zu tragen, wie binnendifferenziertes Arbeiten und kooperative Lernformen. Zusätzlich werden die Vorerfahrungen der Schüler mit Gedichtanalyse und -vortrag geschildert, einschließlich eines jüngsten Vorfalls von Cybermobbing in der Klasse, der die Gruppenbildung beeinflusst. Das Kapitel endet mit einer Darstellung des Lernstands der Schüler in Bezug auf das Thema der Unterrichtseinheit, welche bereits erarbeitete Konzepte zum Gedichtverstehen und -gestalten aufzeigt.
2. Didaktische Überlegungen: In diesem Kapitel werden die didaktischen Begründungen für die Thematik der Unterrichtsstunde erläutert. Der Fokus liegt auf dem Einfühlen in Gedichte und dem spielerischen Experimentieren mit Sprechweisen. Es wird die Bedeutung des Gedichtvortrags als einen Akt der Textdeutung hervorgehoben, bei dem verschiedene Interpretationen und Realisierungen möglich sind. Die didaktische Analyse betont die Notwendigkeit, die Schüler beim Ausprobieren verschiedener Betonungen, Stimmmodulationen und Intonationen zu unterstützen und so ihre Fähigkeiten im gestaltenden Vorlesen und Vortragen zu fördern. Die Überlegungen berücksichtigen die Bildungsstandards und zielen darauf ab, die Schüler auf das vorbereitete Vortragen von Texten vorzubereiten. Des Weiteren wird die Bedeutung des aktiven Zuhörens und der Rezeption des Gedichtvortrags in einer von Geräuschen geprägten Lebenswelt thematisiert.
Schlüsselwörter
Gedichtvortrag, Heterogenität, Didaktik, Methodik, Differenzierung, Kooperatives Lernen, Lernvoraussetzungen, Sprechweisen, Lyrik, Bildungsstandards, Deutschunterricht, Klasse 5.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Unterrichtsentwurf: Gedichtvortrag in der 5. Klasse
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist ein umfassender Unterrichtsentwurf für eine Gedichtvortragsstunde in einer heterogenen 5. Klasse. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel (Lernbedingungen und didaktische Überlegungen) und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden im Unterrichtsentwurf behandelt?
Der Entwurf behandelt die didaktische und methodische Gestaltung des Gedichtvortrags in einer heterogenen Lerngruppe. Schwerpunkte sind die Berücksichtigung individueller Lernstände, die Förderung durch differenzierte Lernangebote und kooperatives Lernen, sowie die Auseinandersetzung mit der Heterogenität im Unterricht. Die Bedeutung des aktiven Zuhörens und die Vorbereitung auf das Vortragen von Texten werden ebenfalls thematisiert.
Wie wird die Heterogenität der Lerngruppe berücksichtigt?
Die Heterogenität der Klasse (14 Mädchen und 13 Jungen) mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und -ständen wird explizit angesprochen. Der Entwurf schlägt Maßnahmen wie binnendifferenziertes Arbeiten und kooperative Lernformen vor, um allen Schülern gerecht zu werden. Ein jüngster Vorfall von Cybermobbing wird als Einflussfaktor auf die Gruppenbildung erwähnt.
Welche didaktischen Überlegungen liegen dem Entwurf zugrunde?
Der didaktische Fokus liegt auf dem spielerischen Experimentieren mit Sprechweisen und dem Einfühlen in Gedichte. Der Gedichtvortrag wird als Akt der Textdeutung verstanden, der verschiedene Interpretationen und Realisierungen ermöglicht. Die didaktische Analyse betont die Unterstützung der Schüler beim Ausprobieren verschiedener Betonungen, Stimmmodulationen und Intonationen, um ihre Fähigkeiten im gestaltenden Vorlesen zu fördern. Die Bildungsstandards werden berücksichtigt.
Welche methodischen Überlegungen werden angestellt?
Der Entwurf beschreibt methodische Ansätze, die auf die Förderung der individuellen Lernstände und die Berücksichtigung der Heterogenität abzielen. Konkrete Methoden werden zwar nicht detailliert genannt, aber die Verwendung von binnendifferenzierten Aufgaben und kooperativen Lernformen wird angedeutet. Die Bedeutung des aktiven Zuhörens wird hervorgehoben.
Welche Kapitel umfasst der Unterrichtsentwurf?
Der Entwurf gliedert sich in die Kapitel "Lernbedingungen" (Beschreibung der Lerngruppe, Lernvoraussetzungen und Lernstand) und "Didaktische Überlegungen" (didaktische Begründung, Analyse des Materials und didaktisches Zentrum der Stunde), sowie ein Kapitel zu methodischen Überlegungen. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Unterrichtsentwurf?
Schlüsselwörter sind: Gedichtvortrag, Heterogenität, Didaktik, Methodik, Differenzierung, Kooperatives Lernen, Lernvoraussetzungen, Sprechweisen, Lyrik, Bildungsstandards, Deutschunterricht, Klasse 5.
Für wen ist dieser Unterrichtsentwurf gedacht?
Dieser Unterrichtsentwurf ist für Lehrkräfte im Deutschunterricht gedacht, die eine Unterrichtsstunde zum Thema Gedichtvortrag in der 5. Klasse planen. Er bietet eine strukturierte Vorlage und Hilfestellung bei der didaktischen und methodischen Gestaltung der Stunde.
- Arbeit zitieren
- Sarah Müller (Autor:in), 2011, Wie können wir Lisa beim Vortragen eines Gedichts helfen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169265