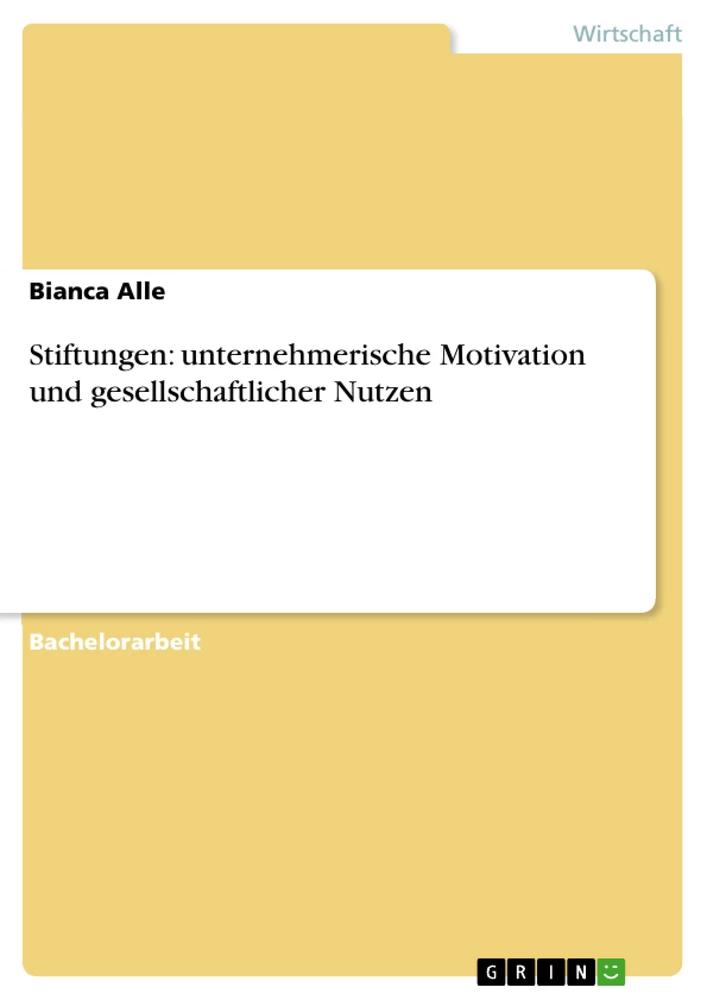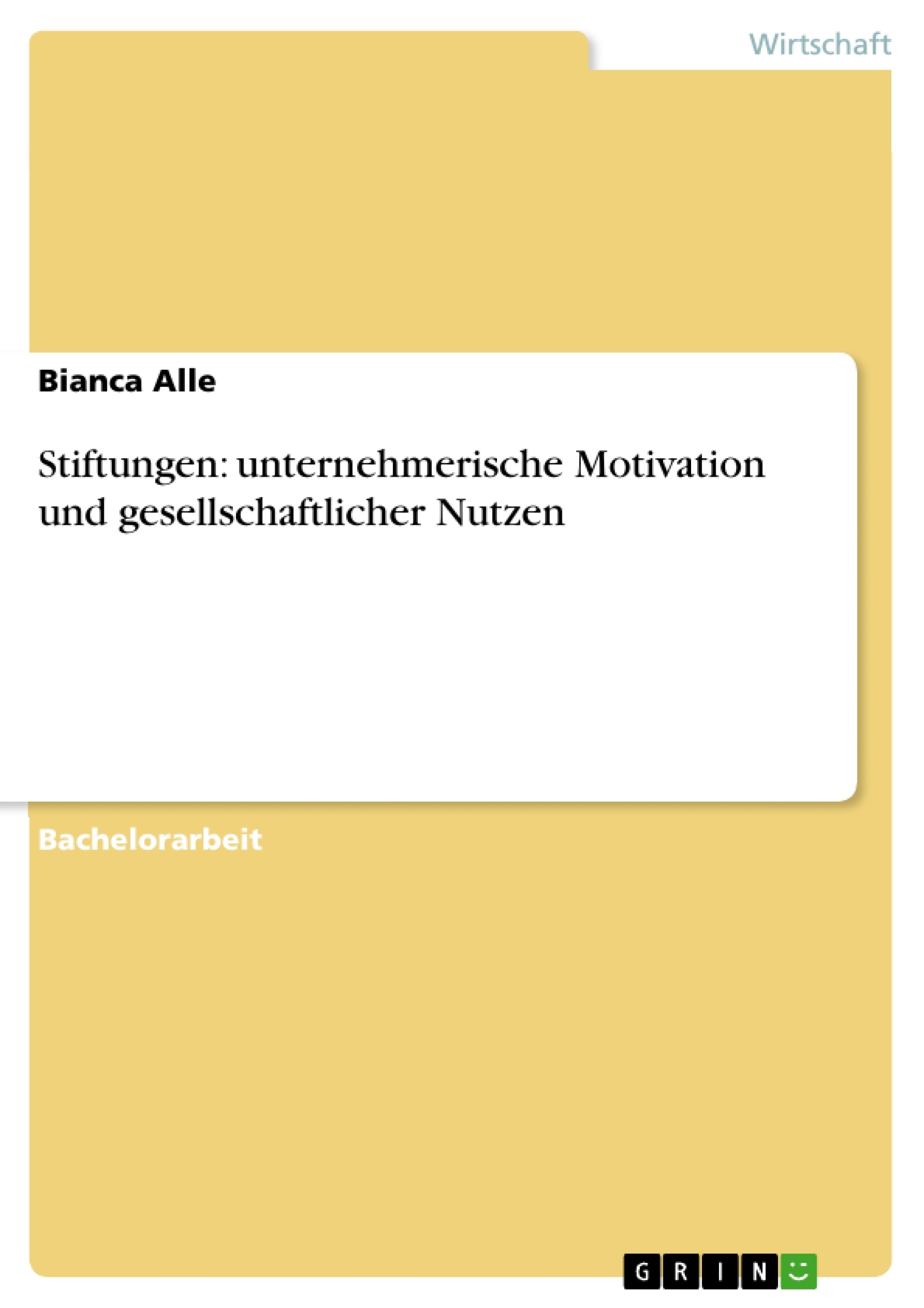Im ersten Teil dieser Arbeit soll ein erster Eindruck entstehen, wie, wann und weswegen Stiftungen in der Vergangenheit in erster Linie entstanden. Dabei soll deutlich werden, dass Stiftungen in der Antike und im römischen Kaiserreich ursprünglich sehr wohl aus eigennützigen Motiven erwuchsen, dass sich diese Einstellung jedoch mit dem Ende des römischen Kaiserreiches und mit dem Anfang des Mittelalter änderte und sich das Stiftungswesen ab diesem Zeitalter von einem geistlichen in ein weltliches Stiftungswesen wandelte.
Anschließend soll die rechtliche Beschaffenheit des deutschen Stiftungswesens erläutert werden. Die verschiedenen Stiftungsrechtsformen sollen voneinander abgegrenzt werden und es wird ein kurzer Exkurs in die unterschiedlichen Stiftungsarten dargestellt.
Mit dem vierten Kapitel wird näher auf die Stiftungsgestaltung im Unternehmensbereich eingegangen. Anhand der unterschiedlichen Gestaltungsformen unternehmensverbundener Stiftungen sollen die Motive zur Stiftungsgründung in der Wirtschaft dargestellt werden. Einen besseren Einblick in die Motive unternehmensverbundener Stiftungen soll exemplarisch anhand drei großer deutscher Stifterpersönlichkeiten geschaffen werden. Anschließend soll eine Studie des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen und der Bertelsmann Stiftung Vorurteile gegenüber dem Stiftungswesen widerlegen.
Dieses Kapitel soll somit sowohl die unternehmenspolitischen (eigennützigen) Motive zur Stiftungsgründung in der Wirtschaft herausarbeiten, jedoch auch darstellen, dass diese nicht die vordere Rolle, sowohl beim privaten, als auch beim unternehmerischen Stiften, spielen. Ausschlaggebend sind vor allen Dingen gemeinnützige Beweggründe.
Im anschließenden, fünften, Kapitel, möchte ich herausarbeiten welche positiven Auswirkungen das Stiftungswesen auf die deutsche Zivilgesellschaft hat, weswegen die moralischen Beweggründe Stiftungen zu errichten auch als „moralischer Imperativ“ bezeichnet werden könnten und konkrete Zahlen und Fakten darstellen, was Stiftungen in Deutschland leisten und unterstützen. Die Rolle der Stiftungen im Dritten Sektor soll verdeutlicht werden und Grafiken und Tabellen sollen einen Überblick über das Vermögen, die Ausgaben, die Verteilung und die Förderungszwecke von Stif¬tungen schaffen. Abschließend soll das Konzept der „Corporate Social Responsibility“ (kurz: CSR) und dessen Nutzen für die Gesellschaft in aller Kürze untersucht und kommentiert werden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Geschichtliche Entwicklung des Stiftungswesens und ursprüngliche Motive zur Errichtung von Stiftungen
- Antike Stiftungen: Übertragung von Vermögen und Verwaltung von Gotteseigentum
- Stiftungen zu Zeiten des römischen Kaiserreiches: Sicherung des Seelenheils und der Beginn der Wohltätigkeit
- Das Mittelalter als das Zeitalter der Stiftungen schlechthin
- Zeitstrahl deutscher Stiftungen: Vom Mittelalter bis in die Neuzeit
- Die verschiedenen Stiftungs-Rechtsformen
- Allgemeine Eigenschaften von Stiftungen
- Stiftungen öffentlichen Rechts: Der Staat als Stifter
- Die rechtsfähige Stiftung des Privatrechts (BGB-Stiftung)
- Gründung und Anerkennung einer rechtsfähigen Stiftung des privaten Rechts
- Das Stiftungsgeschäft unter Lebenden
- Das Stiftungsgeschäft von Todes wegen
- Exkurs: Die Bürgerstiftung – Kollektives bürgerschaftliches Engagement
- Nichtrechtsfähige, treuhänderische oder unselbstständige Stiftungen
- Merkmale treuhänderischer Stiftungen
- Exkurs: Kirchliche Stiftungen - Ausdruck religiöser Nächstenliebe
- Die rechtsfähige kirchliche Stiftung
- Die kirchliche Treuhandstiftung am Beispiel der evangelischen Landeskirchenstiftung Württemberg
- Unternehmerische Motivation zur Errichtung von Stiftungen
- Die Form der Unternehmensträgerstiftung
- Die Stiftung & Co. KG: Verbindung von Flexibilität und Kontinuität
- Die Form der Beteiligungsträgerstiftung
- Die Familienstiftung: Bestandssicherung von Familienunternehmen und Förderung der eigenen Nachkommen
- Familienstiftungen mit eingebundener Wohltätigkeitsfunktion
- Die (gemeinnützige) Stiftungs-GmbH: „,der Name macht's!“
- Vorteile der gemeinnützigen Stiftungs-GmbH gegenüber rechtsfähigen Stiftungen
- Die Familienstiftung: Bestandssicherung von Familienunternehmen und Förderung der eigenen Nachkommen
- Die Form der Doppelstiftung
- Bekannte unternehmensverbundene Stiftungen und die Motive ihrer Stiftungsväter
- Die Carl-Zeiss-Stiftung 1889 – 2004 und heute
- Die Bertelsmann Stiftung
- Die Robert Bosch Stiftung GmbH
- Der Blick über die unternehmerischen Vorteile hinaus: Was Menschen allgemein zum Stiften motiviert
- Gründungsmotive in der Realität: Eine Studie des BDS und der Bertelsmann Stiftung
- Die Form der Unternehmensträgerstiftung
- Stiftungen und ihr Nutzen für die Gesellschaft
- Der moralische Imperativ des Stiftens
- Das Stiftungswesen als wachsender Akteur im Dritten Sektor
- Stiftungserrichtungen 1960 – 2009
- Zivilgesellschaftliches Engagement in Zahlen
- Die größten Stiftungen privaten Rechts nach Vermögen
- Die größten Stiftungen privaten Rechts nach Gesamtausgaben
- Stiftungsaufkommen nach Großstädten und Bundesländern
- Verteilung der Stiftungszweckhauptgruppen im Stiftungsbestand
- Unternehmen übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft: Corporate Social Responsibility (CSR) und Corporate Citizenship (CC)
- Wie äußern sich CSR und CC im Unternehmensbereich?
- CSR in der Kritik: Strategie für das Gemeinwohl oder strategisches Marketing?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Stiftungen. Sie beleuchtet sowohl die geschichtliche Entwicklung des Stiftungswesens als auch die verschiedenen Rechtsformen, die im deutschen Recht existieren. Ein besonderer Fokus liegt auf der Motivation von Unternehmern, Stiftungen zu errichten, sowie auf dem gesellschaftlichen Nutzen, den Stiftungen generieren können.
- Die historische Entwicklung des Stiftungswesens
- Die verschiedenen Rechtsformen von Stiftungen
- Unternehmerische Motivation zur Stiftungsgründung
- Der gesellschaftliche Nutzen von Stiftungen
- Der Zusammenhang zwischen Stiftungen und Corporate Social Responsibility (CSR)
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 2 befasst sich mit der historischen Entwicklung des Stiftungswesens. Es werden die Anfänge des Stiftungswesens in der Antike und im römischen Kaiserreich beleuchtet, wobei der Fokus auf der Übertragung von Vermögen und der Verwaltung von Gotteseigentum liegt. Kapitel 3 widmet sich den verschiedenen Rechtsformen von Stiftungen. Es werden die Eigenschaften von Stiftungen öffentlichen Rechts und die rechtsfähige Stiftung des Privatrechts erläutert, wobei die Gründung, Anerkennung und die unterschiedlichen Stiftungsgeschäfte im Detail dargestellt werden. Kapitel 4 untersucht die unternehmerischen Motivationen zur Errichtung von Stiftungen. Es werden verschiedene Formen von Unternehmensträgerstiftungen, Beteiligungsträgerstiftungen und Doppelstiftungen vorgestellt. Kapitel 5 befasst sich mit dem Nutzen von Stiftungen für die Gesellschaft. Es wird der moralische Imperativ des Stiftens erläutert, das Stiftungswesen als wachsender Akteur im Dritten Sektor dargestellt und die Zahlen zum zivilgesellschaftlichen Engagement in Deutschland präsentiert. Schließlich wird der Zusammenhang zwischen Stiftungen und Corporate Social Responsibility (CSR) beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Stiftungen, Stiftungswesen, Unternehmen, Unternehmer, Motivation, Gesellschaft, Nutzen, Rechtsform, Geschichte, Corporate Social Responsibility (CSR), Zivilgesellschaft, Treuhand, Gemeinnützigkeit
- Quote paper
- Bianca Alle (Author), 2010, Stiftungen: unternehmerische Motivation und gesellschaftlicher Nutzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169202