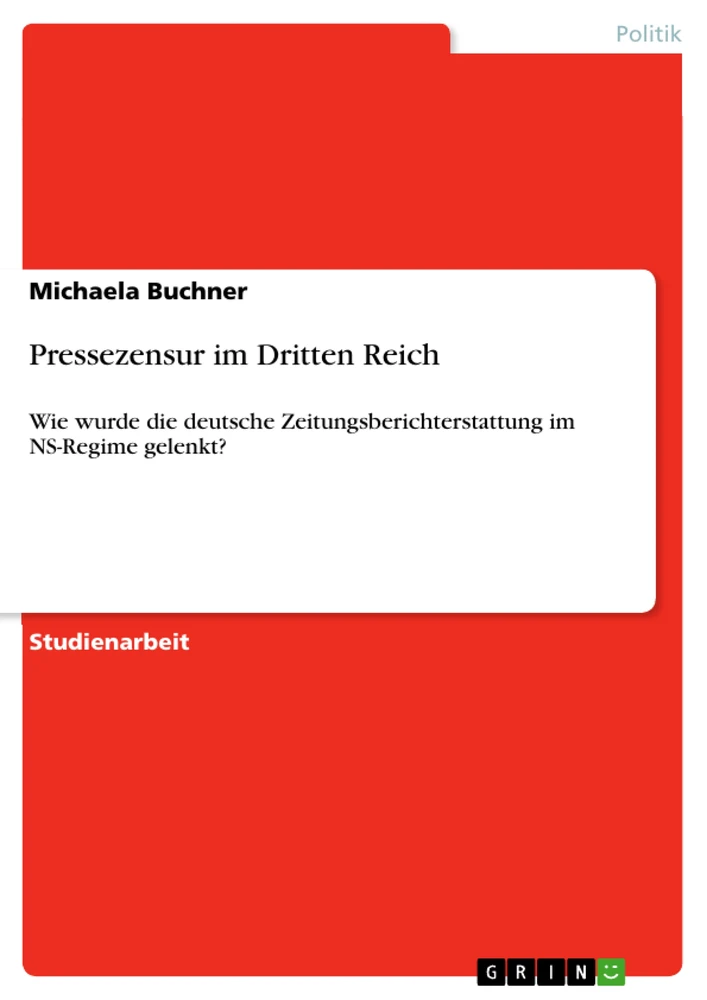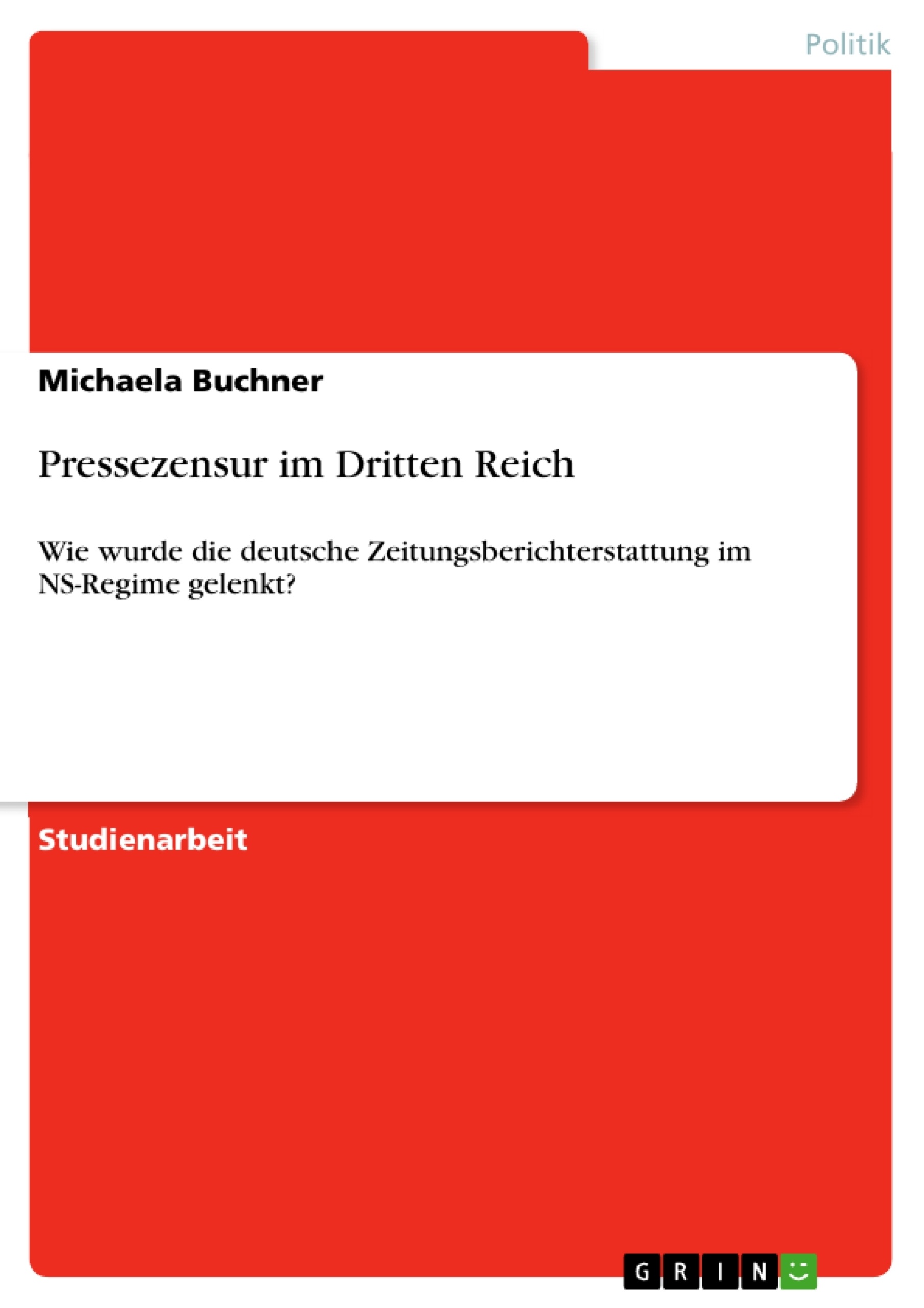Diese Arbeit behandelt die Frage, wie im NS-Regime die deutsche Zeitungsberichter-stattung gelenkt wurde. Dadurch, dass die meisten Presseerzeugnisse im gesamten nationalsozialistischen Herrschaftsbereich allesamt uniform in ihrer Aussage und Aufmachung waren, sank ihre Qualität nachhaltig. Die Presse fungierte als Durchsetzungsapparat der national-sozialistischen Politik, was sich in einer starken Verringerung der Meinungsvielfalt zeigte. Die Lenkung der Zeitungsberichterstattung ging auf drei Ebenen von Statten: auf der rechtlich-institutionellen, auf der inhaltlich sowie auf der wirtschaftlichen Ebene.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die rechtlich-institutionelle Ebene
- 2.1. Die Notverordnungen
- 2.2. Das Schriftleitergesetz
- 2.3. Das Reichskulturkammergesetz
- 2.4. Zusammenfassung der Verordnungen der rechtlich-institutionellen Ebene
- 3. Die inhaltliche Ebene
- 3.1. Die Maßnahmen
- 3.2. Zusammenfassung der Verordnungen der inhaltlichen Ebene
- 4. Die wirtschaftliche Ebene
- 4.1. Erster Enteignungsschub
- 4.2. Zweiter Enteignungsschub
- 4.3. Dritter Enteignungsschub
- 4.4. Zusammenfassung der Maßnahmen der wirtschaftlichen Ebene
- 5. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Lenkung der deutschen Zeitungsberichterstattung im NS-Regime. Ziel ist es, die Methoden und Mechanismen der staatlichen Einflussnahme auf die Presse aufzuzeigen und deren Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit und die Qualität des Journalismus zu analysieren.
- Rechtlich-institutionelle Maßnahmen zur Pressekontrolle
- Inhaltliche Steuerung und Manipulation der Berichterstattung
- Wirtschaftliche Eingriffe und Enteignungen von Zeitungsverlagen
- Auswirkungen der Presselenkung auf die Meinungsvielfalt
- Der schmale Grat zwischen Anpassung und Widerstand von Journalisten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Ausgangspunkt der Arbeit: die Frage nach der Lenkung der deutschen Zeitungsberichterstattung im NS-Regime. Sie nennt zentrale Quellen, wie "Presselenkung im NS-Staat" von Abel und "Journalismus im Dritten Reich" von Frei, und betont die unterschiedlichen Perspektiven auf den Grad des Zwangs und die mögliche Nutzung des Bestehens einiger Zeitungen durch das Regime. Das Beispiel der Frankfurter Zeitung und ihres Chefredakteurs Rudolf Kircher veranschaulicht den schwierigen Spagat zwischen Regimekonformität und subtiler Kritik. Schließlich werden die nationalsozialistischen Ziele einer totalitären Beherrschung der öffentlichen Meinung und die damit verbundenen strukturellen Probleme innerhalb des Presselenkungsapparates umrissen, unter anderem das „Lenkungswirrwarr“ durch die unzureichende Abgrenzung der Kompetenzen der Reichspropagandaleiter.
2. Die rechtlich-institutionelle Ebene: Dieses Kapitel befasst sich mit den Gesetzen und Institutionen, die die Pressefreiheit einschränkten und die Presselenkung im NS-Regime ermöglichten. Es analysiert Notverordnungen, das Schriftleitergesetz und das Reichskulturkammergesetz, um zu zeigen, wie das Regime durch rechtliche Mittel die Kontrolle über die Medien erlangte und die Meinungsfreiheit systematisch untergrub. Die Zusammenfassung dieses Kapitels fasst die Wirkung dieser rechtlichen Maßnahmen auf die Presse zusammen und zeigt deren Beitrag zum Aufbau eines totalitären Systems der Informationskontrolle.
3. Die inhaltliche Ebene: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die konkreten Maßnahmen zur inhaltlichen Steuerung der Berichterstattung. Es untersucht, wie die NS-Propaganda die Medien nutzte, um die öffentliche Meinung zu manipulieren und die nationalsozialistische Ideologie zu verbreiten. Die Zusammenfassung erklärt, wie die inhaltliche Lenkung der Presse funktionierte, welche Strategien eingesetzt wurden und welche Folgen dies für die Meinungsvielfalt und die Qualität des Journalismus hatte. Der Fokus liegt auf den Methoden der Einflussnahme und ihren Auswirkungen.
4. Die wirtschaftliche Ebene: Dieses Kapitel behandelt die wirtschaftlichen Maßnahmen zur Unterwerfung der Presse unter das NS-Regime. Es beschreibt die verschiedenen Enteignungsschübe, die dazu dienten, oppositionelle oder unerwünschte Verlage und Zeitungen zu eliminieren und die Medienlandschaft nach den Vorstellungen der Nationalsozialisten umzugestalten. Die Zusammenfassung bewertet die Rolle der wirtschaftlichen Maßnahmen im Gesamtkontext der Presselenkung, zeigt deren Bedeutung für die Durchsetzung der nationalsozialistischen Ideologie und beschreibt die Folgen für die Medienvielfalt.
Schlüsselwörter
Presselenkung, NS-Regime, Zeitungsberichterstattung, Meinungsfreiheit, Propaganda, Gleichschaltung, Zensur, Reichspropagandaleiter, Notverordnungen, Schriftleitergesetz, Reichskulturkammergesetz, wirtschaftliche Eingriffe, Enteignung, Journalisten, Frankfurter Zeitung, Rudolf Kircher.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Lenkung der deutschen Zeitungsberichterstattung im NS-Regime
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Methoden und Mechanismen der staatlichen Einflussnahme auf die deutsche Zeitungsberichterstattung während des NS-Regimes. Sie analysiert die rechtlichen, inhaltlichen und wirtschaftlichen Aspekte der Presselenkung und deren Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit und den Journalismus.
Welche Ebenen der Presselenkung werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Presselenkung auf drei Ebenen: die rechtlich-institutionelle Ebene (Gesetze, Verordnungen, Institutionen), die inhaltliche Ebene (Propaganda, Manipulation der Berichterstattung) und die wirtschaftliche Ebene (Enteignungen, wirtschaftlicher Druck).
Welche rechtlich-institutionellen Maßnahmen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Notverordnungen, das Schriftleitergesetz und das Reichskulturkammergesetz. Diese Gesetze und Verordnungen ermöglichten es dem NS-Regime, die Presse zu kontrollieren und die Meinungsfreiheit einzuschränken.
Wie wurde die Berichterstattung inhaltlich gesteuert?
Das Kapitel zur inhaltlichen Ebene untersucht, wie die NS-Propaganda die Medien nutzte, um die öffentliche Meinung zu manipulieren und die nationalsozialistische Ideologie zu verbreiten. Es werden die Strategien und Methoden der Einflussnahme und deren Folgen für die Meinungsvielfalt und die Qualität des Journalismus analysiert.
Welche wirtschaftlichen Maßnahmen wurden ergriffen?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Enteignungsschübe, die dazu dienten, oppositionelle oder unerwünschte Verlage und Zeitungen zu eliminieren und die Medienlandschaft nach den Vorstellungen der Nationalsozialisten umzugestalten. Die wirtschaftlichen Maßnahmen werden im Kontext der Gesamtstrategie der Presselenkung bewertet.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf zentrale Quellen wie "Presselenkung im NS-Staat" von Abel und "Journalismus im Dritten Reich" von Frei. Diese und weitere Quellen beleuchten unterschiedliche Perspektiven auf den Grad des Zwangs und die mögliche Nutzung des Bestehens einiger Zeitungen durch das Regime.
Welche Auswirkungen hatte die Presselenkung?
Die Presselenkung hatte massive Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit und die Qualität des Journalismus. Sie führte zur Unterdrückung abweichender Meinungen, zur Verbreitung von Propaganda und zur Manipulation der öffentlichen Meinung. Die Arbeit beleuchtet auch den schwierigen Spagat zwischen Anpassung und Widerstand von Journalisten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Presselenkung, NS-Regime, Zeitungsberichterstattung, Meinungsfreiheit, Propaganda, Gleichschaltung, Zensur, Reichspropagandaleiter, Notverordnungen, Schriftleitergesetz, Reichskulturkammergesetz, wirtschaftliche Eingriffe, Enteignung, Journalisten, Frankfurter Zeitung, Rudolf Kircher.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur rechtlich-institutionellen, inhaltlichen und wirtschaftlichen Ebene der Presselenkung sowie ein Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.
Welches Beispiel wird zur Veranschaulichung verwendet?
Die Frankfurter Zeitung und ihr Chefredakteur Rudolf Kircher werden als Beispiel für den schwierigen Spagat zwischen Regimekonformität und subtiler Kritik herangezogen.
- Quote paper
- Bachelor of Arts (B.A.) in Medien und Kommunikation Michaela Buchner (Author), 2006, Pressezensur im Dritten Reich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169175