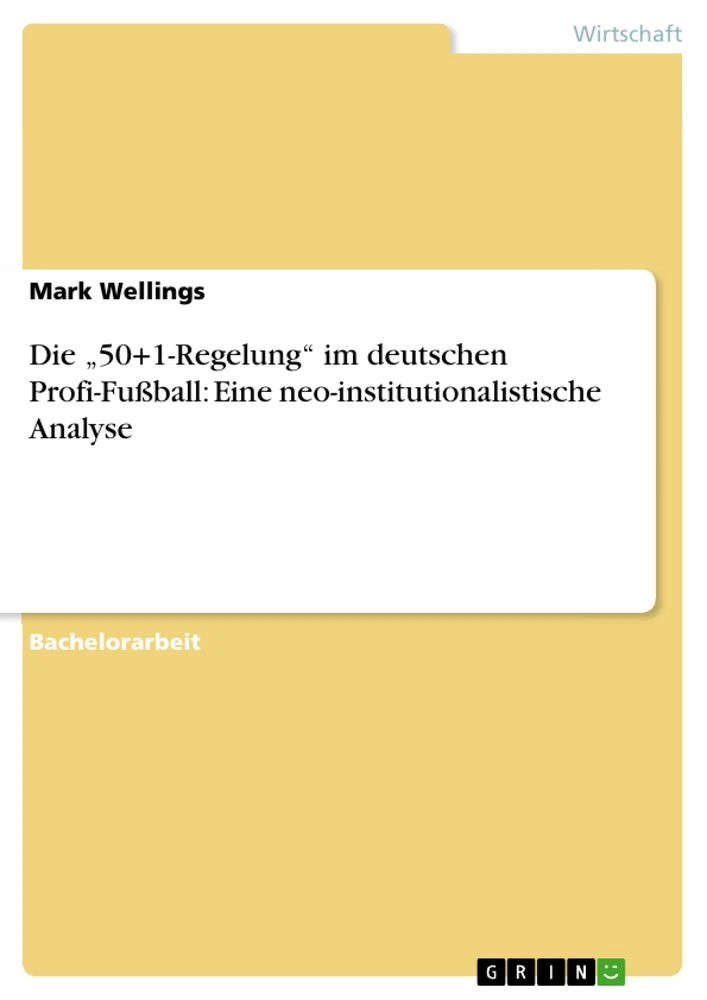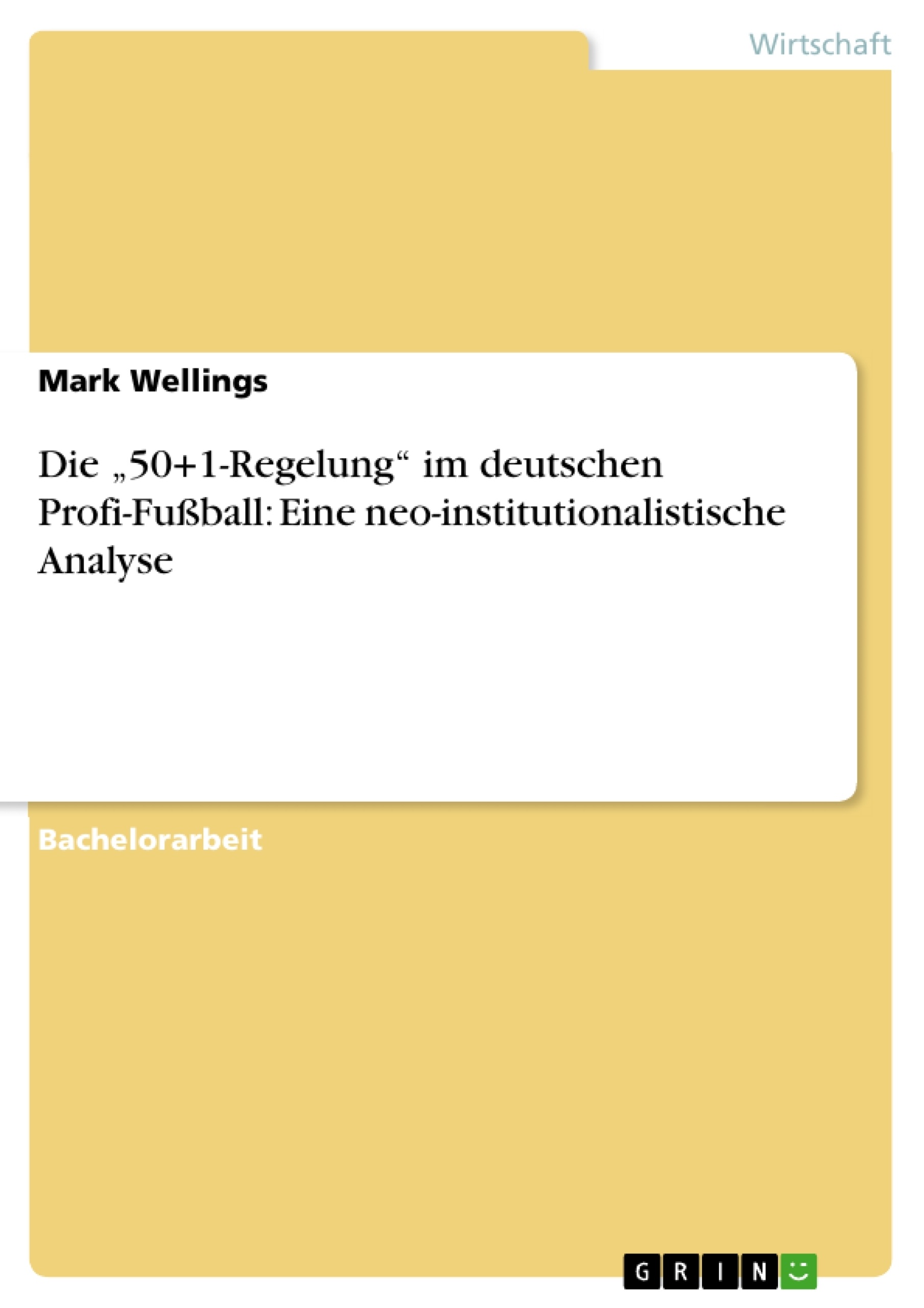Thema: Eine Analyse der Einführung der „50+1 Regelung“ im deutschen Profi-Fußball aus Sicht des Neo-Institutionalismus.
Kurzexposé
Die Ausgaben der englischen, spanischen und italienischen Profi-Fußballligen überschreiten die der Fußballbundesliga um ein vielfaches. Die Transferablösen für Spieler sind größer und ihre Entlohnung fällt in der Regel deutlich höher aus, so übersteigen Ablösesummen nicht selten die Grenze von 20 Millionen Euro. Die ausgegliederten Profi-Abteilungen stehen externen Investoren offen gegenüber und finden auch durch Reglementierung seitens der ausländischen Verbände keine Hindernisse vor, um den Beteiligungskauf zu unterbinden. So kann etwa die Glazer Familie als Mehrheitsaktionär und damit Eigentümer die Geschicke von Manchester United maßgeblich beeinflussen. Die damit generierte wirtschaftliche Kraft geht allerdings auch einher mit Fanprotesten, die befürchten, dass der sportliche Sinn eines Vereins, durch die unternehmerischen Interessen, an Bedeutung verliert.
Der hier beschriebenen Thematik entzieht sich die deutsche Fußballgemeinschaft durch die sogenannte „50+1 Regelung“. Diese wurde nach der Zulassung von Kapitalgesellschaften im Profifußball im Jahre 1998 eingeführt und besagt, dass ein Verein mindestens 50% plus einen Stimmrechtsanteil an der Profi-Abteilung halten muss, da ansonsten keine Spielberechtigung erteilt wird. Ein beherrschender Einfluss von externen Investoren wird dadurch verhindert, da diese keine Möglichkeit haben, die Handlungen der Klubs zu bestimmen. Eine besondere Bedeutung ist der deutschen Vorgehensweise beizumessen, wenn man berücksichtigt, dass diese Regelung in anderen europäischen Ligen nicht existiert.
Das Ziel dieser Arbeit ist die Gründe für die Einführung der „50+1 Regelung“ sowie ihr Fortbestehen zu analysieren, wobei hierzu auf die neo-institutionalistische Organisationstheorie zurückgegriffen wird. Diese soll Aufschluss über das Handeln der Akteure innerhalb des organisationalen Feldes geben. Die zentrale Fragestellung ist dabei, warum die „50+1-Regelung“ im deutschen Fußball eingeführt wurde und noch immer Bestand hat, obwohl diese Beschränkung in keinem anderen europäischen Land in die Regularien aufgenommen wurde. Der Einfluss der regulativen, normativen und kognitiv-kulturellen Institutionen soll mit Hilfe von Interviews entsprechender Personen berücksichtigt werden und die Legitimität der Organisation hinterfragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die „50+1-Regelung“ im deutschen Profi-Fußball
- Begriffliche und konzeptionelle Grundlagen – zentrale Begriffe des Neo-Institutionalismus
- Institutionen, Legitimität, Organisationale Felder
- Schrittfolge des institutionellen Wandels
- Exogene und endogene Auslöser von institutionellem Wandel
- Arten von institutionellem Wandel
- Prozess der Deinstitutionalisierung
- Prozess der (Re-)Institutionalisierung
- Rekombination und Bricolage
- Das Akteurskonzept der neoinstitutionalistischen Organisationstheorie
- Empirische Untersuchung: Handlungsweisen ausgewählter Akteure
- Darstellung der empirischen Untersuchung
- Form der Analyse: Auswertung und Methodik
- Verknüpfung des Neo-Institutionalismus mit der Fußballwelt und der „50+1-Regelung“ als Institution
- Einordnung der „50+1-Regelung“ in das Dreisäulenmodell
- Legitimität der Fußballklubs durch die „50+1-Regelung“
- Institutioneller Wandel - Einführung der „50+1-Regelung“ als Nullpunkt 1998
- Analyse des Deinstitutionalisierungsprozesses der „50+1-Regelung“ (ex-ante)
- Analyse des (Re-)Institutionalisierungsprozesses der „50+1-Regelung“ (ex-post)
- Die „50+1-Regelung“ als Resultat von Rekombination und Bricolage
- Fortbestand der „50+1-Regelung“ aus Sicht des Akteurskonzepts: Konservieren, annullieren oder modifizieren
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die „50+1-Regelung“ im deutschen Profi-Fußball aus neo-institutionalistischer Perspektive und zielt darauf ab, die Einführung und Existenzberechtigung dieser Regel zu erklären. Im Fokus stehen der Einfluss der Regel auf die Entwicklung des deutschen Fußballs, die Bedeutung der Regel für die Legitimität der Klubs sowie die Analyse des institutionellen Wandels im Kontext der „50+1-Regelung“.
- Analyse der „50+1-Regelung“ aus neo-institutionalistischer Perspektive
- Einfluss der „50+1-Regelung“ auf die Entwicklung des deutschen Fußballs
- Bedeutung der Regel für die Legitimität der Fußballklubs
- Institutioneller Wandel im Kontext der „50+1-Regelung“
- Verständniswandel der „50+1-Regelung“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die „50+1-Regelung“ als ein Novum im europäischen Fußball kontextualisiert und die Relevanz der Untersuchung unterstreicht. Kapitel zwei beleuchtet die Regel selbst, während Kapitel drei die theoretischen Grundlagen des Neo-Institutionalismus erläutert und die zentralen Begriffe wie Institutionen, Legitimität und organisationale Felder definiert. Anschließend werden die Schritte des institutionellen Wandels mit den Auslösern und Arten des Wandels in detaillierter Form dargestellt.
Kapitel vier widmet sich der empirischen Untersuchung, wobei die Methodik der Analyse und die Auswertung der Daten beleuchtet werden. Kapitel fünf knüpft die theoretischen Grundlagen an die „50+1-Regelung“ im Kontext der Fußballwelt an und ordnet diese Regel in das Dreisäulenmodell des Neo-Institutionalismus ein. Die Legitimität der Fußballklubs durch die „50+1-Regelung“ wird ebenfalls erörtert.
Im weiteren Verlauf des Kapitels werden die Prozesse der Deinstitutionalisierung und (Re-)Institutionalisierung der „50+1-Regelung“ analysiert. Zudem wird die Regel als Resultat von Rekombination und Bricolage betrachtet. Schließlich wird die Fortdauer der „50+1-Regelung“ aus Sicht des Akteurskonzepts beleuchtet. Die Arbeit endet mit einem Fazit und einem Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die „50+1-Regelung“ im deutschen Profi-Fußball unter dem Blickwinkel des Neo-Institutionalismus. Zentrale Themen sind die Legitimität von Fußballklubs, der Einfluss von Institutionen auf den Sport sowie der institutionelle Wandel im Kontext des Fußballs. Die Arbeit greift dabei auf Konzepte wie Institutionen, organisationale Felder, Legitimität und den institutionellen Wandel zurück.
- Citation du texte
- Mark Wellings (Auteur), 2010, Die „50+1-Regelung“ im deutschen Profi-Fußball: Eine neo-institutionalistische Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169045