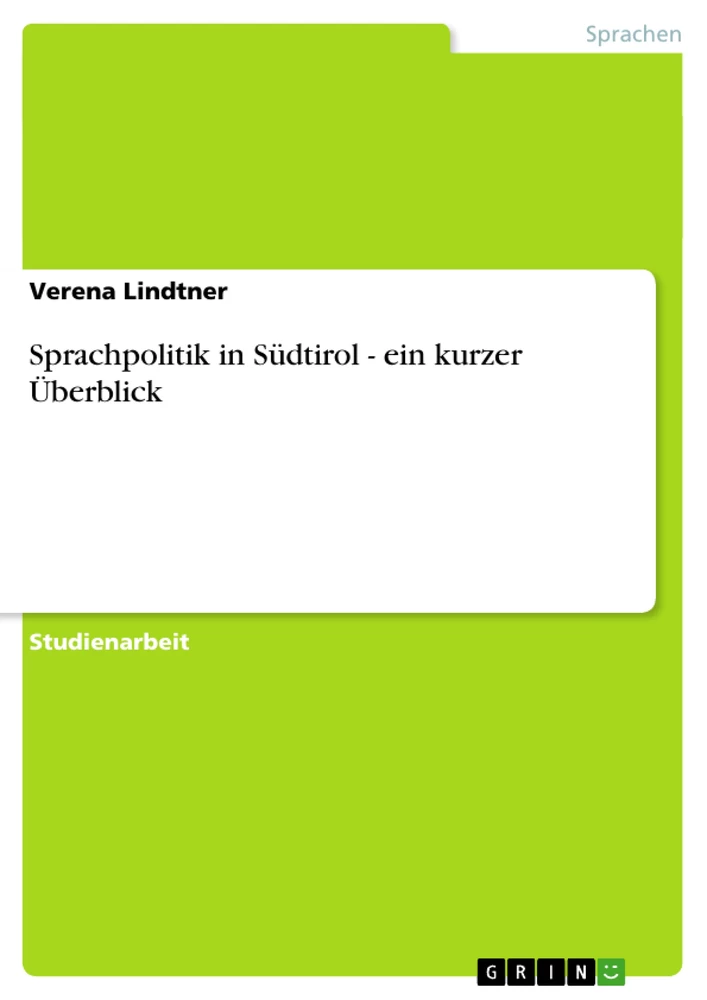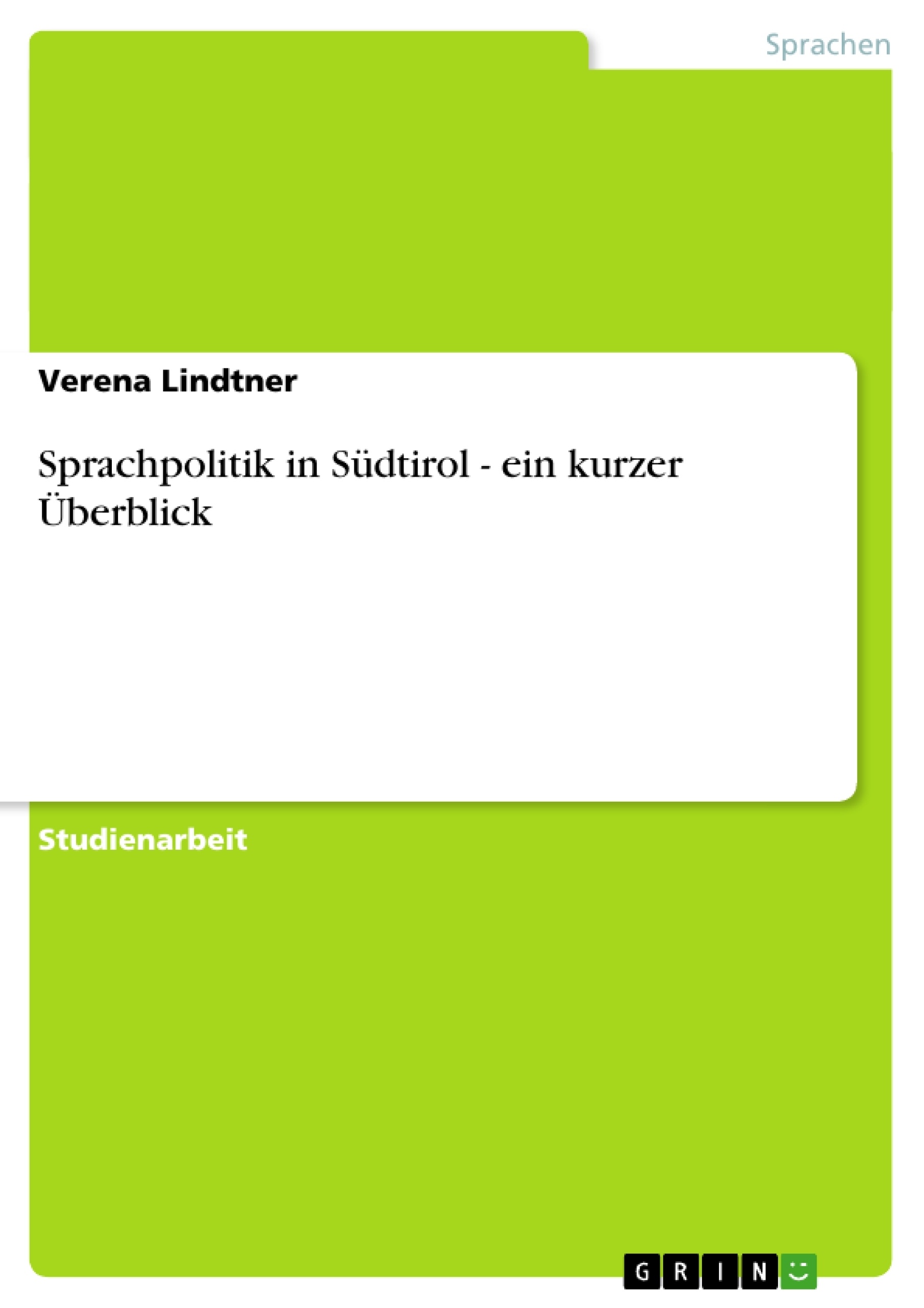1.a Der Friedensvertrag von Saint-Germain 1919
Bis 1918 war Südtirol ein wesentlicher Bestandteil von Tirol. Entgegen den 14 Punkten Wilsons und entgegen
dem Wunsch der Bevölkerung wurde durch den Friedensvertrag von Saint-Germain 1919 nicht nur das
italienischsprachige Trentino, sondern auch das deutschsprachige Südtirol - von Salurn bis zum Brenner - Italien
zugesprochen. Dem neuen Regime wurden keine Auflagen gemacht, die den Schutz der deutschen Minderheiten
betrafen.1
1.b Ettore Tolomei
Nach der Machtergreifung Mussolinis (1922) wurde die Italianisierung besonders vorangetrieben. Seine Politik
wurde von Ettore Tolomei2 bestimmt, der im Juli 1923 in Bozen ein Italianisierungsprogramm verkündete. Es
umfasste 32 Punkte, die in der Folgezeit umgesetzt wurden. Diese Politik sah die Umwandlung der traditionellen
Kultur- und Lebensform in Südtirol vor. Die Hauptmaßnahmen waren die Abschaffung der einheimischen
Gemeindeverwaltungen, die Einsetzung von italienischen Amtsbürgermeistern, das Verbot deutschsprachiger
Schulen und des deutschsprachigen Privatunterrichts, das Verbot der deutschen Sprache in den Ämtern und im
öffentlichen Leben, die Italianisierung der Familiennamen3, die Verdrängung der einheimischen Volksgruppe
aus den öffentlichen Stellen. [...]
1 Zappe, S.67
2 Ettore Tolomei wurde am 16.8.1865 in Rovereto geboren. Er studierte Geographie und war bereits 1890
Herausgeber der nationalistischen italienischen Zeitschrift "La Nazione Italiana". Seit 1886 propagierte er die
Italianisierung Südtirols, gestützt auf die Theorie der Wasserscheide als der "natürlichen Staatsgrenze" der
italienischen Nation. Zu diesem Zwecke schuf er willkürliche italienische Namen für Südtiroler Ortsnamen. Seit
1919 war Tolomei Mitglied Nr. 1 der faschistischen Partei in der Provinz Bozen. 1922 organisierte er den
berüchtigten faschistischen Sturm auf das Bozner Rathaus, welcher den Marsch auf Rom einleitete. Durch seine
Verdienste um die Nation wurde Tolomei vom Faschismus zum Senator ernannt und in den Grafenstand
erhoben. Auch das demokratische Italien bestätigte ihn 1946 als Senator.1939 fungierte er als Hauptinitiator der
Umsiedlung der Südtiroler.1946 war er wiederum Berater der italienischen Regierung während der
Friedenskonferenz. Am 26.5.1952 starb er und erhielt unter Teilnahme von höchsten Vertretern der italienischen
Regierung ein Staatsbegräbnis. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Historische Entwicklungen in Südtirol
- Friedensvertrag von Saint-Germain 1919
- Ettore Tolomei
- Das Hitler-Mussolini-Abkommen
- Der Pariser Friedensvertrag
- Das erste Autonomiestatut 1948
- Die Großkundgebung auf Schloss Sigmundskron
- Die UNO wird eingeschaltet – die Südtirolfrage wird international
- Die Feuernacht
- Die Neunzehnerkommission
- Das neue Autonomiestatut 1972
- Ausschnitte aus dem Statut
- Autonomiekommissionen
- Das Proporzdekret
- Die Entwicklung bis heute
- Die spezielle Situation der Ladiner
- Anleitung zur Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Sprachpolitik in Südtirol und untersucht die historischen Entwicklungen, die zur aktuellen Situation geführt haben. Sie beleuchtet die verschiedenen Phasen der Sprachpolitik und analysiert die Auswirkungen auf die deutsch-, italienisch- und ladinischsprachige Bevölkerung Südtirols.
- Die historische Entwicklung der Sprachpolitik in Südtirol
- Die Auswirkungen der verschiedenen Phasen der Sprachpolitik auf die Bevölkerung Südtirols
- Die Rolle der Autonomie in der Sprachpolitik Südtirols
- Die spezielle Situation der Ladiner in Südtirol
- Die Bedeutung der Sprachpolitik für die Identität und die Kultur in Südtirol
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die historischen Entwicklungen in Südtirol, beginnend mit dem Friedensvertrag von Saint-Germain 1919, der Südtirol an Italien anschloss. Es wird die Italianisierungspolitik von Ettore Tolomei und das Hitler-Mussolini-Abkommen behandelt, das die Südtiroler vor die Wahl stellte, in das Deutsche Reich umzusiedeln oder in Südtirol zu bleiben. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Pariser Friedensvertrag und dem Gruber-De Gasperi-Abkommen, das die Autonomie Südtirols in den Fokus stellte. Das dritte Kapitel analysiert das erste Autonomiestatut von 1948 und die darauf folgenden Ereignisse wie die Großkundgebung auf Schloss Sigmundskron, die Intervention der UNO und die Feuernacht. Das vierte Kapitel befasst sich mit dem neuen Autonomiestatut von 1972 und den damit verbundenen Entwicklungen. Es werden Ausschnitte aus dem Statut sowie die Autonomiekommissionen und das Proporzdekret erläutert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen der Arbeit sind: Sprachpolitik, Südtirol, Autonomie, Minderheiten, Italianisierung, Deutschsprachige, Ladiner, Geschichte, Friedensvertrag, Politik, Kultur, Identität.
- Citar trabajo
- Mag. Verena Lindtner (Autor), 2003, Sprachpolitik in Südtirol - ein kurzer Überblick, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16899