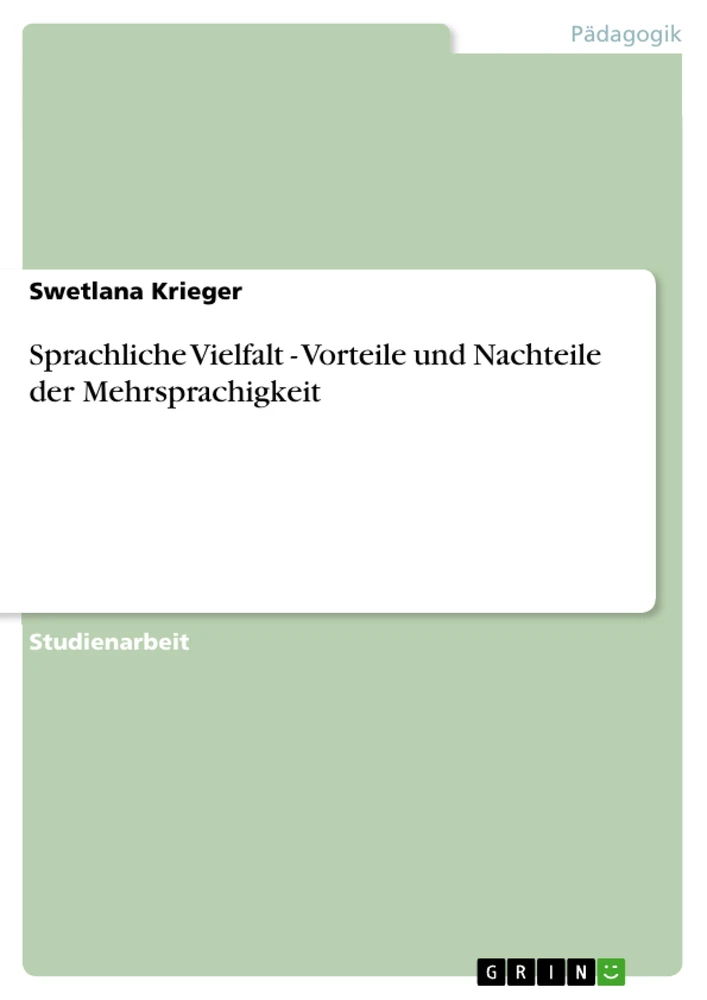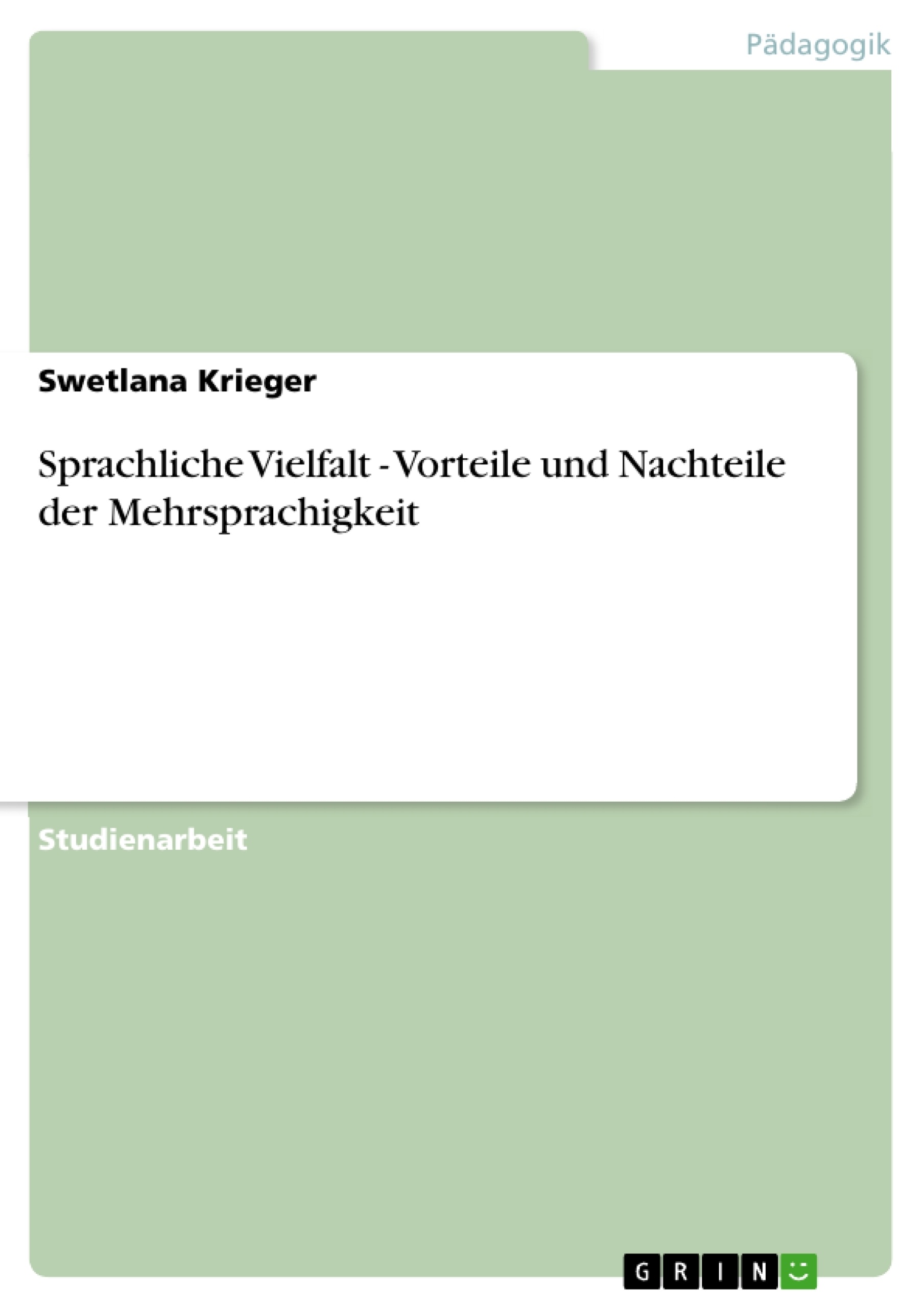Die sprachliche Kommunikation spielt in allen gesellschaftlichen Zusammenhängen eine zentrale Rolle. So gerät etwa die deutsche Sprache durch Migration in den Kontakt mit einer Vielzahl von Einwanderer-Sprachen. Es geht aber darum, sich über sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg zu verständigen und möglichst vielen Menschen eine Teilhabe am sozialen Leben zu ermöglichen: Sprachliche Vielfalt als Chance ansehen.
Ich habe mir als Ziel dieser Arbeit gesetzt, einen kurzen Überblick über die Mehrsprachigkeit in Deutschland zu geben. Mit einem Blick in die Vergangenheit soll zuerst verdeutlicht werden, wo und wie der Anfang der sprachlichen Vielfalt in Deutschland begann. Weiter soll der Leser mit der Situation von heute in Berührung kommen. Es wird gezeigt, wie die deutsche Sprache von den Menschen mit Migrationshintergrund erworben wird, mit welchen Schwierigkeiten sie es zu tun haben.
Den Kern dieser Arbeit bilden die Vorteile und Nachteile der Mehrsprachigkeit. Den Schwerpunkt habe ich auf die Mehrsprachigkeit von Kindern mit Migrationshintergrund gesetzt. Zusätzlich habe ich versucht, einen positiven Einfluss der Mehrsprachigkeit auf das Erlernen weiterer Sprachen zu verdeutlichen.
Die Maßnahmen des deutschen Bildungssystems bleiben auch nicht unberührt: Bestimmte Vorgehensweisen und Rahmenbedingungen diesbezüglich werden genannt.
Für wichtig hielt ich auch die Kompetenzen und die Arbeit der Lehrkräfte im mehrsprachigem Bereich wiederzugeben. Es soll gezeigt werden, wie verantwortlich sie ihre Aufgaben erfüllen und welche Fähigkeiten sie dafür mit der Zeit entwickeln. Als Letztes deute ich auf den Wandel hin, den die deutschen Schulen durch die Mehrsprachigkeit erfahren.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Historischer Hintergrund
- „Monolinguistisches Selbstverständnis“
- Die Situation der Gegenwart
- Deutsch wird unterschiedlich erworben
- Spezifika des Spracherwerbs
- Die Gogolins und Neumanns „Großstadtgrundschule“ –Studie (1997)
- Sprach-/Leseerwerbssituation von Migrantenkinder
- Vorteile und Nachteile der Mehrsprachigkeit
- Den Kindern ist das Erlernen verschiedener Sprachen angeboren
- Das Erlernen mehrerer Sprachen und der Einfluss dessen auf eine weitere Fremdsprache
- „Dynamisches Mehrsprachigkeitsmodell“
- Maßnahmen
- Von 1964 bis 1990
- Deutsch als Zweitsprache
- Strukturen der Sprachförderung in Niedersachsen als Beispiel der durchgeführten Maßnahmen
- Die Vorgehensweise
- Fördermaßnahmen der Grundschule für Deutsch-als-Zweitsprache
- Professionelle Kompetenzen der Lehrkräfte in mehrsprachiger Umgebung
- Mangelnde Sprachkompetenz anstatt fehlender kognitiver Fähigkeiten
- Kenntnisse der Lehrkraft
- Michalaks Untersuchung der professionellen Lehrerkompetenzen
- Schulischer Wandel durch bilinguale Klassen
- Flexibilität der Lehrer
- Teamteaching
- Erfolgreiche Konsequenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema der Mehrsprachigkeit in Deutschland. Sie hat zum Ziel, einen Überblick über die sprachliche Vielfalt in Deutschland zu geben, sowohl in historischer Perspektive als auch in der Gegenwart. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Spracherwerb von Kindern mit Migrationshintergrund und den Vorteilen sowie Nachteilen der Mehrsprachigkeit. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Maßnahmen zur Sprachförderung im deutschen Bildungssystem sowie die Bedeutung der professionellen Kompetenzen von Lehrkräften in mehrsprachigen Umgebungen. Schließlich wird der Wandel beleuchtet, den deutsche Schulen durch bilinguale Klassen erfahren.
- Historische Entwicklung der Mehrsprachigkeit in Deutschland
- Spracherwerb von Kindern mit Migrationshintergrund
- Vorteile und Nachteile der Mehrsprachigkeit
- Sprachfördermaßnahmen im deutschen Bildungssystem
- Professionelle Kompetenzen von Lehrkräften in mehrsprachigen Umgebungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung stellt die Relevanz der sprachlichen Kommunikation in der heutigen Gesellschaft dar und skizziert die Zielsetzung der Arbeit. Der historische Hintergrund beleuchtet die Entstehung der sprachlichen Vielfalt in Deutschland durch die Zuwanderung von Arbeitskräften und Aussiedlern. Die Situation der Gegenwart untersucht den Spracherwerb von Migrantenkindern, die Herausforderungen des Deutschlernens und die Rolle der Herkunftssprache. Die Vorteile und Nachteile der Mehrsprachigkeit werden beleuchtet, wobei die positiven Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung und den Erwerb weiterer Sprachen hervorgehoben werden. Der Abschnitt über Maßnahmen zur Sprachförderung beschreibt verschiedene Ansätze und Programme, die in deutschen Schulen umgesetzt werden. Im Kapitel über die professionellen Kompetenzen von Lehrkräften in mehrsprachigen Umgebungen werden wichtige Kenntnisse und Fähigkeiten von Lehrkräften beleuchtet, um die sprachliche Entwicklung von Migrantenkindern zu unterstützen. Der schulische Wandel durch bilinguale Klassen wird im letzten Kapitel behandelt, wobei die positiven Auswirkungen auf die Lernleistung von Schülern und die Bedeutung der Flexibilität von Lehrkräften hervorgehoben werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich dem Thema der Mehrsprachigkeit in Deutschland, wobei der Fokus auf dem Erwerb der deutschen Sprache bei Kindern mit Migrationshintergrund liegt. Zentrale Begriffe sind Spracherwerb, Mehrsprachigkeit, Deutsch als Zweitsprache, Sprachförderung, bilinguale Klassen, interkulturelle Pädagogik, Kompetenzen von Lehrkräften, Migrationshintergrund, sprachliche Vielfalt.
- Quote paper
- Swetlana Krieger (Author), 2011, Sprachliche Vielfalt - Vorteile und Nachteile der Mehrsprachigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168939