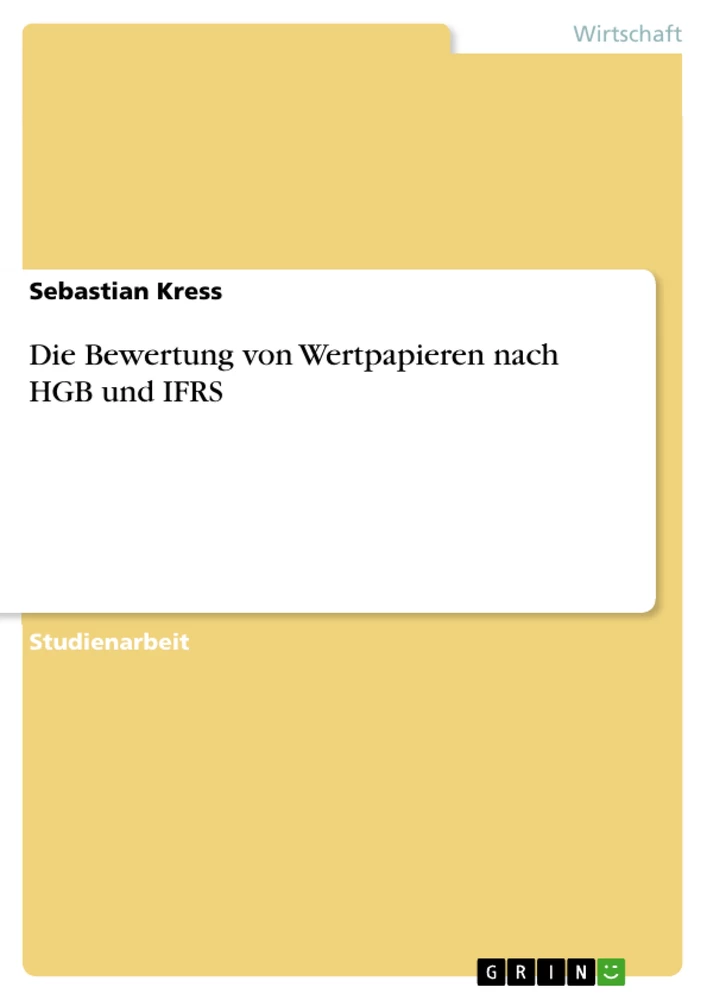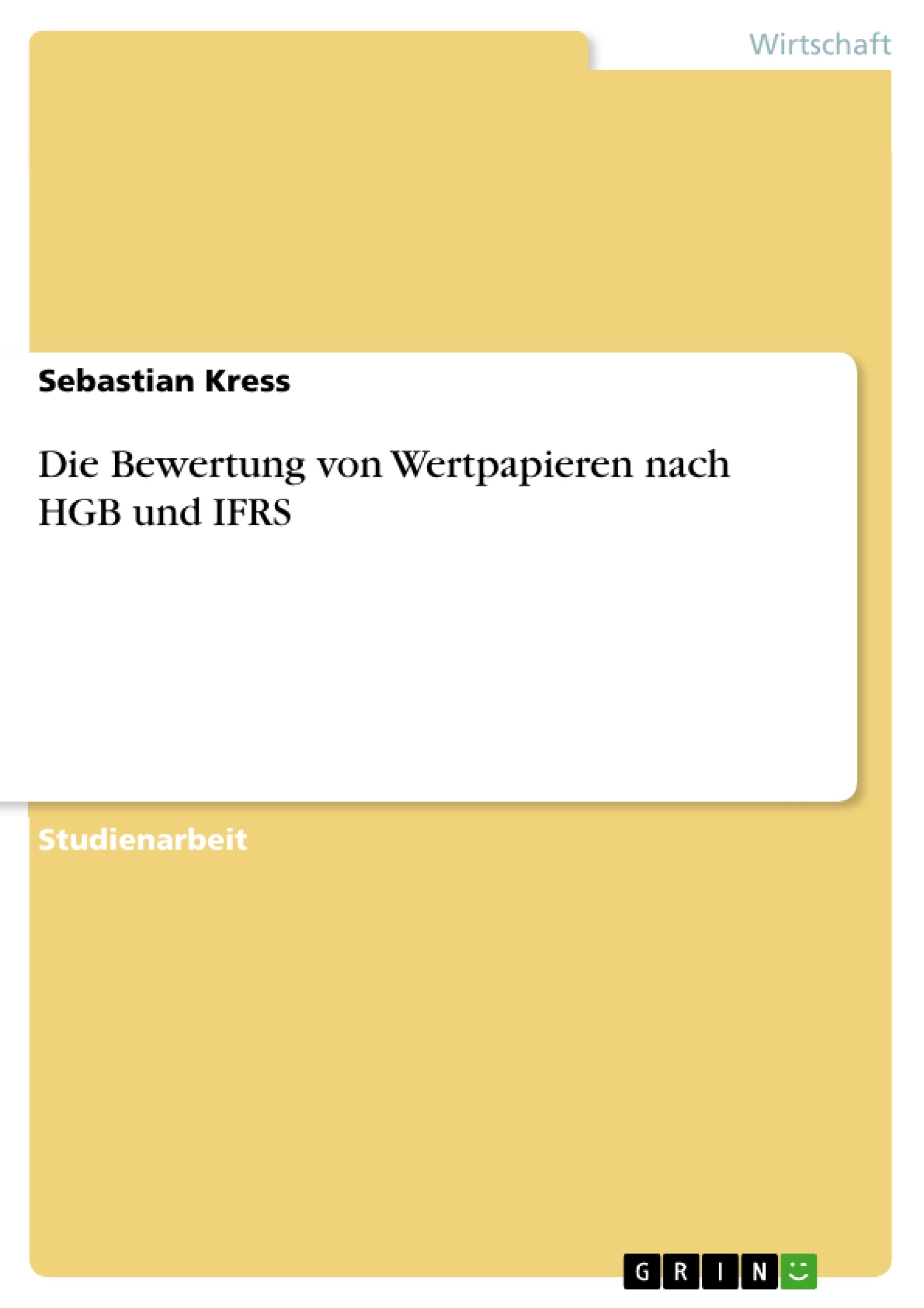Im Handelsgesetzbuch (HGB) ist der Großteil des deutschen Handelsrechts festgehalten. Im Wesentlichen enthält es Regelungen zum Handelsstand, zur Handelsfirma, zur Führung der Handelsbücher, zu den Vollmachten der Vertretungen, zu den Gesellschaftsformen, zu den Rechten der einzelnen Gesellschafter, zur Bilanzierung, zum Jahresabschluss und zur Offenlegung. Das deutsche Bilanzrecht, welches im 3. Buch des HGB (§§238 -342 HGB) enthalten ist, hat sich als Grundlage zur Ermittlung des ausschüttungsfähigen Gewinns und der Besteuerung bis Anfang der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts bewährt. Da hierzulande die Unternehmen für die Kapitalbeschaffung traditionell mehr die Fremdkapitalfinanzierung über Kreditinstitute anstatt die Eigenkapitalfinanzierung über den Aktienmarkt nutzen, dominiert in der deutschen Rechnungslegung der Gläubigerschutz. Dies zeigt sich in den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und einer Reihe von Prinzipien. Als wesentliche Beispiele dazu sind das Vorsichts- und Imparitätsprinzip des §252 Abs. 1 Nr. 4 HGB, das Niederstwert-und das Nominalwertprinzip (§253 Abs. 1-3 HGB) zu nennen. Der Jahresabschluss dient damit einerseits der Information, indem er ein den tatsächlichen Verhältnissen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entsprechendes Bild zeigt (§264 Abs. 2 HGB). Andererseits dient der Jahresabschluss auch der Bemessung von Zahlungen an die Anteilseigner (z.B. Dividenden) und Steuern.
Probleme barg das Bilanzrecht in Bezug auf die Rechenschafts-und Informationsfunktion. Die genannten Schwächen des Handelsgesetzbuches traten immer öfters zum Vorschein, bedingt durch die Globalisierung, der damit verbundenen „Öffnung der Märkte“, sowie die steigenden Nachfrage der Großunternehmen auf dem Kapitalmarkt. Deutsche Unternehmen dehnten ihre Aktivitäten auf den ausländischen Märkten aus. Dies hatte zur Folge, dass der Bedarf der Unternehmen nach Kapital auf dem nationalen Märkten nicht mehr zu befriedigen war. Die Lösung fanden die Unternehmen auf den ausländischen Börsen, weitgehend auf der New York Stock Exchange.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 1.1 Die Bedeutung von HGB und IFRS
- 1.2 Abgrenzung von Wertpapieren gegenüber Finanzinstrumenten
- 2. Bilanzierung und Bewertung von Wertpapieren nach HGB
- 2.1 Ansatz und Ausweis von Wertpapieren nach HGB
- 2.2 Bewertung von Wertpapieren nach HGB
- 3. Bilanzierung und Bewertung von Wertpapieren nach IFRS
- 3.1 Ansatz von Wertpapieren nach IFRS
- 3.1.1 Allgemeine Ansatzvorschriften
- 3.1.2 Zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere
- 3.1.3 Bis zur Endfälligkeit zu haltende Wertpapiere
- 3.1.4. Zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere
- 3.2 Bewertung von Wertpapieren nach IFRS
- 3.2.1 Erstmalige Bewertung von Wertpapieren
- 3.2.2 Folgebewertung von Wertpapieren
- 3.3 Die Umwidmung von Wertpapieren in eine andere Kategorie
- 4. Fazit Wesentliche Unterschiede zwischen HGB und IAS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Bewertung von Wertpapieren nach den deutschen Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Sie analysiert die Unterschiede in den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der beiden Rechnungslegungsstandards. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung der Unterschiede in der Anwendung der beiden Standards auf die Bewertung von Wertpapieren.
- Die Bedeutung von HGB und IFRS in der deutschen Rechnungslegung
- Die Bilanzierung und Bewertung von Wertpapieren nach HGB
- Die Bilanzierung und Bewertung von Wertpapieren nach IFRS
- Die Unterschiede in den Bewertungsvorschriften zwischen HGB und IFRS
- Die Anwendung der Standards auf verschiedene Arten von Wertpapieren
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel führt in das Thema der Bewertung von Wertpapieren nach HGB und IFRS ein. Es erläutert die Bedeutung der beiden Rechnungslegungsstandards und skizziert die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden. Das zweite Kapitel behandelt die Bilanzierung und Bewertung von Wertpapieren nach HGB. Es werden die Ansätze und Ausweisvorschriften sowie die Bewertungsmethodik nach HGB erläutert. Das dritte Kapitel analysiert die Bilanzierung und Bewertung von Wertpapieren nach IFRS. Es wird die Unterscheidung in verschiedene Kategorien von Wertpapieren beleuchtet sowie die ersten und Folgebewertungen nach IFRS behandelt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Wertpapiere, HGB, IFRS, Bilanzierung, Bewertung, Ansatz, Ausweis, Folgebewertung, Erstbewertung, Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Finanzinstrumente, Rechnungslegung, Kapitalerhaltung, Vorsichtsprinzip, International Accounting Standards Board (IASB)
- Quote paper
- Sebastian Kress (Author), 2010, Die Bewertung von Wertpapieren nach HGB und IFRS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168802