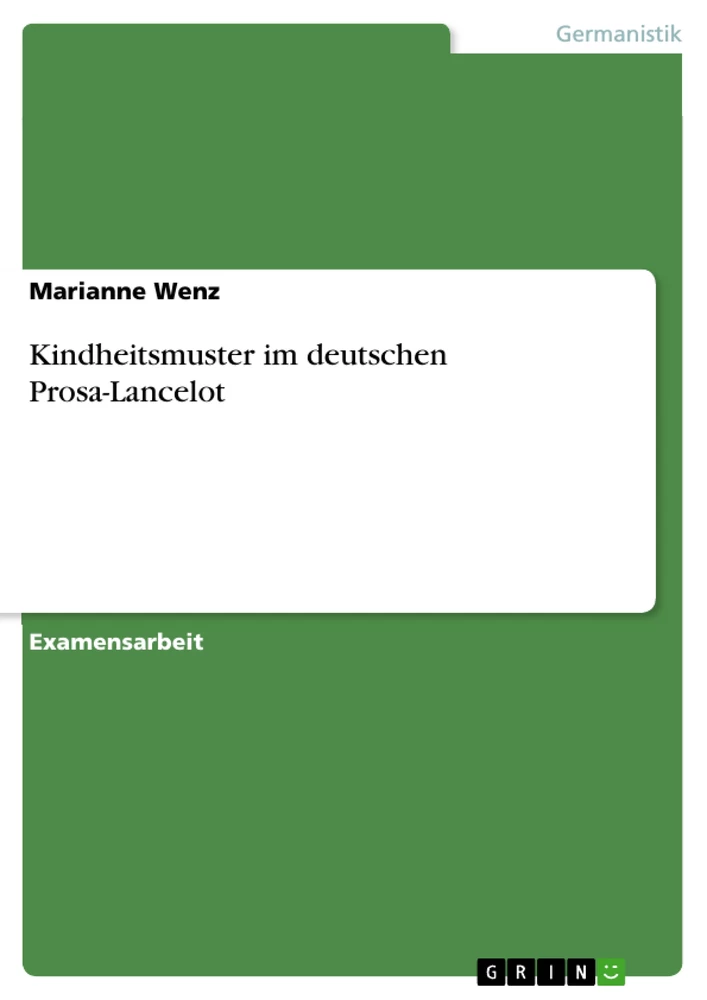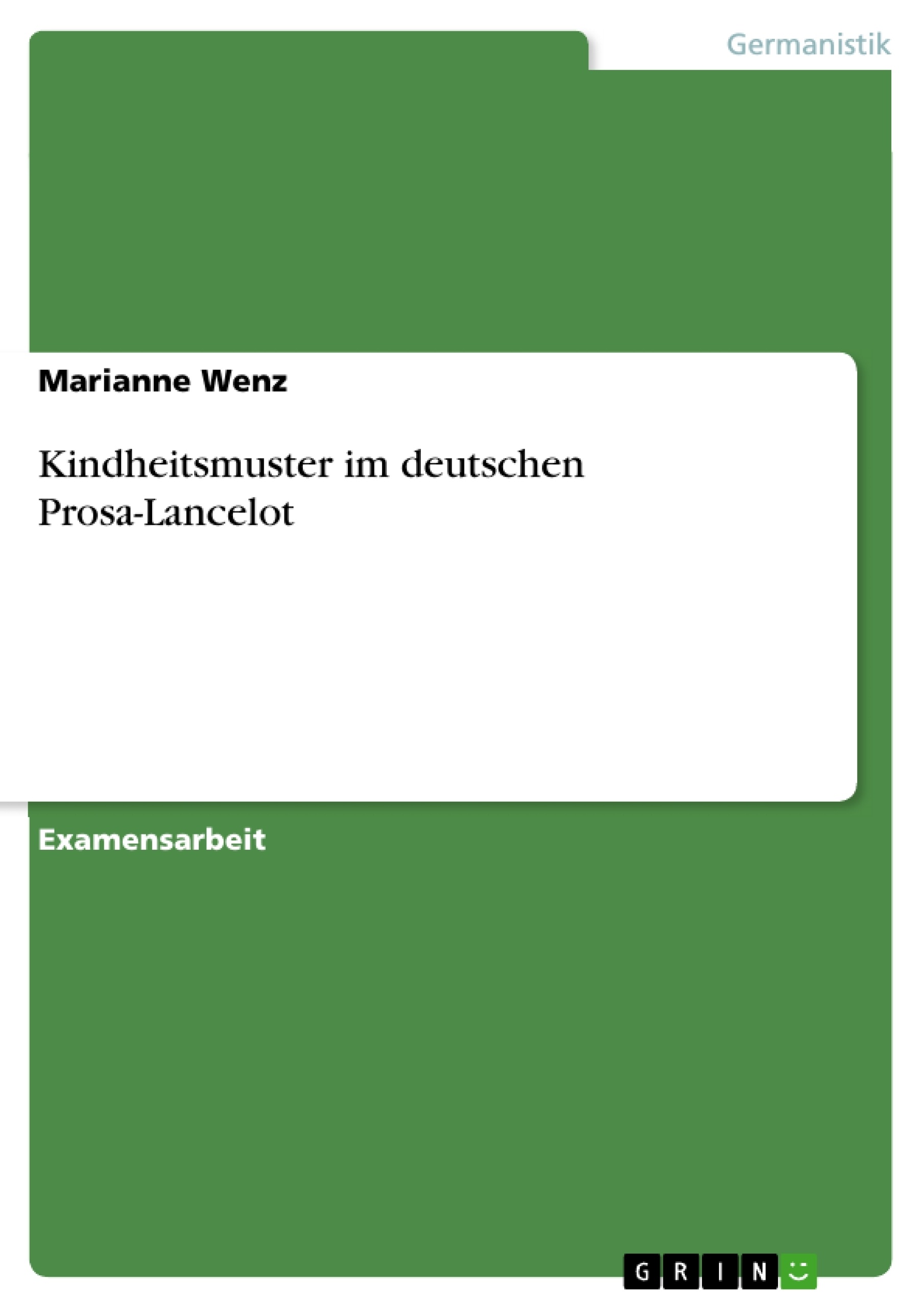Das „älteste […] Fragment (M)“1 lässt die Entstehungszeit des deutschen Prosaromans „Lancelot“ auf die Mitte des 13. Jahrhunderts datieren. Die Namen der Verfasser verbleiben unentdeckt.2
Bei der Untersuchung von Stellen, die mit der altfranzösischen Version identisch sind, werden die Ausführungen von Hans-Hugo Steinhoff zu der Übersetzung des deutschen Prosa-Lancelots aus dem Altfranzösischen berücksichtigt.3 Die Aussage von Hans-Hugo Steinhoff soll die Annahme vertreten, dass bei aller Problematik der exakten Überprüfbarkeit, die altfranzösische Version verglichen mit der mittelhochdeutschen Variante einen identischen Inhalt aufweist. Diese Erkenntnis soll die Haltung, dass die Interpretation der altfranzösischen Vorlage durchaus zur Stützung der Interpretation der eventuellen Übersetzung des Prosa-Lancelots aus dem Altfranzösischen ins Mittelhochdeutsche dienen kann, festigen. Einspruch dagegen kann aufgrund der Beweislage und Widerlegung der Behauptung, es habe eine direkte Übersetzung gegeben4, von Pentti Tilvis erhoben werden.
Die vorliegende Arbeit ist ein Versuch, die „Kindheitsmuster“ im deutschen Prosaroman „Lancelot“ und die damit zusammenhängenden Themen, wie Erziehung und Bildung, darzustellen, zu erörtern und zu analysieren. Es soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern Kinder in dem Prosaroman „Lancelot“ als Kinder im heutigen Verständnis dargestellt werden. Dabei soll die literarische Fiktion mit der zeitgenössischen Realität verglichen werden. Die Formen der Mütterlichkeiten und Väterlichkeiten spielen unterdessen eine bedeutende Rolle, auch diese werden einer näheren Prüfung unterzogen. Eines der Diskussionsverfahren in der vorliegenden Arbeit bedient sich der Gegenüberstellung zu einigen Beispielen aus weiteren Werken der fiktiven mittelhochdeutschen Literatur. Ferner wird Bezug auf die historisch dokumentierten Zeugnisse genommen.
Die weiteren Textbeispiele stammen aus thematisch gezielt ausgewählten Werken der mittelalterlichen Literatur wie „Melusine“, „Tristan“, „Der arme Heinrich“, „Die Legende vom zwölfjährigen Mönchlein“, „Ruodlieb“, „Parzival“ sowie Auszügen aus didaktischen Lehrgedichten von Walther von der Vogelweide und Thomasin von Zerklaere. Weitere Werke aus dem zwölften bis vierzehnten Jahrhundert, die dem Bereich der Sachliteratur zugeordnet werden können, sind „Kaiserchronik eines Regensburger Geistlichen“, „Super Epistolas Pauli Lectura“ und „Yconomica“.
[...]
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Kinderjahre von Lancelot
- Unter der Obhut der Zauberdame vom See
- Im Säuglingsalter
- Ende der Kindheit von Lancelot
- Kindheiten von Lionel und Bohort
- Tyrann als Elternteil
- Väter und Söhne im Vergleich
- Kinder und die Standesordnung
- Mütterlichkeit und Väterlichkeit
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von „Kindheitsmustern“ im deutschen Prosaroman „Lancelot“ und analysiert die damit verbundenen Themen wie Erziehung und Bildung. Sie befasst sich mit der Frage, inwiefern Kinder in diesem Roman als Kinder im heutigen Verständnis dargestellt werden und vergleicht die literarische Fiktion mit der zeitgenössischen Realität. Die Formen der Mütterlichkeiten und Väterlichkeiten spielen eine wichtige Rolle und werden ebenfalls genauer betrachtet.
- Darstellung von Kindheitsmustern im „Lancelot“
- Erziehung und Bildung im Kontext des Romans
- Vergleich der Darstellung von Kindern mit dem heutigen Verständnis
- Analyse von Mütterlichkeit und Väterlichkeit im Roman
- Vergleich mit anderen Werken der mittelalterlichen Literatur
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Entstehung des deutschen Prosaromans „Lancelot“ und die Relevanz der altfranzösischen Version für die Interpretation dar. Das erste Kapitel analysiert Lancelots Kindheit unter der Obhut der Zauberdame vom See und untersucht die Rolle der Vormundschaft sowie die Bedingungen seiner frühen Entwicklung. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Beendigung von Lancelots Kindheit und der Überleitung in das Ritterleben. Das dritte Kapitel widmet sich den Kindheitserfahrungen von Lancelots Brüdern, Lionel und Bohort, und beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu Lancelots Entwicklung. Das vierte Kapitel untersucht die Rolle des „Tyrannen“ als Elternfigur in der mittelalterlichen Gesellschaft und im Roman. Das fünfte Kapitel analysiert die Darstellung von Vätern und Söhnen im Roman und vergleicht die verschiedenen Vaterfiguren. Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit der Verbindung zwischen Kindheit und Standesordnung im mittelalterlichen Kontext. Das siebte Kapitel erforscht die unterschiedlichen Formen von Mütterlichkeit und Väterlichkeit im Roman.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Kindheitsmuster, Erziehung und Bildung, mittelalterliche Literatur, Prosaroman „Lancelot“, Mütterlichkeit, Väterlichkeit, Standesordnung, historische Realität, literarische Fiktion, Vergleich, Analyse.
- Quote paper
- Marianne Wenz (Author), 2007, Kindheitsmuster im deutschen Prosa-Lancelot, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168796