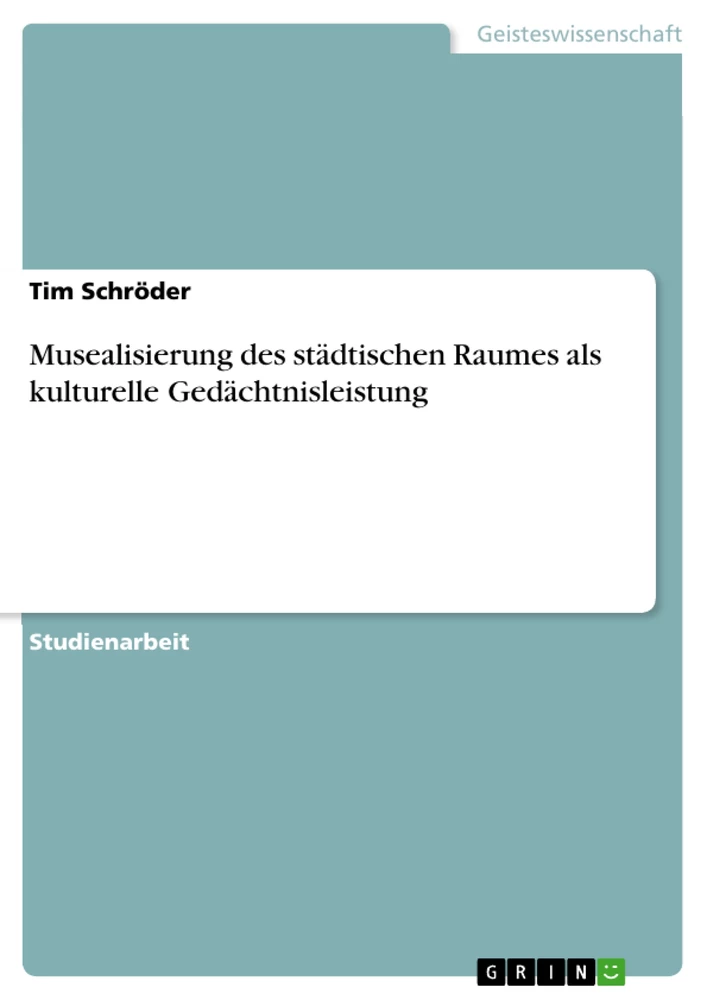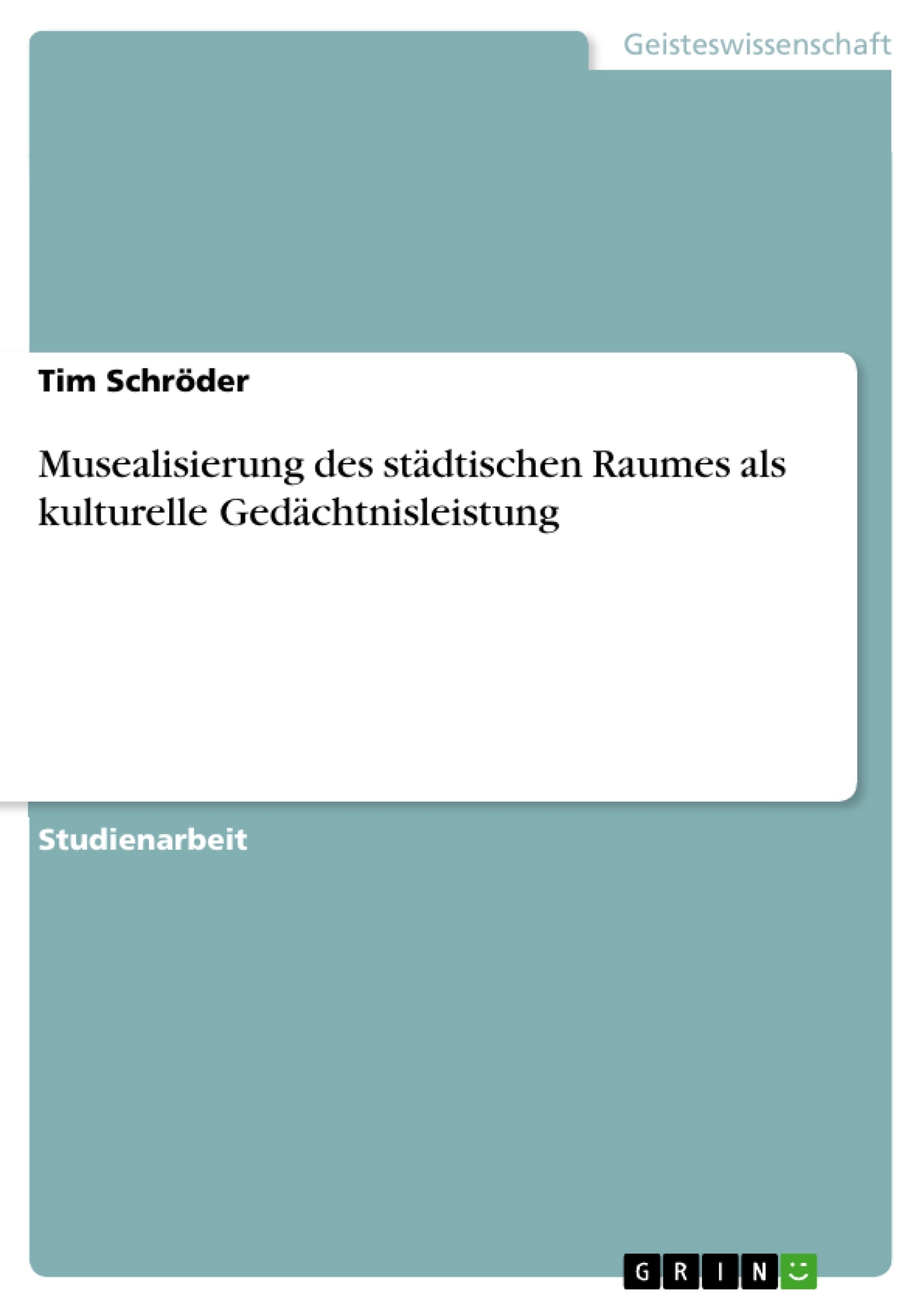Der Diskurs zur Musealisierung des städtischen Raumes richtet sich auf eine Entwicklungstendenz vor allem der Innenstädte europäischer Mittel- und Großstädte. Grundlage dieser Entwicklung sind „Strategien der Transformation der urbanen Räume“ (Dröge/Müller 1996: 45), die in der einschlägigen Literatur in die Begriffe Ästhetisierung und Inszenierung gefasst werden (Dröge/Müller 1996; Prigge 1998; Müller 2002; Bittner 2005; Nelle 2007).
Dieser Prozess setzt bereits am Beginn der ästhetischen Moderne des späten 19. Jahrhunderts ein und nimmt vor allem seit Mitte der 1970er Jahre eine prägende Kraft an (Müller 2002). Die vorliegende Arbeit macht es sich zur Aufgabe, dem Begriff der Musealisierung in der Anwendung auf den städtischen Raum genauer nachzufragen. Dabei wird Musealisierung als eine auf die Raumwahrnehmung zielende kulturelle Gedächtnisleistung identifiziert, bei der Erinnerung und Vergessen miteinander in Einklang zu bringen sind.
Wir beginnen die Untersuchung mit einer kurzen Geschichte der europäischen Stadt, dem Objekt der Musealisierung (Kap. 2). Sodann fragen wir nach der Bedeutung des Musealisierungsbegriffs in Bezug zum historischen Bedeutungswandel des Museums und in Anwendung auf den städtischen Raum (Kap. 3). Von hier aus können kontrastierend zwei Konzeptionen der Musealisierung des städtischen Raumes erörtert werden (Kap. 4). Wir binden den Musealisierungsdiskurs sodann gesellschaftstheoretisch an das Konzept des kulturellen Gedächtnisses an, so wie es die Systemtheorie Niklas Luhmanns konzeptionell ausarbeitet (Kap. 5). Das Schlusskapitel fasst die Ergebnisse noch einmal kurz zusammen und gibt einen Ausblick auf künftige Analysemöglichkeiten (Kap. 6).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die alte europäische Stadt und aktuelle Entwicklungstendenzen des urbanen Raumes
- 3. Museum, Musealisierung und städtischer Raum
- 4. Zur Bewertung der Musealisierung
- 4.1 Die Kompensationsthese
- 4.2 Inszenierung und Ästhetisierung als Machtstrategien
- 5. Musealisierung und kulturelles Gedächtnis bei Luhmann
- 6. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Musealisierung des städtischen Raums, insbesondere in europäischen Mittel- und Großstädten. Sie betrachtet dies als eine kulturelle Gedächtnisleistung, die Erinnerung und Vergessen in Einklang bringen soll. Die Arbeit analysiert den Begriff der Musealisierung im Kontext des historischen Wandels des Museums und dessen Anwendung auf den städtischen Raum. Es werden verschiedene Konzeptionen der Musealisierung erörtert und der Diskurs gesellschaftstheoretisch im Kontext des kulturellen Gedächtnisses nach Luhmann eingeordnet.
- Historische Entwicklung der europäischen Stadt
- Bedeutungswandel des Museums und dessen Anwendung auf den städtischen Raum
- Konzeptionen der Musealisierung des städtischen Raums (Kompensation, Inszenierung/Ästhetisierung)
- Kulturelles Gedächtnis und Musealisierung nach Luhmann
- Analyse der Raumwahrnehmung im Kontext von Musealisierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Musealisierung des städtischen Raumes ein und definiert den Fokus der Arbeit. Sie beschreibt den Prozess der Musealisierung als eine kulturelle Gedächtnisleistung, die auf die Raumwahrnehmung abzielt und Erinnerung und Vergessen vereint. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die einzelnen Kapitel, die die Thematik von verschiedenen Perspektiven beleuchten werden. Die Arbeit betrachtet die Musealisierung als eine Strategie der Transformation urbaner Räume, die sich insbesondere seit Mitte des 20. Jahrhunderts verstärkt zeigt.
2. Die alte europäische Stadt und aktuelle Entwicklungstendenzen des urbanen Raumes: Dieses Kapitel untersucht die historische Entwicklung der europäischen Stadt als Grundlage für das Verständnis der Musealisierungsprozesse. Es beschreibt die Herausbildung des mittelalterlichen Städtesystems, seine Charakteristika (Befestigung, Markt, Kommune) und den damit verbundenen Entstehung eines Stadtbewusstseins. Die Entwicklung vom Mittelalter über den Absolutismus bis zur Industrialisierung und die damit verbundenen Veränderungen der Stadtstruktur und des städtischen Lebens werden detailliert dargestellt, unter Einbezug von Schlüsseltheoretikern wie Max Weber. Das Kapitel zeigt den Übergang von der überschaubaren Lebenswelt der alten europäischen Stadt zur komplexen Großstadt der Moderne und die Herausforderungen, die dies für den Städtebau mit sich brachte.
3. Museum, Musealisierung und städtischer Raum: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Musealisierung im Kontext des historischen Bedeutungswandels des Museums. Es untersucht, wie der Museumsbegriff sich im Laufe der Zeit verändert hat und wie dieser Wandel in der Anwendung auf den städtischen Raum relevant wird. Der Fokus liegt auf der Erörterung des Verhältnisses zwischen Museum, Musealisierung und städtischem Raum, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Deutungen und Interpretationen dieses Prozesses. Die Grundlage für die folgenden Kapitel wird durch die Klärung des Begriffs "Musealisierung" im Kontext des städtischen Raumes geschaffen.
4. Zur Bewertung der Musealisierung: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert zwei gegensätzliche Konzeptionen der Musealisierung des städtischen Raumes. Der Abschnitt 4.1, die Kompensationsthese, untersucht einen Aspekt der Musealisierung. Der Abschnitt 4.2 beleuchtet Inszenierung und Ästhetisierung als Machtstrategien im Zusammenhang mit der Musealisierung. Beide Abschnitte stellen verschiedene Interpretationen und Bewertungen der Musealisierung dar, wobei die jeweiligen Argumente und Begründungen detailliert untersucht und kontrastiert werden. Das Kapitel differenziert die verschiedenen Aspekte und Auswirkungen der Musealisierung, welche ein umfassenderes Verständnis ermöglichen.
5. Musealisierung und kulturelles Gedächtnis bei Luhmann: In diesem Kapitel wird der Diskurs der Musealisierung gesellschaftstheoretisch in das Konzept des kulturellen Gedächtnisses nach Niklas Luhmann eingebunden. Es wird die Luhmannsche Systemtheorie herangezogen, um die Musealisierung im Kontext von Erinnerung, Vergessen und der Konstruktion von Identität zu analysieren. Die Verbindung zwischen der soziologischen Perspektive Luhmanns und dem Phänomen der Musealisierung des städtischen Raums wird detailliert untersucht und die Relevanz dieser Perspektive für das Verständnis der Musealisierung herausgestellt.
Schlüsselwörter
Musealisierung, städtischer Raum, kulturelles Gedächtnis, Luhmann, europäische Stadt, Ästhetisierung, Inszenierung, Raumwahrnehmung, Stadtentwicklung, Transformation urbaner Räume, historische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Musealisierung des Städtischen Raums
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Musealisierung des städtischen Raums, insbesondere in europäischen Mittel- und Großstädten. Sie betrachtet die Musealisierung als eine kulturelle Gedächtnisleistung, die Erinnerung und Vergessen in Einklang bringen soll und analysiert sie im Kontext des historischen Wandels des Museums und seiner Anwendung auf den urbanen Raum.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der europäischen Stadt, den Bedeutungswandel des Museums und dessen Anwendung auf den städtischen Raum, verschiedene Konzeptionen der Musealisierung (Kompensation, Inszenierung/Ästhetisierung), das kulturelle Gedächtnis und Musealisierung nach Luhmann sowie die Analyse der Raumwahrnehmung im Kontext von Musealisierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Die alte europäische Stadt und aktuelle Entwicklungstendenzen des urbanen Raumes, Museum, Musealisierung und städtischer Raum, Zur Bewertung der Musealisierung (inkl. Kompensationsthese und Inszenierung/Ästhetisierung als Machtstrategien), Musealisierung und kulturelles Gedächtnis bei Luhmann und Schluss.
Wie wird die Musealisierung bewertet?
Die Arbeit analysiert zwei gegensätzliche Konzeptionen der Musealisierung: die Kompensationsthese und Inszenierung/Ästhetisierung als Machtstrategien. Diese verschiedenen Interpretationen und Bewertungen werden detailliert untersucht und kontrastiert, um ein umfassenderes Verständnis zu ermöglichen.
Welche Rolle spielt Niklas Luhmann in dieser Arbeit?
Der Diskurs der Musealisierung wird gesellschaftstheoretisch in das Konzept des kulturellen Gedächtnisses nach Niklas Luhmann eingebunden. Die Luhmannsche Systemtheorie wird herangezogen, um die Musealisierung im Kontext von Erinnerung, Vergessen und der Konstruktion von Identität zu analysieren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Musealisierung, städtischer Raum, kulturelles Gedächtnis, Luhmann, europäische Stadt, Ästhetisierung, Inszenierung, Raumwahrnehmung, Stadtentwicklung, Transformation urbaner Räume, historische Entwicklung.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Musealisierung des städtischen Raums zu untersuchen und zu verstehen, wie dieser Prozess als kulturelle Gedächtnisleistung funktioniert und welche gesellschaftlichen und räumlichen Auswirkungen er hat. Sie ordnet den Diskurs gesellschaftstheoretisch ein und analysiert verschiedene Perspektiven auf das Phänomen.
Wie wird die historische Entwicklung der europäischen Stadt berücksichtigt?
Die historische Entwicklung der europäischen Stadt wird als Grundlage für das Verständnis der Musealisierungsprozesse untersucht. Die Arbeit beschreibt die Herausbildung des mittelalterlichen Städtesystems, seine Entwicklung bis zur Industrialisierung und die damit verbundenen Veränderungen der Stadtstruktur und des städtischen Lebens.
Wie wird der Begriff "Musealisierung" definiert?
Der Begriff "Musealisierung" wird im Kontext des historischen Bedeutungswandels des Museums und seiner Anwendung auf den städtischen Raum erörtert. Die Arbeit klärt den Begriff und untersucht unterschiedliche Deutungen und Interpretationen dieses Prozesses.
- Quote paper
- Tim Schröder (Author), 2010, Musealisierung des städtischen Raumes als kulturelle Gedächtnisleistung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168792