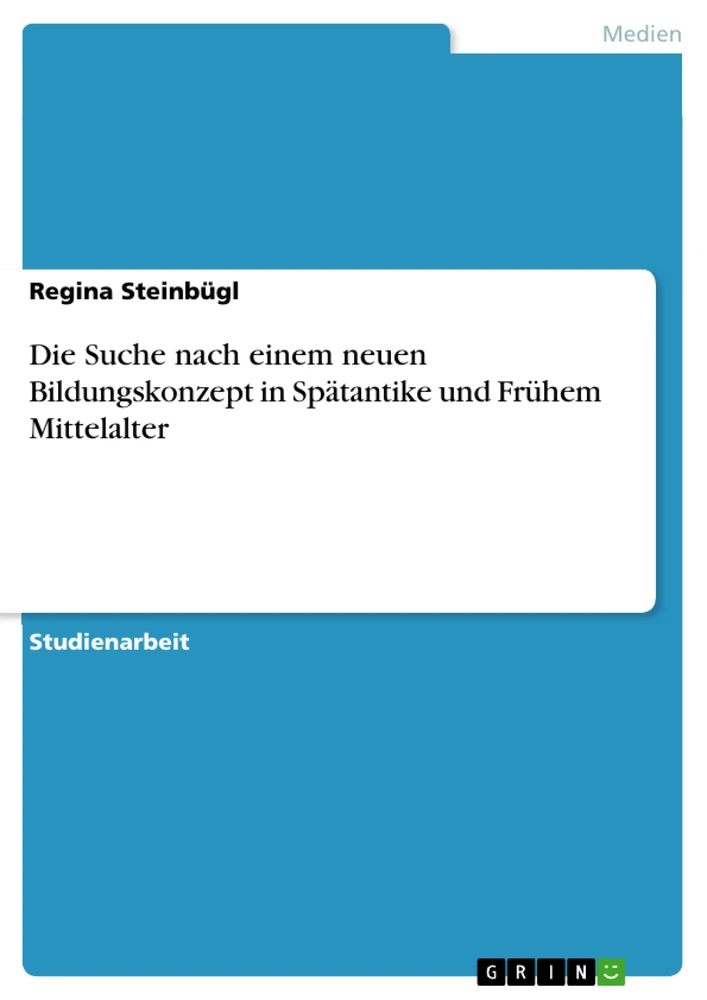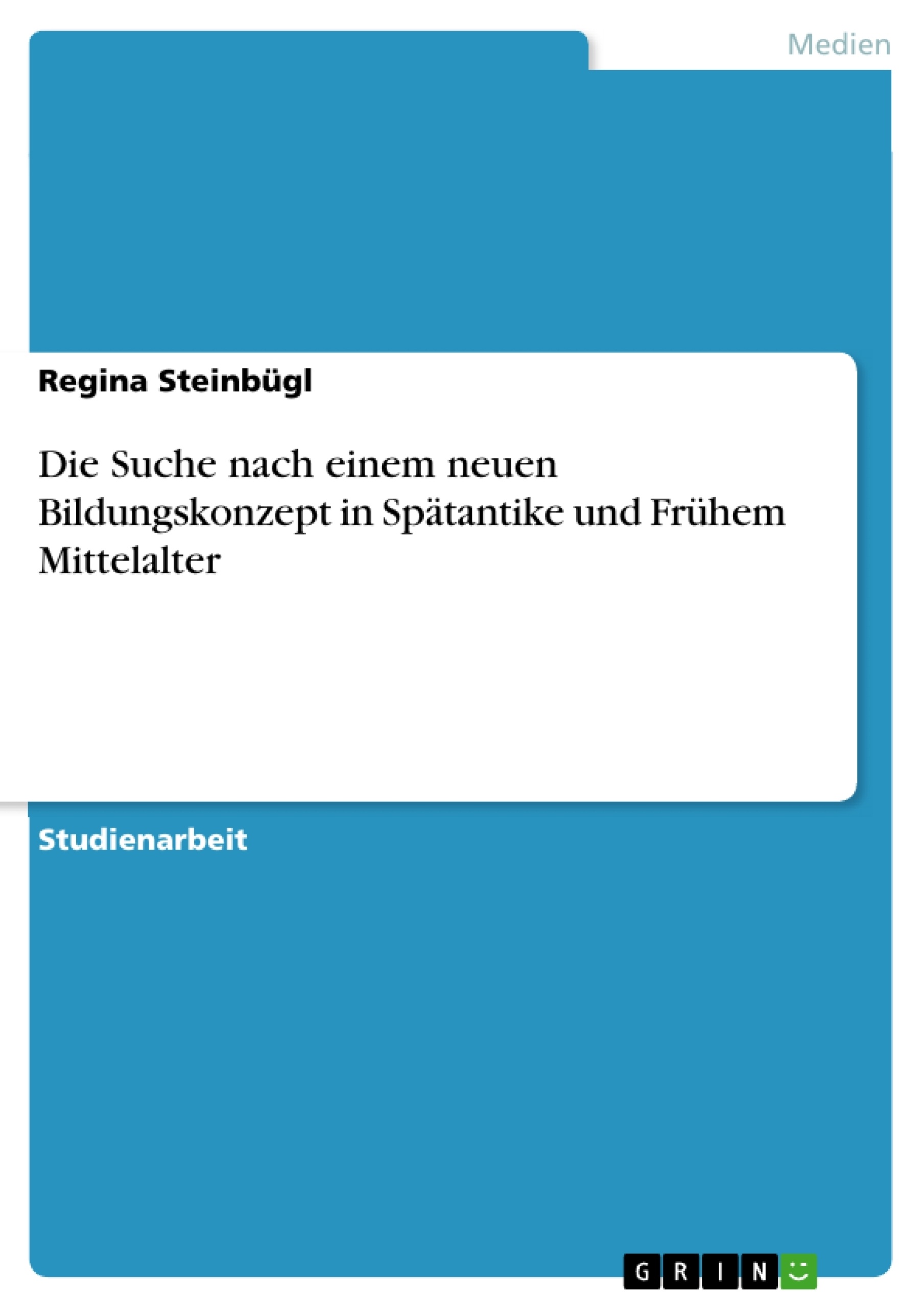Menschen machen Musik, seit es sie gibt. Zwar unterscheidet sich die „Musik“ der vorgeschichtlichen Völker und Stämme weit von der, die wir heute als solche verstehen. Doch lassen sich selbst Laute oder Schreie, mit denen in den Frühkulturen kommuniziert wurde, als Musik bezeichnen. So entwickelte sich aus rituellen Gesängen und Tänzen, Klageliedern usw. nach und nach unsere heutige Musik, deren Entwicklung noch längst nicht stillsteht.
Fast genauso alt wie die Musik selbst ist die Musikerziehung und die Suche nach einem dafür geeigneten Bildungskonzept. Erste Aussagen darüber lassen sich in der Antike feststellen, die „neben dem Christentum als der bedeutendste Pfeiler europäisch-abendländischer Kultur“ gilt (Ehrenforth 2005, S.41). Die wichtigsten Personen sind Pythagoras, Platon, Aristoteles und Boethius. Das Bildungskonzept orientierte sich an den „Septem Artes Liberales“, die sich aufteilen in „Quadrivium“ (arithmetica, geometrica, astronomia, musica) und „Trivium“ (grammatica, rethorica, dialectica).
Mit dem aufkommenden Christentum wurde dieses traditionelle Konzept der Antike in Frage gestellt und man machte sich auf die Suche nach einem „christlich geprägten“ Bildungskonzept. Dabei drehte stellte man sich vor allem zwei wesentlichen Fragen:
1. Welche Bedeutung hat das Bildungskonzept der Antike weiterhin? 2. Welche Rolle spielt die Musik in der Bildung? (Ehrenforth 2005, S.112)
Den scheinbaren Widerspruch zwischen fides (Glaube, Gottvertrauen) und ratio (Vernunft, Verstand, Wissenschaft) galt es außerdem zu erklären und zu beheben.
Im Zeitraum vom 2. bis 9. Jahrhundert nach Christus suchten vor allem die Kirchenväter und Gelehrte nach Lösungen und fanden verschiedenste Ansätze. Diese werden im Folgenden dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verschiedene Ansätze der Kirchenväter
- Übersicht: 2. bis 4. Jahrhundert
- Clemens von Alexandrien (um 140–215 n.Chr.)
- Tertullian (um 160-220 n.Chr.)
- Origines (um 185-254 n.Chr.)
- Basilius der Große (um 329-379 n.Chr.)
- Ambrosius von Mailand (um 339-397 n.Chr.)
- Ambrosianischer Gesang
- Instrumentenverdikt
- Augustinus von Hippo (354-430 n.Chr.)
- De Musica
- De doctrina christiana
- Enarrationes in psalmos
- Integration der Musik in die christliche Bildung
- (Heiliger) Benedikt von Nursia (um 480-547 n.Chr.)
- Gregor der Große (um 540-604 n.Chr.)
- Abt Alkuin (735-804 n.Chr.)
- Gründung einer „schola palatina“
- Wunsch nach weiterer Vereinheitlichung der Liturgie
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Suche nach einem neuen Bildungskonzept in der Spätantike und im frühen Mittelalter. Sie untersucht, wie Kirchenväter und Gelehrte der damaligen Zeit das antike Bildungskonzept in Frage stellten und nach einem „christlich geprägten“ Konzept suchten. Die Arbeit analysiert die Rolle der Musik in diesem neuen Bildungskonzept und untersucht die Ansichten verschiedener wichtiger Gelehrter, wie Clemens von Alexandrien, Tertullian, Origines, Basilius der Große, Ambrosius von Mailand, Augustinus von Hippo, Benedikt von Nursia, Gregor der Große und Abt Alkuin.
- Entwicklung eines neuen Bildungskonzepts in der Spätantike und im frühen Mittelalter
- Der Einfluss des Christentums auf das antike Bildungskonzept
- Die Rolle der Musik in der christlichen Bildung
- Die Ansichten verschiedener Kirchenväter und Gelehrter zur Musik und Bildung
- Die Herausforderungen der Quellenlage für die Forschung in diesem Bereich
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den historischen Kontext der Arbeit vor und erläutert die Relevanz der Musik in der Entwicklung der europäischen Kultur. Sie verdeutlicht, wie sich die Suche nach einem neuen Bildungskonzept in der Spätantike und im frühen Mittelalter aus dem Spannungsverhältnis zwischen der antiken Bildungstradition und dem aufkommenden Christentum entwickelte.
- Verschiedene Ansätze der Kirchenväter: Dieses Kapitel gibt eine Übersicht über die Ansichten verschiedener Kirchenväter des 2. bis 4. Jahrhunderts. Es werden die Positionen von Clemens von Alexandrien, Tertullian, Origines und Basilius dem Großen vorgestellt und ihre unterschiedlichen Ansätze zur Integration der Musik in die christliche Bildung beleuchtet.
- Ambrosius von Mailand: Dieses Kapitel beleuchtet das Leben und Wirken des wichtigen Kirchenvaters Ambrosius von Mailand. Es werden seine Ansichten zum Einfluss der Musik auf die christliche Lehre und seine Rolle bei der Entwicklung des ambrosianischen Gesangs dargestellt.
- Augustinus von Hippo: Dieses Kapitel befasst sich mit der Person und den Schriften des Kirchenvaters Augustinus von Hippo. Seine Philosophie und seine theologischen Ansichten werden vorgestellt, wobei ein besonderer Fokus auf seine Werke "De Musica" und "De doctrina christiana" gelegt wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselwörtern und Themen: Kirchenväter, Spätantike, Frühmittelalter, Bildungskonzept, Musikpädagogik, Christentum, antike Philosophie, Liturgie, Ambrosianischer Gesang, Augustinus von Hippo, De Musica, De doctrina christiana, Instrumentenverdikt.
- Quote paper
- Regina Steinbügl (Author), 2010, Die Suche nach einem neuen Bildungskonzept in Spätantike und Frühem Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168503