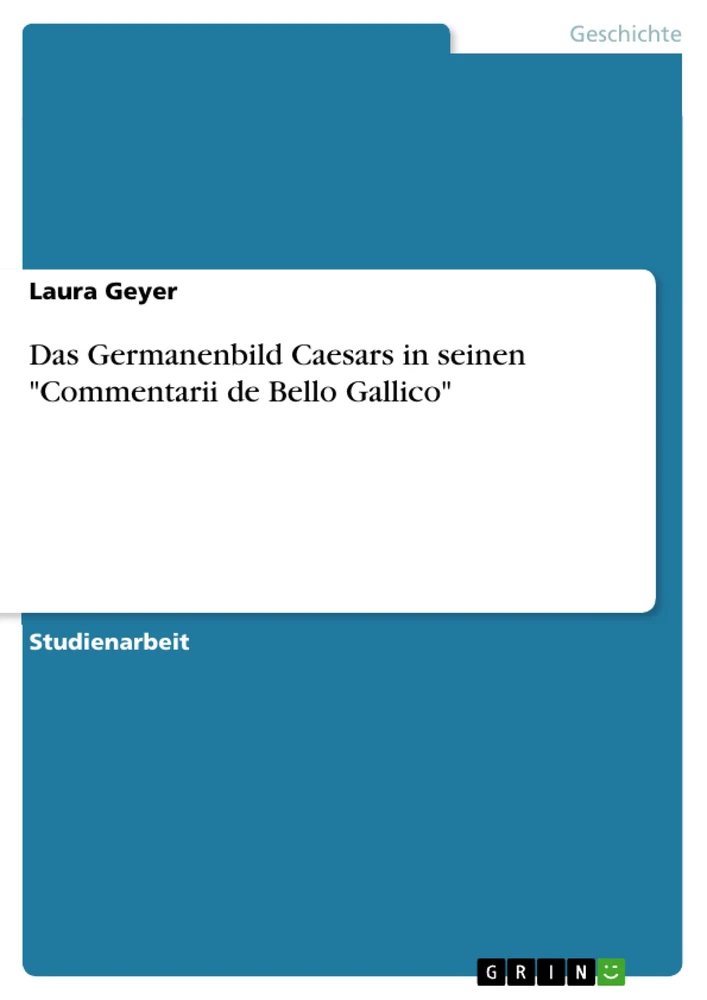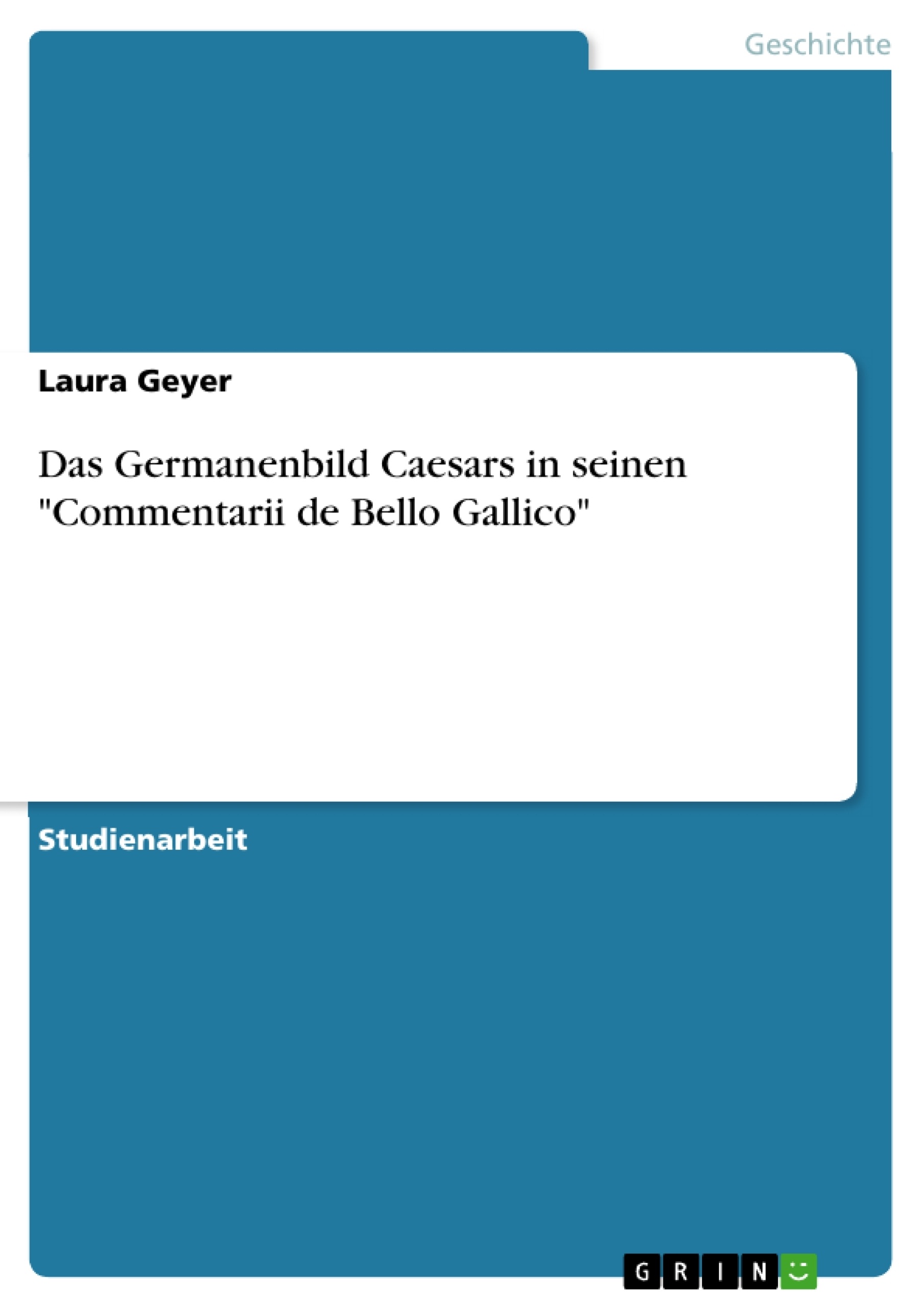Noch zu Zeiten seines eigenen Konsulats 59 v. Chr. sicherte Caesar sich ein fünfjähriges Prokonsulat in den Provinzen Gallia cisalpina, Gallia Narbonensis und Illyricum. Dort, so hoffte er, würde er die Gelegenheit haben, sich Feldherrenruhm zu erkämpfen und als Triumphator nach Rom zurückzukehren. Eine erste Gelegenheit, Krieg zu führen, ergab sich in der Provinz Gallia Narbonensis, als Helvetier, anscheinend verdrängt durch Germanenstämme, das Gebiet der mit Rom verbündeten Häduer durchquerten. Viele weitere Kriege folgten, nicht alle Schlachten waren erfolgreich, nicht alle Kriege aus römischer Sicht „gerecht“. Um sich vor dem römischen Senat zu rechtfertigen, verfasste Caesar die Commentarii de bello Gallico, Feldherrenberichte, deren einziger Zweck es ist, den Verfasser und sein Handeln im günstigsten Licht erscheinen zu lassen. Und natürlich erstrahlt der Feldherr umso heller, je düsterer er seine Feinde – die Feinde Roms – erscheinen lässt.
Besonders gut für den Entwurf eines furchterregenden, stereotypen Barbarenbildes eigneten sich die Germanen, deren Beschreibung sich Caesar an drei umfassenderen Stellen widmet. Anhand dieser drei Textpassagen, dem Bericht über den Krieg gegen Ariovist (58 v. Chr.), dem über die Vernichtung der Usipeter und Tenkterer (56/55 v. Chr.) und einem ethnologischen Vergleich zwischen Galliern und Germanen werde ich versuchen darzustellen, auf welche Weise Caesar das Bild der Germanen zeichnet und wie dieses Bild, je nachdem, welches Ziel er im jeweiligen Fall erreichen möchte, variiert.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Das Germanenbild Caesars in seinen Commentarii de bello Gallico
- 1. Der Krieg gegen Ariovist
- a) Die Klagen des Diviciacus und Caesars Entscheidung für den Krieg
- b) Caesars Rede an die Soldaten
- c) Das Aufeinandertreffen von Caesar und Ariovist
- 2. Die Usipeter und Tenkterer
- a) Beschreibung der Lebensweise der Sueben
- b) Der Kampf gegen die Usipeter und Tenkterer
- 3. Vergleich von Galliern und Germanen
- 1. Der Krieg gegen Ariovist
- III. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Caesars Darstellung der Germanen in seinen Commentarii de bello Gallico. Sie zielt darauf ab, Caesars Intentionen bei der Konstruktion des Germanenbildes aufzudecken und die Variationen in seiner Beschreibung je nach Situation zu beleuchten.
- Caesars Rhetorik in der Darstellung der Germanen
- Die Konstruktion des stereotypen Barbarenbildes
- Die Rolle der Germanen in Caesars Feldzugsberichten
- Der Einfluss des Germanenbildes auf Caesars politische und militärische Strategien
- Die Abgrenzung der Germanen von den Galliern
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich Caesars Darstellung des Krieges gegen Ariovist. Es analysiert die Schilderung des germanischen Königs und der von ihm ausgehenden Bedrohung, die durch die Klage des Häduers Diviciacus verstärkt wird. Zudem beleuchtet es Caesars Motivationsrede an seine Soldaten und die Darstellung der Verhandlungen mit Ariovist.
Das zweite Kapitel behandelt den Bericht über die Usipeter und Tenkterer. Es analysiert Caesars Beschreibung der Sueben als Beispiel für die Lebensweise der Germanen und zeichnet die militärische Auseinandersetzung mit den Usipeter und Tenkterer nach.
Das dritte Kapitel untersucht Caesars Vergleich von Galliern und Germanen und beleuchtet die Unterschiede in den Kulturen und Lebensweisen, die er hervorhebt. Es analysiert, wie Caesar die Germanen als weniger zivilisiert und wilder darstellt.
Schlüsselwörter
Germanen, Caesar, Commentarii de bello Gallico, Ariovist, Usipeter, Tenkterer, Gallier, Barbarenbild, Stereotypisierung, Krieg, Rhetorik, politische Propaganda, ethnologischer Vergleich, Lebensweise, Kultur.
- Arbeit zitieren
- Laura Geyer (Autor:in), 2009, Das Germanenbild Caesars in seinen "Commentarii de Bello Gallico", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168441