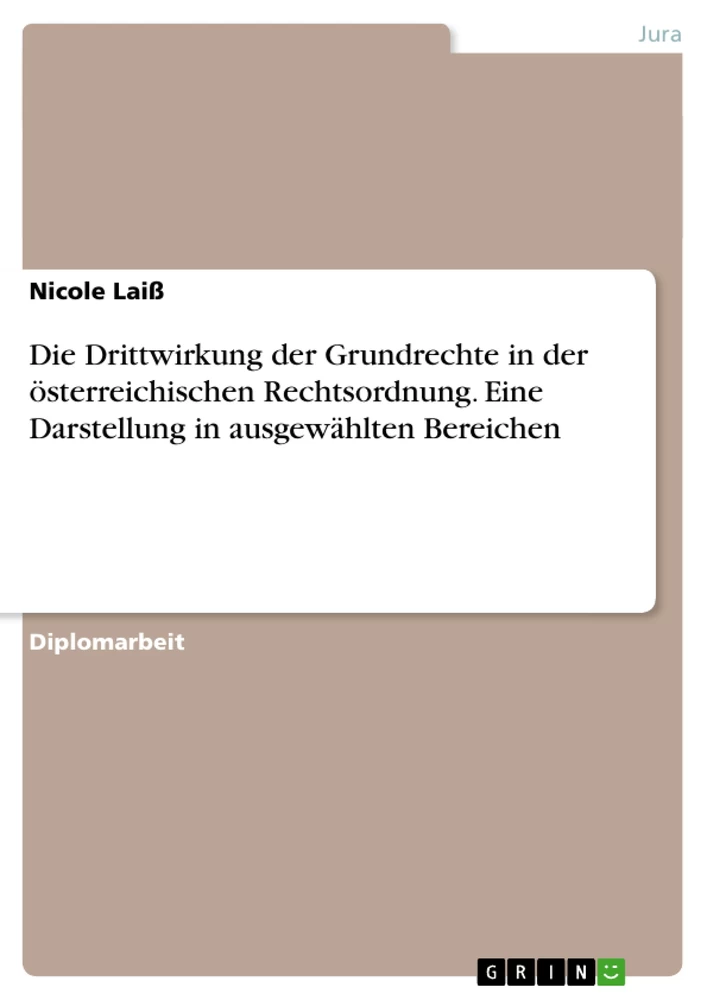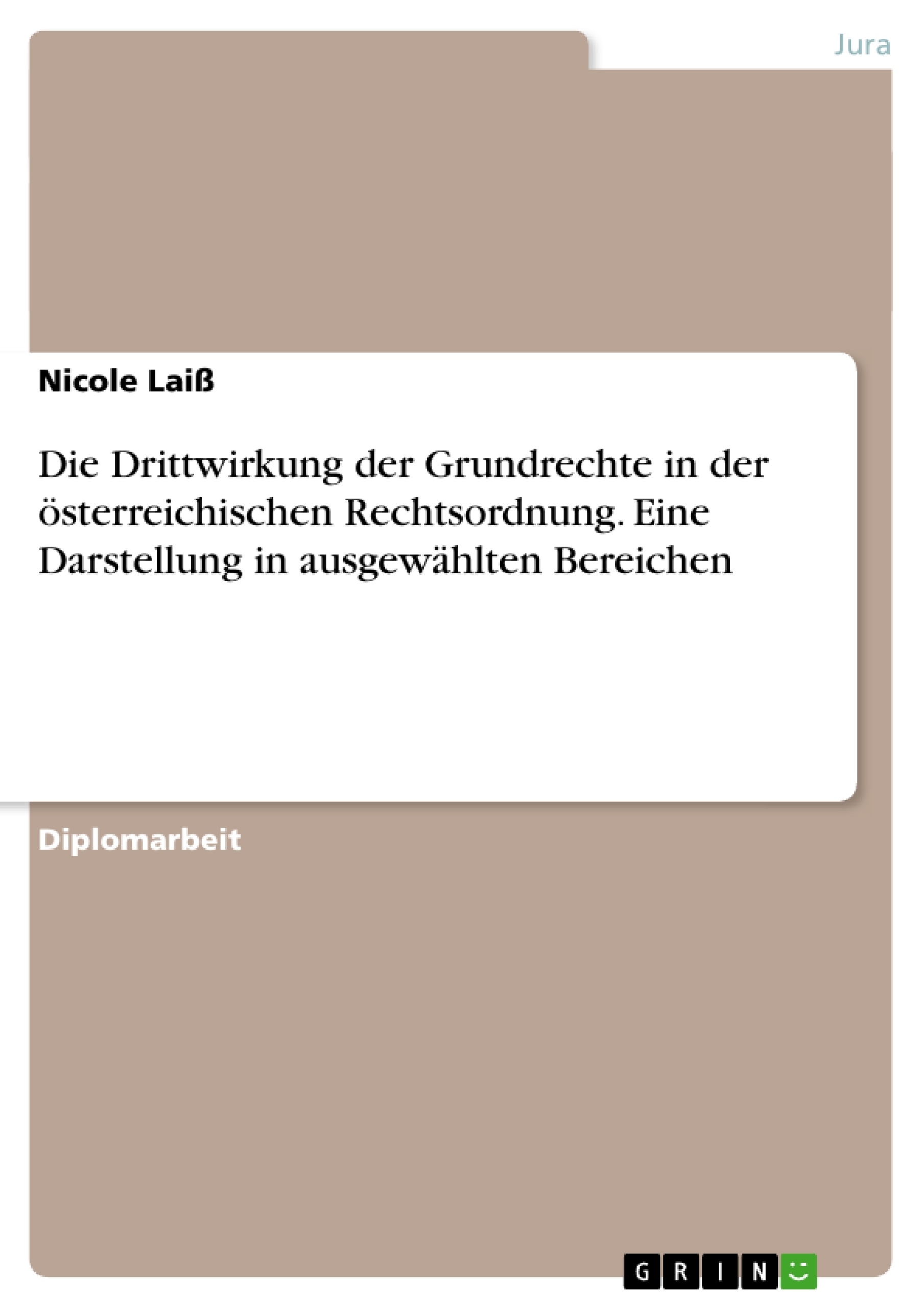In dieser Diplomarbeit wird der spannenden Frage nachgegangen, ob
Grundrechte auch in den vielfältigen Rechtsverhältnissen zwischen
Privatpersonen wirken. Es handelt sich hierbei um das so genannte
Drittwirkungsphänomen der Grundrechte.
Der ursprünglichen Konzeption zufolge wirken Grundrechte einzig und
allein in den Verhältnissen zwischen Staat und Einzelperson. Grundrechte sind
demnach staatsgerichtete Abwehrrechte. Es stellt sich jedoch berechtigterweise
die Frage, ob darin die Wirkung dieser wichtigen Rechtspositionen schon
erschöpft ist, oder ob ein geändertes Grundrechtsverständnis
eine Ausweitung der Schutzwirkung der Grundrechte hin zur/zum
Einzelnen rechtfertigt bzw vielleicht sogar verlangt. Immerhin finden sich auch in
den Rechtsverhältnissen und -beziehungen inter privatos zunehmend
Machtkonstellationen, die an das Ungleichgewicht zwischen Staat und BürgerIn
erinnern. Diesen Erscheinungen muss man versuchen in gewisser Weise
entgegenzuwirken, um Freiheit und Selbstbestimmung der Menschen
aufrechterhalten zu können. Eine Möglichkeit zur Gegensteuerung würde die
Drittwirkung der Grundrechte bieten. Auf diese Weise könnten die in den
Grundrechten zum Ausdruck kommenden Werte umfassend realisiert und
gewährleistet werden.
Aber gibt es überhaupt so etwas wie Drittwirkung? Und wenn ja, wie wird
die Drittwirkung der Grundrechte in Österreich gehandhabt? Welche
Grundrechte sind drittwirkungsgeeignet?
Um diesen Fragen auf den Grund gehen zu können, ist es zuerst einmal
nötig, die allgemeinen Grundrechtslehren und den Wandel des
Grundrechtsverständnisses darzustellen. Davon ausgehend werden dann Lehre und Rechtsprechung zur Drittwirkung behandelt. Weiters ist auf die Rolle der
Privatautonomie iZm der Drittwirkung einzugehen. Auch die Bereiche
Persönlichkeitsschutz und europäischer Grundrechtsschutz werden in den
Fragenkomplex der Grundrechtsdrittwirkung einbezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Grundrechte - Allgemeine Lehren
- Rechtsnatur und Arten der Grundrechte
- Grundrechtstheorien
- Grundrechtsträger
- Grundrechtsverpflichtete
- Rechtsdurchsetzung
- Der Bedeutungswandel der Grundrechte
- Die Aufgabe der Grundrechte im ursprünglichen Sinn
- Das neuere Verständnis der grundrechtlichen Schutzfunktion
- Die Drittwirkung der Grundrechte
- Problemstellung
- Die Fiskalgeltung der Grundrechte
- Warum Drittwirkung?
- Die Erscheinungsformen der Drittwirkung
- Allgemeines
- Die Theorie von der unmittelbaren Drittwirkung
- Die Theorie von der mittelbaren Drittwirkung
- Die Theorie von der Mediatisierung der Grundrechtsgeltung
- Die Theorie von den grundrechtlichen Schutzpflichten
- Grundrechtsschutz und Privatautonomie
- Grundrechte und Persönlichkeitsschutz
- Die Drittwirkung im Kontext der Europäisierung der Grundrechte
- Der Einfluss der EMRK auf die Drittwirkungsproblematik
- Die Drittwirkung der Grundrechte im Rahmen der Europäischen Union
- Ausgewählte Einzelgrundrechte und deren Eignung für die Drittwirkung
- Allgemeines
- Das Recht auf Gleichheit und der Schutz vor Diskriminierung
- Das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens
- Das Recht auf Datenschutz
- Das Recht auf Glaubens- und Gewissensfreiheit
- Das Recht auf freie Kommunikation
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Drittwirkung der Grundrechte in der österreichischen Rechtsordnung. Im Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit die Grundrechte auch für das Verhältnis zwischen Privaten gelten und welche Auswirkungen dies auf die Anwendung des Zivilrechts hat.
- Die unterschiedlichen Theorien der Drittwirkung
- Der Einfluss der Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) und der Europäischen Union (EU) auf die Drittwirkung
- Die Anwendung der Drittwirkung in ausgewählten Bereichen des österreichischen Rechts, wie z.B. dem Datenschutz, dem Recht auf Gleichheit und dem Recht auf freie Meinungsäußerung
- Die Bedeutung der Drittwirkung für den Schutz der Grundrechte im Kontext der Individualisierung und Globalisierung
- Die Herausforderungen und Chancen der Drittwirkung für die österreichische Rechtsordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Drittwirkung der Grundrechte ein und skizziert die Problematik im Kontext der österreichischen Rechtsordnung.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den allgemeinen Lehren der Grundrechte und erläutert ihre Rechtsnatur, Arten, Träger und Verpflichtete.
Das dritte Kapitel analysiert den Bedeutungswandel der Grundrechte in der österreichischen Rechtsordnung. Es wird auf den ursprünglichen Sinn der Grundrechte und deren heutige Schutzfunktion eingegangen.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Drittwirkung der Grundrechte. Es werden die verschiedenen Theorien der Drittwirkung vorgestellt und deren Argumente sowie Kritikpunkte beleuchtet.
Das fünfte Kapitel untersucht die Anwendung der Drittwirkung in den Bereichen des Persönlichkeitsschutzes.
Das sechste Kapitel analysiert den Einfluss der Europäisierung der Grundrechte auf die Drittwirkungsproblematik. Es wird auf die Bedeutung der EMRK und der EU für die Entwicklung des Grundrechtsschutzes im Privatrecht eingegangen.
Das siebte Kapitel befasst sich mit der Eignung ausgewählter Einzelgrundrechte für die Drittwirkung. Es wird auf das Recht auf Gleichheit und den Schutz vor Diskriminierung, das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, das Recht auf Datenschutz, das Recht auf Glaubens- und Gewissensfreiheit sowie das Recht auf freie Kommunikation eingegangen.
Schlüsselwörter
Drittwirkung, Grundrechte, österreichische Rechtsordnung, Zivilrecht, Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), Europäische Union (EU), Datenschutz, Gleichheit, freie Meinungsäußerung, Individualisierung, Globalisierung.
- Quote paper
- Nicole Laiß (Author), 2003, Die Drittwirkung der Grundrechte in der österreichischen Rechtsordnung. Eine Darstellung in ausgewählten Bereichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16842