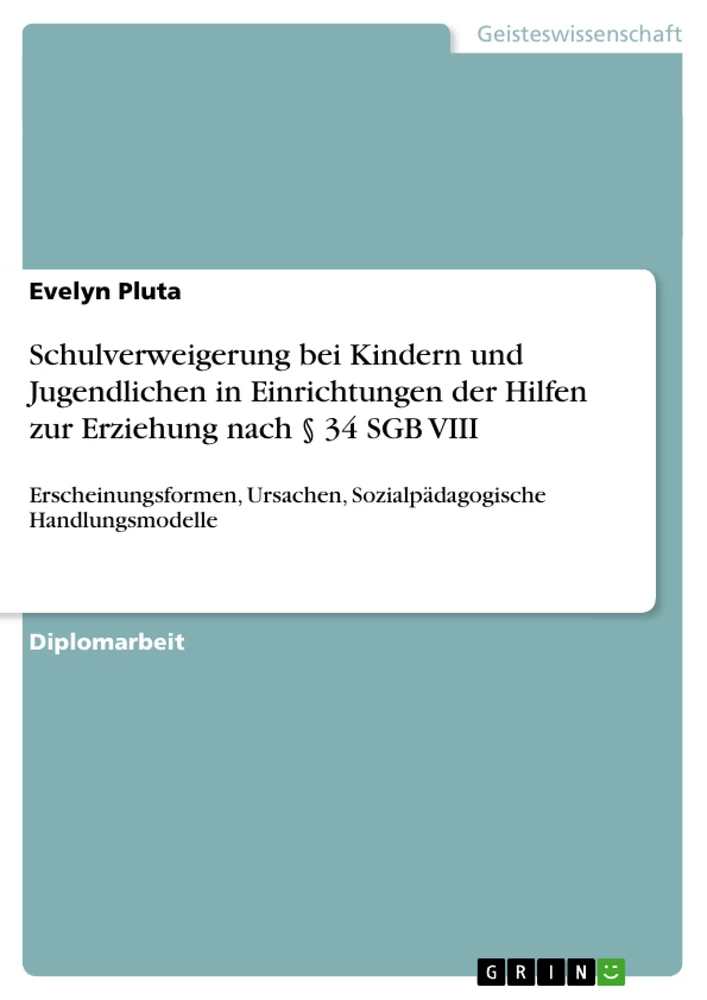Schulverweigerung - ein Thema, das gerade im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen in Heimbetreuung häufig genannt und diskutiert wird. Doch wie äußern sich schulverweigernde Verhaltensweisen bei heimbetreuten Kindern und Jugendlichen im Einzelnen? Welche Auftretensformen, möglichen Hintergründe und Ursachen gibt es? Wie könnten Lösungsansätze bzw. pädagogische Handlungsperspektiven aussehen? Mit dem Versuch einer Beantwortung dieser Fragen beschäftigt sich vorliegendes Buch.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil I PHÄNOMEN SCHULAVERSION
- Schulabsentismus (RICKING/NEUKÄTER)
- Erscheinungsformen und Ursachen
- Theoretischer Zugang: Schulabsentismus im Rahmen einer ökologischen Erziehungswissenschaft - ein heuristisches Modell
- Schulaversion und Unterrichtsmeidende Verhaltensweisen (SCHULZE/WITTROCK)
- Erscheinungsformen und Ursachen
- Theoretischer Zugang: Unterrichtsmeidende Verhaltensweisen im feldtheoretischen Modell LEWINS
- Schulverweigerung (THIMM)
- Erscheinungsformen und Ursachen
- Theoretischer Zugang: Schulverweigerung in einem multiperspektivischen Modell
- Fazit
- Schulabsentismus (RICKING/NEUKÄTER)
- Teil II Schulverweigerung bei Kindern und Jugendlichen in Heimbetreuung
- Das Heimkind als Schulkind
- Erscheinungsformen und Ursachen von Schulaverweigerung bei heimbetreuten Kindern und Jugendlichen
- Auftretensformen
- Hintergründe der schulverweigernden Verhaltensweisen
- Zusammenfassung
- Teil III Handlungsperspektiven für Heim und Schule beim Umgang mit schulverweigernden Kindern und Jugendlichen
- Prävention
- Möglichkeiten für Heimeinrichtungen
- Möglichkeiten für Schulen
- Kooperation zwischen Heim und Schule
- Schwierigkeiten in der Kooperation
- Fallbezogene Kooperation - Sozialpädagogisches Fallverstehen
- Interventionsmöglichkeiten bei massiver Schulverweigerung - Angebote außerhalb des Regelschulsystems
- Projekt Schulstation „Robinson“
- SCHULTZ – HENCKE – HEIME
- Zusammenfassung
- Prävention
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht schulaversive Verhaltensweisen bei in Heimen betreuten Kindern und Jugendlichen. Die Arbeit zielt darauf ab, Auftretensformen und Ursachen dieses Verhaltens zu analysieren und Handlungsperspektiven für Heime und Schulen aufzuzeigen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Kooperation zwischen diesen Institutionen.
- Auftretensformen schulverweigernden Verhaltens bei Heimkindern
- Ursachen für Schulaversion im Kontext von Heimerziehung
- Handlungsmöglichkeiten zum Abbau schulverweigernden Verhaltens
- Kooperation zwischen Heimen und Schulen
- Interventionsangebote für massiv schulaversive Kinder und Jugendliche
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Entstehung des Forschungsschwerpunkts aufgrund von Beobachtungen während eines Praktikums im Jugendamt. Es werden zentrale Forschungsfragen formuliert, die sich auf Auftretensformen, Ursachen, Handlungsmöglichkeiten und Zuständigkeiten bei Schulaversion beziehen. Die methodische Vorgehensweise wird skizziert: zunächst wird der wissenschaftliche Forschungsstand zum Thema Schulaversion allgemein beleuchtet, bevor die Situation von Heimkindern im Detail betrachtet wird. Schließlich werden Handlungsperspektiven für Heime und Schulen analysiert.
Teil I PHÄNOMEN SCHULAVERSION: Dieser Teil bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema Schulaversion, indem er verschiedene theoretische Zugänge und Modelle (Ricking/Neukäter, Schulze/Wittrock, Thimm) vergleicht und deren Erklärungsansätze für Schulabsentismus, Schulaversion und Schulverweigerung darstellt. Die Kapitel analysieren Erscheinungsformen und Ursachen dieser Phänomene aus unterschiedlichen Perspektiven.
Teil II Schulverweigerung bei Kindern und Jugendlichen in Heimbetreuung: Dieser Teil konzentriert sich auf die spezifischen Herausforderungen von Schulaversion bei Kindern und Jugendlichen in Heimen. Er untersucht die Erscheinungsformen und Hintergründe von Schulverweigerung in diesem Kontext, beleuchtet die Rolle der Familie, der Einrichtung, der Peergroup und der Schule selbst. Die Zusammenhänge zwischen Heimerziehung und schulaversiven Verhaltensweisen werden detailliert analysiert.
Teil III Handlungsperspektiven für Heim und Schule beim Umgang mit schulverweigernden Kindern und Jugendlichen: Dieser Teil befasst sich mit präventiven Maßnahmen und der Kooperation zwischen Heimen und Schulen im Umgang mit schulverweigernden Kindern und Jugendlichen. Es werden sowohl Möglichkeiten für Heime als auch für Schulen aufgezeigt, um Schwierigkeiten in der Kooperation zu überwinden und fallbezogene Kooperationen zu etablieren. Der Fokus liegt auf Interventionsmöglichkeiten für Fälle von massiver Schulverweigerung, inklusive der Vorstellung konkreter Projekte (z.B. Schulstation „Robinson“, SCHULTZ – HENCKE – HEIME).
Schlüsselwörter
Schulaversion, Schulverweigerung, Schulabsentismus, Heimerziehung, Hilfen zur Erziehung (§ 34 SGB VIII), Jugendhilfe, Schule, Kooperation, Prävention, Intervention, ökologischer Ansatz, Feldtheorie, multiperspektivisches Modell, Risikofaktoren.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Schulaversive Verhaltensweisen bei in Heimen betreuten Kindern und Jugendlichen
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht schulaversive Verhaltensweisen, wie Schulabsentismus, Schulaversion und Schulverweigerung, bei Kindern und Jugendlichen in Heimen. Sie analysiert die Auftretensformen und Ursachen dieses Verhaltens und entwickelt Handlungsperspektiven für Heime und Schulen, mit einem Schwerpunkt auf der Kooperation zwischen diesen Institutionen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Auftretensformen schulverweigernden Verhaltens bei Heimkindern, Ursachen für Schulaversion im Kontext von Heimerziehung, Handlungsmöglichkeiten zum Abbau schulverweigernden Verhaltens, Kooperation zwischen Heimen und Schulen sowie Interventionsangebote für massiv schulaversive Kinder und Jugendliche.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Teil I bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema Schulaversion anhand verschiedener theoretischer Modelle (ökologischer Ansatz, Feldtheorie, multiperspektivisches Modell). Teil II konzentriert sich auf die spezifischen Herausforderungen von Schulaversion bei Heimkindern, untersucht Erscheinungsformen und Hintergründe und analysiert die Rolle von Familie, Heim, Peergroup und Schule. Teil III befasst sich mit präventiven Maßnahmen und der Kooperation zwischen Heimen und Schulen, einschließlich Interventionsmöglichkeiten für Fälle von massiver Schulverweigerung und der Vorstellung konkreter Projekte.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene theoretische Ansätze, darunter der ökologische Ansatz (Ricking/Neukäter), die Feldtheorie (Lewin, angewendet von Schulze/Wittrock) und ein multiperspektivisches Modell (Thimm) zur Erklärung von Schulabsentismus, Schulaversion und Schulverweigerung.
Welche konkreten Beispiele für Interventionsmöglichkeiten werden genannt?
Die Arbeit nennt als Beispiele für Interventionsmöglichkeiten bei massiver Schulverweigerung die Schulstation „Robinson“ und SCHULTZ – HENCKE – HEIME.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Schulaversion, Schulverweigerung, Schulabsentismus, Heimerziehung, Hilfen zur Erziehung (§ 34 SGB VIII), Jugendhilfe, Schule, Kooperation, Prävention, Intervention, ökologischer Ansatz, Feldtheorie, multiperspektivisches Modell, Risikofaktoren.
Wie wird die Kooperation zwischen Heim und Schule betrachtet?
Die Kooperation zwischen Heim und Schule wird als zentraler Aspekt zur Bewältigung von Schulaversion betrachtet. Die Arbeit analysiert Schwierigkeiten in der Kooperation und zeigt Möglichkeiten für eine fallbezogene, sozialpädagogisch fundierte Zusammenarbeit auf.
Welche Ursachen für Schulaversion bei Heimkindern werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Ursachen für Schulaversion bei Heimkindern, unter anderem die Rolle der Familie, des Heims, der Peergroup und der Schule selbst. Die Zusammenhänge zwischen Heimerziehung und schulaversiven Verhaltensweisen werden detailliert analysiert.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Auftretensformen und Ursachen schulverweigernden Verhaltens bei Heimkindern zu analysieren und Handlungsperspektiven für Heime und Schulen aufzuzeigen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Kooperation zwischen diesen Institutionen.
- Arbeit zitieren
- Evelyn Pluta (Autor:in), 2003, Schulverweigerung bei Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung nach § 34 SGB VIII, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16833