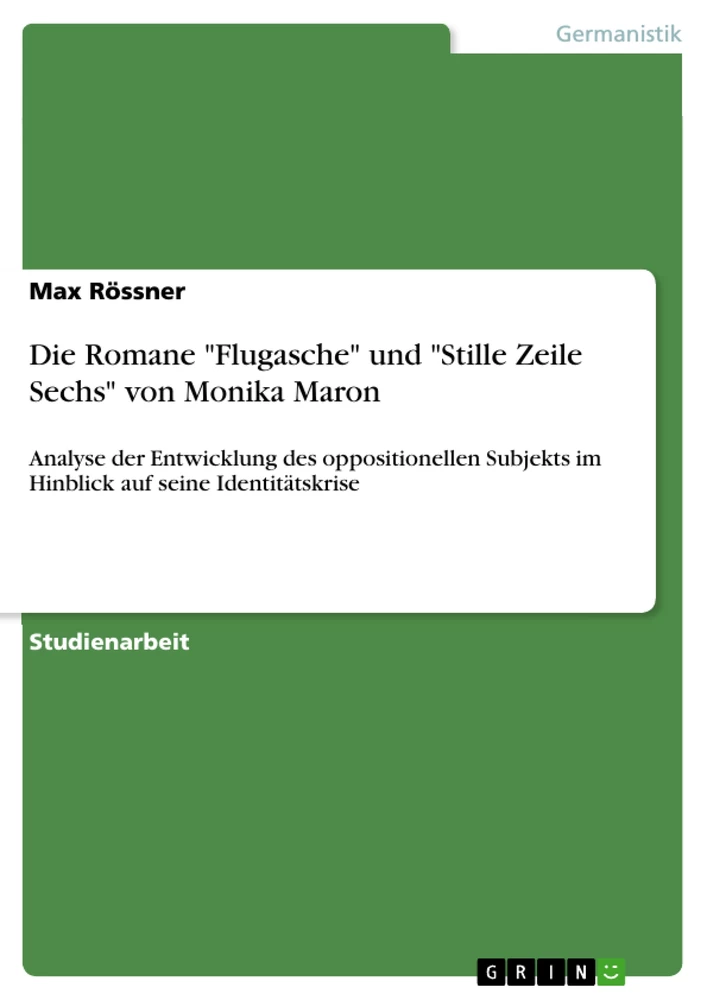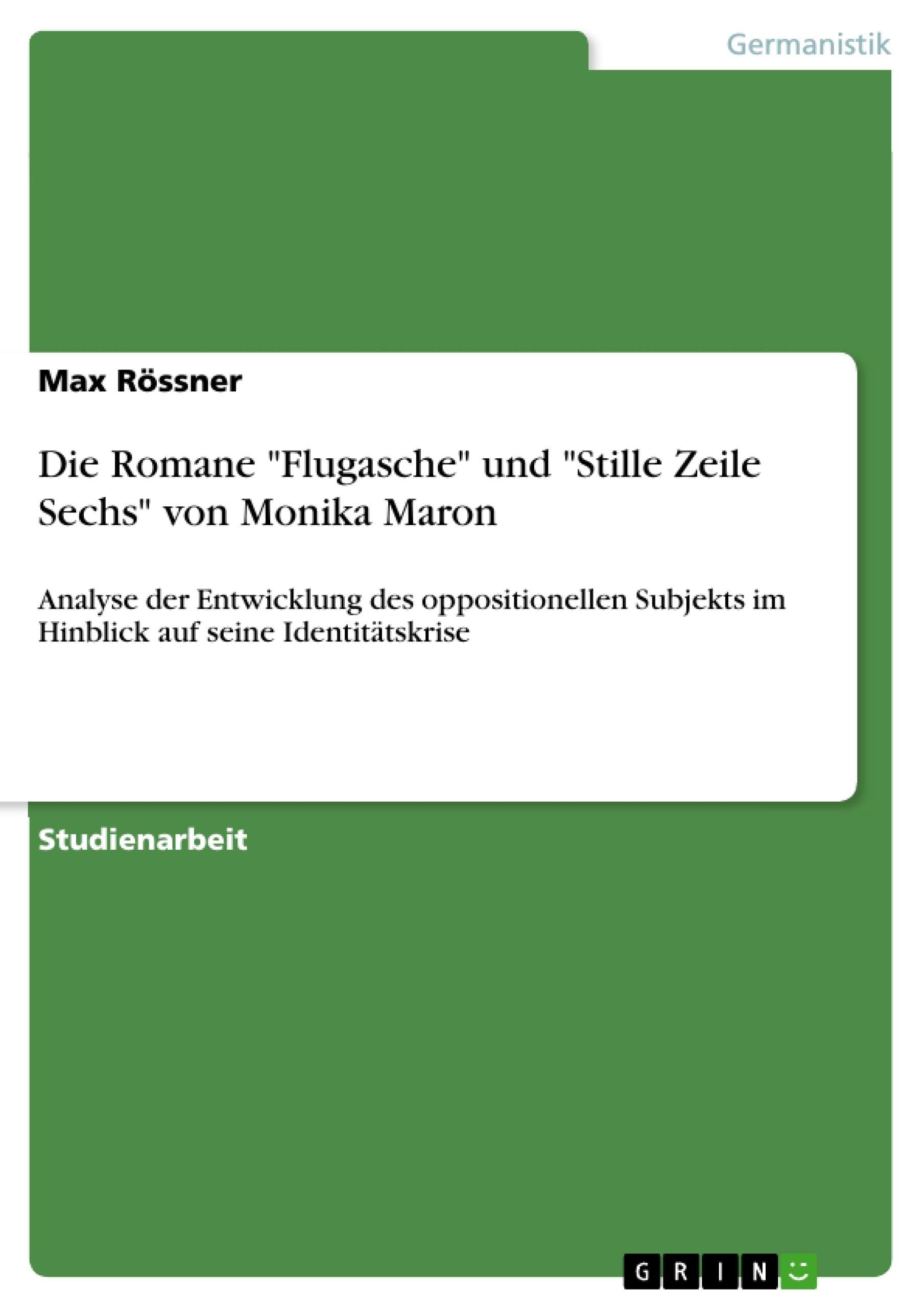Kampf gegen die Klasse und Blick zurück: Marons literarische Initiative und ihr Schaffen
nach der Wende
Monika Marons frühe belletristische Tätigkeit ist von zwei Faktoren bestimmt: Einerseits
arbeitet sie zu Beginn der siebziger Jahre als Reporterin bei der Frauenzeitschrift Für Dich,
verfasst nicht weniger als drei Reportagen allein über Bitterfeld, „[…] aus denen später die
Anregungen für ihren ersten Roman Flugasche […]“ hervorgehen. Die andere dominierende
Einflussgröße ist der Stiefvater, Karl Maron, Innenminister der DDR von 1955 bis 1963. Von
zukunftsweisender Bedeutung werden Arbeit und Abkunft für Maron, als sie Mitte der
siebziger Jahre mit der Niederschrift ihres Erstlingswerks beginnt; die Protagonistin hierfür
wählt sie aus dem eigenen Milieu, Journalistin wie sie, wie sie auch vor die Frage gestellt,
welche Art Verantwortung ein publizierender Mensch für das Gemeinwohl trägt. Aus
heutiger Sicht mag diese Formulierung vermessen oder überheblich klingen; doch in einem
Gefängniszellenstaat, dessen Informationsfluss nur sporadisch und mühsam zirkuliert, und in
dem noch dazu jede Manuskriptseite von der Zensur zwei Mal umgedreht wird, hat „[…]die
Literatur noch jene wegweisende, sinnstiftende und fast religiöse Bedeutung.“ Wer, wie
Maron, das Privileg einer Sendung genießt, trägt im gleichen demagogischen Atemzug auch
die Bürde der Verantwortung. Spätestens mit der Ausbürgerung des Dissidenten Biermann
`76 wird Maron die vom Staat eingehämmerte Eingleisigkeit der Gedanken bewusst. Und sie
beginnt zu begreifen, dass ihre bisherige Arbeit nicht mehr abgibt als ein adrett lackiertes
Marionettentheater, mit dem von den Missständen des Staates abgelenkt werden soll.
Insofern ist es nicht übertrieben, den Schreibimpuls, „[…] ihren Angelpunkt in einer
existentiellen Erfahrung der Autorin […]“ zu verorten. „Dieser Prozess habe die Arbeit zu
dem Roman Flugasche begleitet[…]“, wird Maron später bekennen. Sie spricht von zwei
gänzlich verschiedenen Teilen, deren Trennriss sich quer durch das Manuskript zieht. [...]
Kampf gegen die Klasse und Blick zurück: Marons literarische Initiative und ihr Schaffen nach der Wende
Monika Marons frühe belletristische Tätigkeit ist von zwei Faktoren bestimmt: Einerseits arbeitet sie zu Beginn der siebziger Jahre als Reporterin bei der Frauenzeitschrift Für Dich, verfasst nicht weniger als drei Reportagen allein über Bitterfeld, „[…] aus denen später die Anregungen für ihren ersten Roman Flugasche […]“[1] hervorgehen. Die andere dominierende Einflussgröße ist der Stiefvater, Karl Maron, Innenminister der DDR von 1955 bis 1963. Von zukunftsweisender Bedeutung werden Arbeit und Abkunft für Maron, als sie Mitte der siebziger Jahre mit der Niederschrift ihres Erstlingswerks beginnt; die Protagonistin hierfür wählt sie aus dem eigenen Milieu, Journalistin wie sie, wie sie auch vor die Frage gestellt, welche Art Verantwortung ein publizierender Mensch für das Gemeinwohl trägt. Aus heutiger Sicht mag diese Formulierung vermessen oder überheblich klingen; doch in einem Gefängniszellenstaat, dessen Informationsfluss nur sporadisch und mühsam zirkuliert, und in dem noch dazu jede Manuskriptseite von der Zensur zwei Mal umgedreht wird, hat „[…]die Literatur noch jene wegweisende, sinnstiftende und fast religiöse Bedeutung.“[2] Wer, wie Maron, das Privileg einer Sendung genießt, trägt im gleichen demagogischen Atemzug auch die Bürde der Verantwortung. Spätestens mit der Ausbürgerung des Dissidenten Biermann `76 wird Maron die vom Staat eingehämmerte Eingleisigkeit der Gedanken bewusst. Und sie beginnt zu begreifen, dass ihre bisherige Arbeit nicht mehr abgibt als ein adrett lackiertes Marionettentheater, mit dem von den Missständen des Staates abgelenkt werden soll. Insofern ist es nicht übertrieben, den Schreibimpuls, „[…] ihren Angelpunkt in einer existentiellen Erfahrung der Autorin […]“[3] zu verorten. „Dieser Prozess habe die Arbeit zu dem Roman Flugasche begleitet[…]“[4], wird Maron später bekennen. Sie spricht von zwei gänzlich verschiedenen Teilen, deren Trennriss sich quer durch das Manuskript zieht. Dem feinen Gespür einer Virtuosin folgend, bemüht sie sich nicht einmal, diese Demarkationslinie zu kaschieren; kein Lapsus ist ihr unterlaufen, sondern der stilistische Ausdruck eines tiefen Einschnitts in die Persönlichkeit. Das wird am Text nachzuweisen sein.
Während der Wendezeit beherrscht für Monate ein einziges Thema die nun gesamtdeutschen Feuilletons: der deutsch- deutsche Literaturstreit wütet und zweit das Land erneut. Die mitüberführte literarische Elite des obsoleten Staats wird plötzlich mit freiheitlichen Moralvorstellung konfrontiert, „[…] Schlagwörter wie Gesinnungsästhetik […], Stillhalteliteratur […]“[5] schmähen ihren Rang. Allen voran Christa Wolf und Hermann Kant stehen unter dem Verdacht, irreversibel indoktriniert worden zu sein. Ihnen werden Amoralität unterstellt und opportunistische Pakte mit der SED. Um Monika Maron hingegen ist es angenehm ruhig in dieser Zeit; durch regimekritische Bücher wie eben Flugasche scheint sie über allen Zweifel erhaben zu sein. Der Passierschein in die westdeutsche Kulturlandschaft wird ihr ohne Umwege erteilt. In dieser erhitzten Stimmung veröffentlicht sie 1991 ihren nächsten Roman: Stille Zeile Sechs. Seine Handlung führt den Leser einige Jahre zurück, in die Abenddämmerung des Arbeiter- und Bauernstaats. Und wieder generiert Marons elterliche Prägung Motivik und Thema; zwar ist die Protagonistin mittlerweile keine Journalistin mehr, aber wieder geht es um das Schreiben, wieder stellt sich die Staatsmacht zwischen die Heldin und deren Ziele, diesmal in Gestalt von „[…] Professor Beerenbaum, […] ein mächtiger Mann […]“[6]. Unschwer lassen sich von dieser Person zahlreiche Parallelen zu Marons Stiefvater ziehen; auch wenn es allzu vorschnell wäre, Stille Zeile Sechs als eins- zu- eins- Rekonstruktion ihrer Autobiographie zu deuten- etwas aber bleibt deutlich: sie schöpft aus dem in ihrer Jugend verwurzelten Potential, entfaltet ein Szenario, dessen Sprengkraft sie sehr wohl einschätzen kann; und das aus eigener Erfahrung heraus.
Und schließlich gibt es doch noch den Eklat um ihre Person, auch wenn auch dezent ausfällt: 1995 enttarnt der Spiegel ihre Mithilfe für die Staatssicherheit, der sie einige Jahre als Informationszulieferin in den Akten geführt hat. Maron distanziert sich von den Anschuldigungen. Es sei ihr darum gegangen, von innen heraus etwas zu verändern, wie die „[…] Stasimitarbeiter von den positiven Seiten des anderen Systems zu überzeugen.“[7] Es sei jugendliche Hybris gewesen, kein Einvernehmen. Zwar bleibt jetzt, fünf Jahre nach der ersten Welle, eine polemische Hetzjagd aus , kein Blechtrommelwirbel fällt ein über die Wildsau, wie Marons schmähender Deckname nach der Weigerung weiterer Spitzeltätigkeit 1978 lautet; aber die Fragen werden lauter: was kann ein Schriftsteller in einem Unrechtsstaat tun, zu welchen Mittel darf/ soll er greifen, um sich dem politischen Offizialdiskurs zu entziehen? Vier Jahre zuvor hat sich Maron mit Stille Zeile Sechs unter anderem dieser Untersuchung gewidmet.
Beiden Romanen ist als Grundlage die Bedrohung der Identität eigen, ebenso die Relevanz der Sprache, mit deren Hilfe sich (vermeintliche) Wahrheit erst konstituiert. Wie das im Konkreten ausgeführt ist, wird im Anschluss erläutert.
Analyse des Romans Flugasche von 1981
In der DDR darf Marons Erstling nicht erscheinen. Als zu offenkundig empfindet die zuständige Behörde die Anspielung der schlicht B. genannten Romanstadt. Den Funktionären ist bewusst, dass B. für „[…] die schmutzigste Stadt Europas […]“[8] steht, für Bitterfeld. Doch nicht nur in der DDR schwören sich die Kritiker hauptsächlich auf die Darstellung der giftsprühenden, maroden Betriebe ein. Selbst in Westdeutschland grenzen viele Rezensenten „[…] den Roman Flugasche von Monika Maron auf das Thema Umweltzerstörung ein.“[9] Es ist anzunehmen, dass die Möglichkeit, dem kleinen abtrünnigen Bruder unmittelbar zu schaden, indem man seine wirtschaftliche Rückständigkeit betont, allzu sehr verlockt; und auch, dass diese Bankrotterklärung einer tiefer gehenden und womöglich nur noch hermeneutisch relevanten Analyse des Textes in den meisten Zeitungsredaktionen vorgezogen wird. Ob sich Marons Buch darin erschöpft oder gerade erst durch seine Tiefenstruktur das System der SED- Diktatur angreift, soll nun überprüft werden.
Der Bruch mit der Umwelt
Der Stein, der Josefa ins Schreiten und schließlich Überschreiten bringt, ist in gewissem Sinn von Anfang an kontaminiert. Die junge Journalistin soll einen neuen Beitrag für ihre Zeitung schreiben, „[i]m Plan steht: Reportage über B.“[10] Als sie B. inspiziert, ist sie sofort erschüttert über die diabolischen Arbeitsverhältnisse des Industriestandortes, inmitten von „[…] Dreckladung[en] Tag für Tag und Nacht für Nacht […]“[11] und „[…] gebeugten Menschen in den Aschekammern […]“[12]. Wie soll sie von dem Elend berichten? Sie steht vor einer Entscheidung, die wegweisend für ihre Zukunft wird: entweder schönt sie den Bericht- dann verhält sie sich linientreu. Oder aber sie gibt wieder, was sie gesehen hat- das würde aber einen unverhüllten Affront gegen die Obrigkeit bedeuten, es wäre ein Ausscheren aus der Marschroute. Wenige Seiten später- noch ist Josefas Reaktion ungewiss- wird eine zurückliegende Redaktionssitzung geschildert, in deren Verlauf sich einige von Josefa durchaus gebilligte Abschwächungen alter Reportagen andeuten. Der typische Prozess der Geschmacksneutralisierung von Beiträgen ist ihr also vertraut. Daher erscheint die Deutung mancher Exegeten, Josefa habe „ […] in ihrem Leben bisher die Augen vor der Wirklichkeit verschlossen […]“[13] und erst B. habe sie sehend gemacht, reichlich hymnisch und vom erwarteten Ergebnis beeinflusst. Eher könnte man ihre Weigerung weiterer Eilfertigkeit als Bekenntnis auffassen: hat sie sich bisher in Gehorsam geübt, bringt das Leid der Arbeiter von B. ihre Stillhaltetaktik endlich zum Wanken. Folgerichtig schreibt sie die einzig akzeptable, eben die authentische Version und bekennt sich so „[…] mit offenem Visier zur Wahrheit […]“[14]. Noch weiß sie nicht, mit welchen Restriktionen sie zu rechnen hat im Fall einer Veröffentlichung. Erst nach und nach muss sie zunehmend enttäuscht zur Kenntnis nehmen, wie ihre Aufrichtigkeit auf eine Mauer aus Ignoranz und Eskapismus trifft; mit bangem Blick auf den subversiven Charakter des Manuskripts äußert Luise, eine Freundin und Kollegin von Josefa, der Sozialismus sei, zumindest verglichen mit dem Nationalsozialismus, ein Segen. Wenn man aber, wie die wesentlich jüngere Josefa, diesen nicht erlebt habe, solle man „[…] die Gegenwart an der Zukunft messen […]“[15]. Josefa will von diesen Mittel- Zweck- Phrasen jedoch nichts wissen. Sie möchte im Jetzt und Hier die Wahrheit sagen können. Somit wird Josefa aber in eine absurde Situation gedrängt, die ihr jegliche Mündigkeit abspricht: die Gesellschaft „[…] wird für sie lebensfeindlich, da sie ihre Weltsicht nicht artikulieren darf.“[16] Gleichzeitig suggerieren die alten Eliten der Generation der Nachgeborenen ganz pauschal fehlende Einsicht, schlicht: Dummheit. Will Josefa ihre eigene Sichtweise auf B. dennoch legitimieren, muss sie den kompletten ideologischen Überbau, also alle staatlichen Prinzipien abwerfen. Nur dann ist die Tat mit ihrem Gewissen vereinbar. Genau an dieser Stelle geht Flugasche über das Anliegen der zeitgleich gegründeten Partei der Grünen hinaus, indem die Handlung „ […] die innere und äußere Beschädigung des Menschen in Beziehung setzt zur zerstörten Umwelt am Beispiel Bitterfelds.“[17] Als sinnlich wahrnehmbares bewegendes Moment taugt die Pollution noch, als Allegorie der Vergiftung ebenfalls; aber als psychologisches Grundraster wäre sie schlicht banal, denn kaum ein Mensch erbost absichtlich einen Guillotinenstaat, nur um einen Kilometer entfernten Busch zu beschirmen; und nach spätestens 80 Seiten ist der Naturschutz dann auch überflügelt.
[...]
[1] Dietrich, Kerstin: „DDR-Literatur“ im Spiegel der deutsch- deutschen Literaturdebatte: „DDR- Autorinnen“ neu bewerten. 1. Auflage. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag 1998 (= Europäische Hochschulschriften: Reihe 1: Deutsche Sprache und Literatur; 1698). (S. 37)
[2] Ebd. (S. 75)
[3] Boli, Katharina: Erinnerung und Reflexion: Retrospektive Lebenskonstruktionen im Prosawerk Moni8ka Marons. 1. Auflage. Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann 2002 (= Würzburger Wissenschaftliche Schriften: Reihe Literaturwissenschaft; 410). (S. 23)
[4] Koch, Lennart: Ästhetik der Moral bei Christa Wolf und Monika Maron: Der Literaturstreit von der Wende bis zum Ende der neunziger Jahre. 1. Auflage. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag 2001 (= Schriften zur Europa- und Deutschlandforschung; 8). (S. 69)
[5] Dietrich, Kerstin (S. 11)
[6] Maron, Monika: Stille Zeile Sechs. Lizenzausgabe. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 1993.
(S. 29)
[7] Koch, Lennart (S. 64)
[8] Maron, Monika: Flugasche: Die Frau in der Gesellschaft. Lizenzausgabe. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 1987. (S. 36)
[9] Dietrich, Kerstin (S. 19)
[10] Maron, Monika: Flugasche (S. 13)
[11] Maron, Monika: Flugasche (S. 16)
[12] Ebd. (S. 20)
[13] Boli, Katharina (S. 19)
[14] Dümmel, Karsten: Identitätsprobleme in der DDR- Literatur der siebziger und achtziger Jahre. 1. Auflage. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag 1997. (S. 181)
[15] Maron, Monika: Flugasche (S. 80)
[16] Boli, Katharina (S. 20)
Häufig gestellte Fragen zu Monika Marons literarischer Initiative und ihrem Schaffen nach der Wende
Worum geht es in Monika Marons frühen belletristischen Arbeiten?
Monika Marons frühe belletristische Tätigkeit ist von ihrer Arbeit als Reporterin bei der Frauenzeitschrift Für Dich und dem Einfluss ihres Stiefvaters, Karl Maron, Innenminister der DDR, geprägt. Ihre Reportagen, insbesondere über Bitterfeld, dienten als Inspiration für ihren ersten Roman Flugasche. Arbeit und familiäre Herkunft beeinflussten ihren Blickwinkel auf die Verantwortung eines publizierenden Menschen in der DDR.
Welche Bedeutung hatte die Literatur in der DDR?
In einem Staat mit eingeschränktem Informationsfluss und Zensur hatte die Literatur eine wegweisende, sinnstiftende und fast religiöse Bedeutung. Schriftsteller trugen eine große Verantwortung, da sie privilegiert waren, ihre Gedanken zu veröffentlichen.
Wie beeinflusste die Ausbürgerung Biermanns Marons Arbeit?
Die Ausbürgerung des Dissidenten Biermann machte Maron die staatlich verordnete Eingleisigkeit der Gedanken bewusst. Sie erkannte, dass ihre bisherige Arbeit nur dazu diente, von den Missständen des Staates abzulenken, was zu einem existentiellen Schreibimpuls führte, der ihren Roman Flugasche prägte.
Was geschah während des deutsch-deutschen Literaturstreits nach der Wende?
Die literarische Elite der DDR wurde mit freiheitlichen Moralvorstellungen konfrontiert und mit Begriffen wie "Gesinnungsästhetik" und "Stillhalteliteratur" kritisiert. Christa Wolf und Hermann Kant gerieten unter Verdacht, irreversibel indoktriniert zu sein, während Monika Maron aufgrund ihrer regimekritischen Bücher zunächst unantastbar schien.
Worum geht es in Marons Roman Stille Zeile Sechs?
Stille Zeile Seile Sechs spielt in der Endphase der DDR und thematisiert erneut den Konflikt zwischen dem Individuum und der Staatsmacht. Die Protagonistin, keine Journalistin mehr, wird in ihrem Schreiben von einem mächtigen Professor Beerenbaum behindert, der Parallelen zu Marons Stiefvater aufweist. Der Roman schöpft aus Marons Jugenderfahrungen und entfaltet ein Szenario mit großer Sprengkraft.
Welche Kontroverse gab es um Marons Person im Jahr 1995?
Der Spiegel enthüllte Marons frühere Mitarbeit für die Staatssicherheit als Informationszulieferin. Maron distanzierte sich von den Anschuldigungen und argumentierte, sie habe von innen heraus etwas verändern wollen. Obwohl es keine Hetzjagd gab, wurden Fragen nach der Rolle und den Mitteln von Schriftstellern in Unrechtsstaaten laut.
Welche zentralen Themen verbinden die Romane Flugasche und Stille Zeile Sechs?
Beiden Romanen liegt die Bedrohung der Identität zugrunde, ebenso wie die Bedeutung der Sprache, mit der (vermeintliche) Wahrheit erst konstituiert wird.
Warum wurde Marons Roman Flugasche in der DDR nicht veröffentlicht?
Die zuständige Behörde empfand die Anspielung auf die Romanstadt B. als zu offenkundig. Es war klar, dass B. für Bitterfeld stand, die "schmutzigste Stadt Europas".
Worauf konzentrierten sich die Kritiker von Flugasche hauptsächlich?
Kritiker in der DDR und in Westdeutschland konzentrierten sich hauptsächlich auf die Darstellung der Umweltzerstörung und der maroden Betriebe in Bitterfeld. In Westdeutschland wurde der Roman oft auf das Thema Umweltzerstörung reduziert, um die wirtschaftliche Rückständigkeit der DDR zu betonen.
Was ist der Auslöser für Josefas Handeln in Flugasche?
Josefa, die junge Journalistin, soll eine Reportage über Bitterfeld schreiben. Sie ist erschüttert über die Arbeitsverhältnisse und die Umweltverschmutzung und muss entscheiden, ob sie die Realität beschönigen oder authentisch berichten soll. Das Leid der Arbeiter bringt ihre Stillhaltetaktik ins Wanken.
Inwiefern geht Flugasche über das Anliegen der Grünen hinaus?
Flugasche setzt die innere und äußere Beschädigung des Menschen in Beziehung zur zerstörten Umwelt am Beispiel Bitterfelds. Die Handlung geht über den reinen Naturschutz hinaus und thematisiert die psychologischen Auswirkungen der Verhältnisse in der DDR.
- Quote paper
- Max Rössner (Author), 2010, Die Romane "Flugasche" und "Stille Zeile Sechs" von Monika Maron, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168275