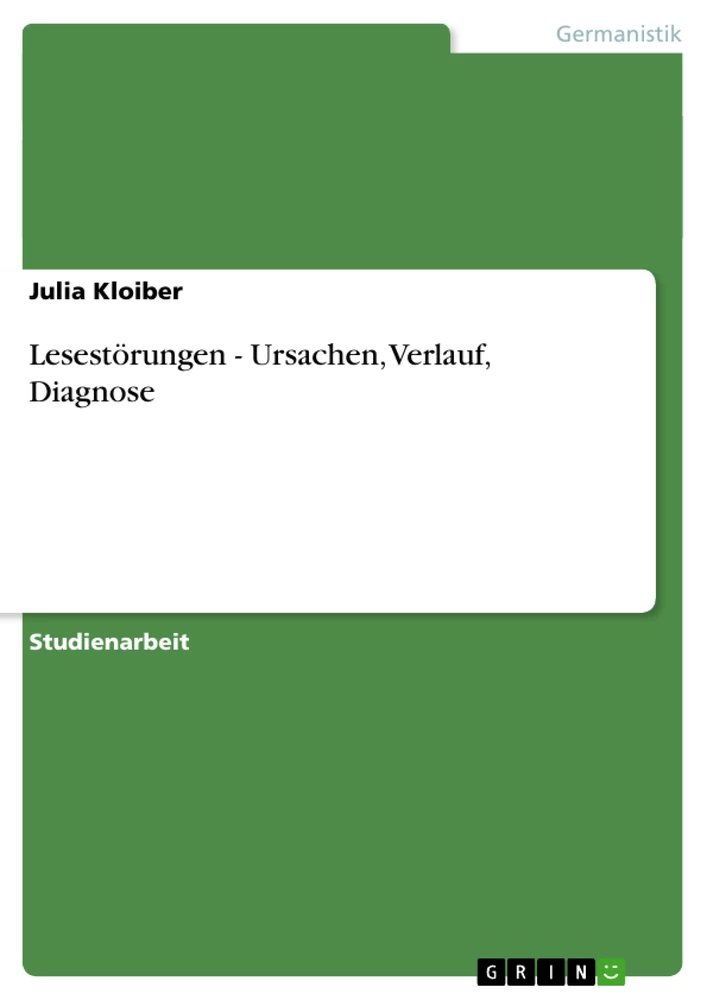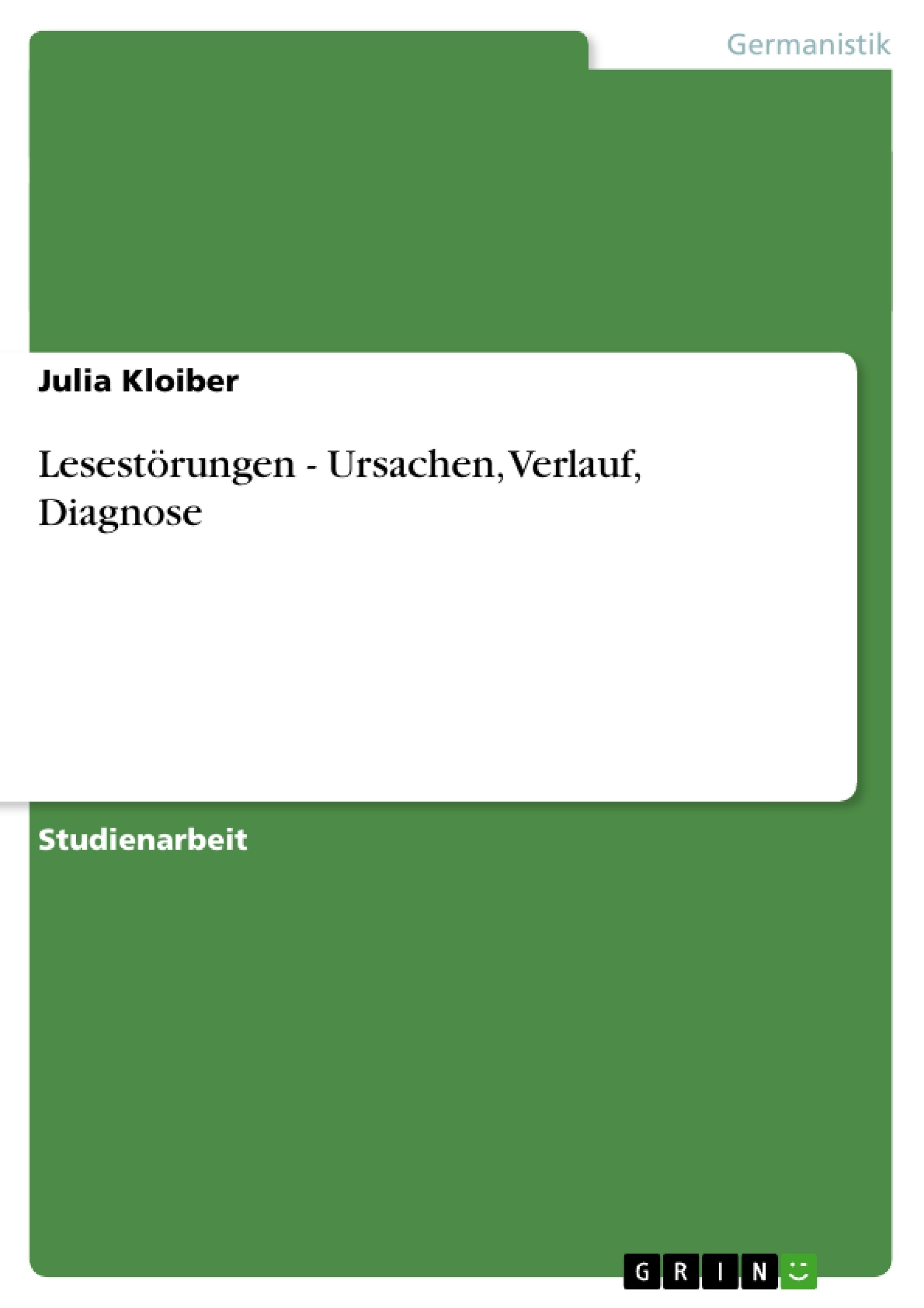Seit Jahrzehnten beschäftigen sich Psychologen mit dem Phänomen der Lesestörungen. Schon Ende des 19. Jahrhunderts gelangten die ersten Ergebnisse von psychologischen Untersuchungen an die Öffentlichkeit. Unzählige Erklärungsansätze trugen jedoch nicht dazu bei, dass dieses Thema von der Gesellschaft akzeptiert wurde. Es ist heutzutage oft noch unvorstellbar, dass es Menschen gibt, die nicht lesen und schreiben können. Dabei belegen neueste Studien, dass rund 10 bis 20 % der Grundschüler unter dem Leseniveau des Durchschnitts liegen. Lesen ist eines der wichtigsten Techniken des Lebens. Viele der Betroffenen schaffen es, ihr Leiden über Jahre hinweg zu verbergen. Sie schämen sich und leben täglich mit der Angst ihr Geheimnis preis geben zu müssen. Sie befürchten ausgegrenzt und verspottet zu werden. Oftmals sind die Ursachen für Lesestörungen der Gesellschaft nicht bekannt. Fälschlicherweise werden Betroffene als dumm, oder blöd bezeichnet und gelten als Außenseiter. Dies muss jedoch nicht so sein.
Dieser Text soll nun einen kleinen Überblick über das Thema Lesestörungen geben. Aufgrund der hohen Anzahl der neurobiologischen, psychologischen und genetischen Befunde und Untersuchungen ist es nicht möglich, jedes Phänomen der Lesestörungen genau zu erläutern. Der Text beschränkt sich auf die wichtigsten Merkmale zu den Ursachen und zum Verlauf von Lesestörungen. Anschließend dazu wird ein kurzer Abriss über die Diagnose gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen
- 3. Lesestörungen
- 3.1. Lesestörungen durch visuelle Wahrnehmungsprobleme
- 3.1.1. Augenbewegungen und Blicksprünge
- 3.1.2. Optische Wahrnehmungsfehler
- 3.2. Lesestörungen durch Probleme der Speicherung und des Behaltens
- 3.3. Lesestörungen durch Probleme der phonologischen Bewusstheit
- 3.4. Lesestörungen durch Entwicklungsstörungen
- 4. Weitere mögliche Ursachen der Lesestörungen
- 4.1. Mögliche organisch-physiologische Ursachen
- 4.2. Fehlende Basisvoraussetzungen als mögliche Ursache
- 5. Diagnose von Lesestörungen
- 5.1. Die klassische Diagnose
- 5.2. Die mehrdimensionale Diagnose
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen Überblick über das Phänomen der Lesestörungen. Aufgrund der Komplexität des Themas konzentriert sie sich auf die wichtigsten Ursachen und den Verlauf von Lesestörungen sowie auf Aspekte der Diagnose. Dabei wird auch der enge Zusammenhang mit Rechtschreibstörungen kurz beleuchtet, der Fokus liegt jedoch auf isolierten Lesestörungen.
- Definition und Abgrenzung von Lesestörung und Leseschwäche
- Ursachen von Lesestörungen (visuelle, phonologische, entwicklungsbedingte Faktoren)
- Rolle visueller Wahrnehmungsprobleme, insbesondere Augenbewegungen und Blicksprünge
- Diagnostische Ansätze bei Lesestörungen
- Weitere mögliche Ursachen wie organisch-physiologische Faktoren und fehlende Basisvoraussetzungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die lange Geschichte der Forschung zu Lesestörungen und deren gesellschaftliche Relevanz. Sie betont die hohe Prävalenz von Lesestörungen, die oft mit Scham und Ausgrenzung der Betroffenen verbunden ist, und kündigt den Fokus der Arbeit auf die wichtigsten Ursachen und den Verlauf von Lesestörungen an, sowie einen kurzen Abriss zur Diagnose.
2. Definitionen: Dieses Kapitel differenziert zwischen Lesestörung und Leseschwäche und führt die allgemein anerkannte Definition nach ICD-10 an. Es betont die neurobiologische und entwicklungsbedingte Grundlage der Lesestörung (auch Legasthenie oder Dyslexie genannt) im Gegensatz zu vorübergehenden Leseschwierigkeiten, die durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden können. Die Definition nach ICD-10 wird ausführlich erläutert und hebt die umschriebene Beeinträchtigung der Lesefertigkeiten hervor, die nicht allein durch Alter, Sehstörungen oder ungeeignete Beschulung erklärt werden kann.
3. Lesestörungen: Dieses Kapitel kategorisiert Lesestörungen nach verschiedenen Ursachen: visuelle Wahrnehmungsprobleme, Probleme mit der Speicherung und dem Behalten von Informationen, phonologische Bewusstheitsprobleme und Entwicklungsstörungen. Es hebt die Komplexität des Themas hervor und konzentriert sich auf die wichtigsten Erscheinungsformen. Im Unterkapitel 3.1 wird der komplexe Prozess der visuellen Informationsverarbeitung und die Rolle der Augenbewegungen (Sakkaden und Resakkaden) bei Lesestörungen detailliert beschrieben. Die Bedeutung der Fovea und die Auswirkungen von zu häufigen und unkontrollierten Blicksprüngen auf das Leseverstehen werden erläutert. Die Rolle visueller Defizite als mögliche Auslöser von Lesestörungen wird diskutiert.
4. Weitere mögliche Ursachen der Lesestörungen: Dieses Kapitel erweitert den Blick auf weitere mögliche Ursachen von Lesestörungen. Es erörtert mögliche organisch-physiologische Ursachen und den Einfluss fehlender Basisvoraussetzungen für das Lesenlernen.
5. Diagnose von Lesestörungen: Der Abschnitt beschreibt verschiedene diagnostische Ansätze zur Erkennung von Lesestörungen. Es wird zwischen der klassischen und der mehrdimensionalen Diagnose unterschieden. Die Charakteristika beider Verfahren werden dargestellt, ohne jedoch ins Detail zu gehen.
Schlüsselwörter
Lesestörungen, Legasthenie, Dyslexie, Leseschwäche, visuelle Wahrnehmung, Augenbewegungen, Sakkaden, phonologische Bewusstheit, Entwicklungsstörungen, Diagnose, ICD-10.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Lesestörungen: Ursachen, Diagnose und Verlauf"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über Lesestörungen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffe. Der Fokus liegt auf den Ursachen, dem Verlauf und der Diagnose von Lesestörungen, wobei auch der Zusammenhang mit Rechtschreibstörungen kurz angesprochen wird.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Hauptthemen: Definition und Abgrenzung von Lesestörung und Leseschwäche, Ursachen von Lesestörungen (visuelle, phonologische, entwicklungsbedingte Faktoren), die Rolle visueller Wahrnehmungsprobleme (Augenbewegungen, Blicksprünge), diagnostische Ansätze, sowie weitere mögliche Ursachen wie organisch-physiologische Faktoren und fehlende Basisvoraussetzungen.
Wie werden Lesestörungen im Dokument kategorisiert?
Lesestörungen werden nach verschiedenen Ursachen kategorisiert: visuelle Wahrnehmungsprobleme (inkl. Augenbewegungen und Blicksprünge, optische Wahrnehmungsfehler), Probleme der Speicherung und des Behaltens von Informationen, phonologische Bewusstheitsprobleme und Entwicklungsstörungen.
Welche Rolle spielen visuelle Wahrnehmungsprobleme bei Lesestörungen?
Das Dokument beschreibt detailliert den komplexen Prozess der visuellen Informationsverarbeitung und die Rolle der Augenbewegungen (Sakkaden und Resakkaden) bei Lesestörungen. Die Bedeutung der Fovea und die Auswirkungen von zu häufigen und unkontrollierten Blicksprüngen auf das Leseverstehen werden erläutert. Die Rolle visueller Defizite als mögliche Auslöser von Lesestörungen wird diskutiert.
Welche diagnostischen Ansätze werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt die klassische und die mehrdimensionale Diagnose von Lesestörungen. Die Charakteristika beider Verfahren werden dargestellt, ohne jedoch ins Detail zu gehen.
Wie werden Lesestörung und Leseschwäche abgegrenzt?
Das Dokument differenziert zwischen Lesestörung und Leseschwäche und führt die allgemein anerkannte Definition nach ICD-10 an. Es betont die neurobiologische und entwicklungsbedingte Grundlage der Lesestörung (auch Legasthenie oder Dyslexie genannt) im Gegensatz zu vorübergehenden Leseschwierigkeiten.
Welche weiteren möglichen Ursachen für Lesestörungen werden genannt?
Neben den oben genannten Ursachen werden auch mögliche organisch-physiologische Ursachen und der Einfluss fehlender Basisvoraussetzungen für das Lesenlernen als weitere mögliche Ursachen von Lesestörungen diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für dieses Dokument?
Die Schlüsselwörter umfassen: Lesestörungen, Legasthenie, Dyslexie, Leseschwäche, visuelle Wahrnehmung, Augenbewegungen, Sakkaden, phonologische Bewusstheit, Entwicklungsstörungen, Diagnose, ICD-10.
- Quote paper
- Julia Kloiber (Author), 2003, Lesestörungen - Ursachen, Verlauf, Diagnose, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16823