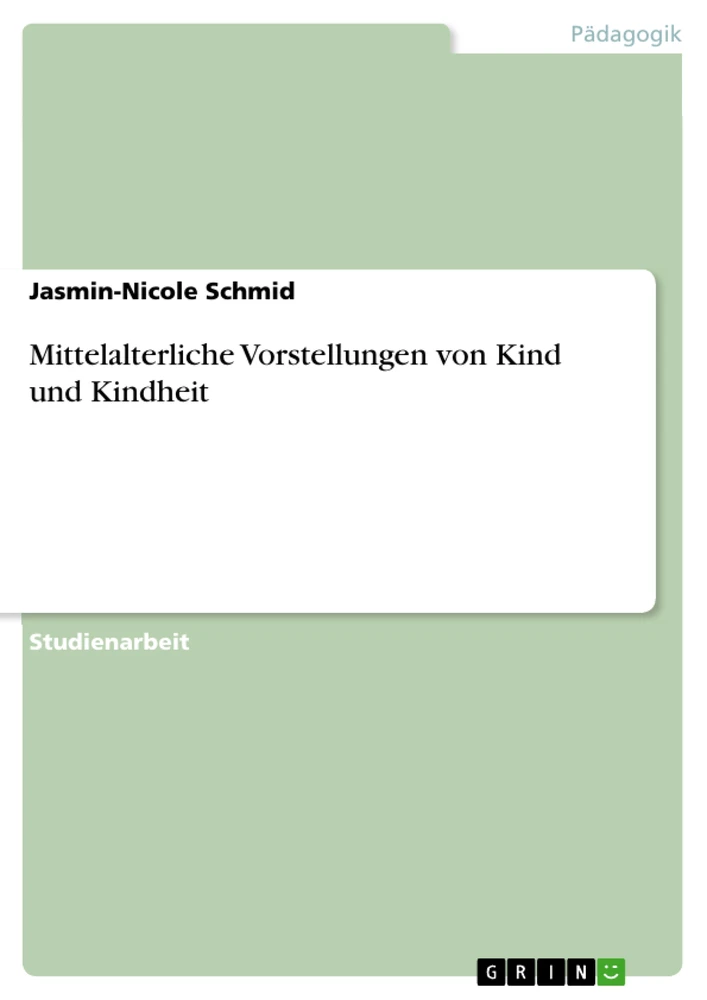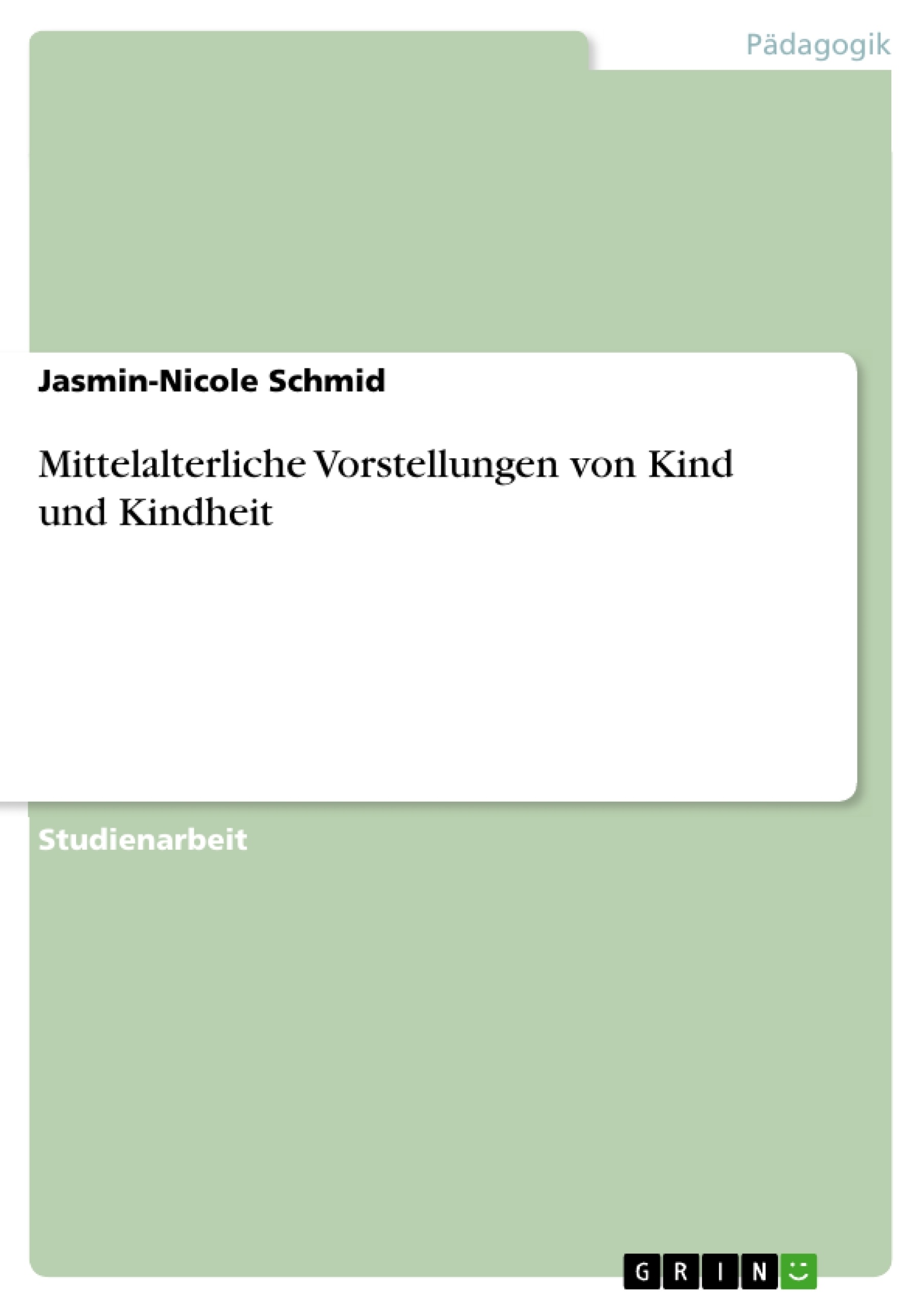Kindheit ist für uns heute ein allgegenwärtiger Begriff. Das, was für uns als selbstverständlich gilt, wie die Existenz von Kinderspielzeug, Kindergeschirr, Einrichtungen für Kinder, Kinderliteratur usw. gab es nicht immer. Erst im Laufe der Zeit wurde das Erziehungsverständnis und die Kindheit als eigenständige Lebensphase in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt.
Folgt man der These des Franzosen Philippe Ariès (1914-1984), der 1960 behauptete, dass das Mittelalter keine Vorstellung von Kindheit besaß, so muss man annehmen, dass erst der Beginn der Neuzeit zu einer Isolation der Kinder von der Erwachsenengesellschaft geführt hat und Kinder nicht mehr nur als „kleine Erwachsene“ galten. Er begründete dies mit der fehlenden Darstellung von lebendigen Kindern in der bildenden Kunst bis zum 13. Jahrhundert (vgl. Shahar 1991, S. 111). Doch fand im Mittelalter tatsächlich keine Achtung des Kindes statt? Wurden Kinder wirklich nur als „kleine Erwachsene“ gesehen?
Diese Arbeit soll einen Überblick über mittelalterliche Vorstellungen von Kind und Kindheit geben. Da ich selbst auf Mittelalterveranstaltungen tätig bin und mich die Kultur dieser Zeitepoche sehr interessiert, wählte ich das Thema gezielt aus.
Die Arbeit umfasst die Zeit des sechsten bis 15. Jahrhunderts in Europa, zwischen Antike und Neuzeit. Die in dieser Zeit entwickelten drei Entwicklungsphasen der Kindheit werden auf ihre Funktionen hin untersucht und charakteristische Merkmale, welche die Stufen untereinander unterscheiden und abgrenzen, analysiert. Hierbei stellt Shulamith Shahars Werk „Kindheit im Mittelalter“ meine Hauptliteratur dar.
Im weiteren Verlauf der Arbeit werden auszugsweise mittelalterliche Vorstellungen einzelner Lebensbereiche genauer beschrieben. Die vorherrschenden anthropologischen Annahmen, sowie der Eintritt und der Austritt des Lebens bilden einen groben Überblick über das mittelalterliche Leben. Der Erziehung wird unter diesem
Gliederungspunkt besondere Aufmerksamkeit geschenkt und bezüglich ihrer Methoden und Ziele hin genauer überprüft.
Anschließend erfolgt eine kurze Reflexion, bezogen auf Philippe
Ariès These, ob und inwieweit man auch bereits im Mittelalter von Kindheit sprechen konnte.
Zum Schluss erfolgt eine Zusammenfassung und es werden Parallelen zur Gegenwart
gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die drei Entwicklungsphasen der Kindheit im Mittelalter
- 2.1 „Infantia“
- 2.2 „Pueritia“
- 2.3 „Adolescentia“
- 3. Mittelalterliche Vorstellungen
- 3.1 Anthropologische Annahmen
- 3.2 (Ab)Leben
- 3.3 Erziehung
- 3.3.1 Ziele
- 3.3.2 Methoden
- 4. Das Bild der Kinder im Mittelalter - mehr als „kleine Erwachsene“?
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht mittelalterliche Vorstellungen von Kindheit und deren Entwicklungsphasen. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der damaligen Sichtweise auf Kinder zu liefern und die These von Philippe Ariès, wonach im Mittelalter keine Vorstellung von Kindheit existierte, zu hinterfragen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Zeit vom 6. bis zum 15. Jahrhundert in Europa.
- Die drei Entwicklungsphasen der Kindheit im Mittelalter („Infantia“, „Pueritia“, „Adolescentia“)
- Anthropologische Annahmen über Kinder im Mittelalter
- Erziehungspraktiken und -ziele im Mittelalter
- Das Verhältnis von Kindern zu Erwachsenen und die Rolle des Kindes in der Gesellschaft
- Vergleich mittelalterlicher und heutiger Kinderbilder
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verständnis von Kindheit im Mittelalter. Sie problematisiert die These von Philippe Ariès über das Fehlen einer Vorstellung von Kindheit im Mittelalter und benennt das Ziel der Arbeit: die Darstellung mittelalterlicher Vorstellungen von Kind und Kindheit anhand der drei Entwicklungsphasen und weiterer Aspekte wie anthropologischen Annahmen, Leben und Tod sowie Erziehungspraktiken. Die Arbeit stützt sich dabei maßgeblich auf das Werk von Shulamith Shahar. Der Fokus liegt auf der Zeit zwischen dem 6. und 15. Jahrhundert in Europa.
2. Die drei Entwicklungsphasen der Kindheit im Mittelalter: Dieses Kapitel beschreibt das mittelalterliche Entwicklungsmodell der Kindheit, unterteilt in „Infantia“, „Pueritia“ und „Adolescentia“, wobei jede Phase durch eine Dauer von Vielfachen von sieben Jahren definiert wird. Es wird hervorgehoben, dass diese Phasen spezifische körperliche und geistige Entwicklungsschritte repräsentieren und einen Fortschritt, nicht aber einen Rückschritt, implizieren. Geschlechtsunterschiede in der Behandlung und Darstellung der Phasen werden ebenfalls angesprochen, mit einem Schwerpunkt auf den unterschiedlichen Berichten über Jungen und Mädchen in den verschiedenen Phasen. Die unterschiedlichen Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Kinder in den jeweiligen Phasen werden als charakteristische Merkmale hervorgehoben.
3. Mittelalterliche Vorstellungen: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Aspekte mittelalterlicher Vorstellungen von Kindheit. Es untersucht die anthropologischen Annahmen über Kinder, die Konzepte von Leben und Tod im Zusammenhang mit Kindern und die Erziehungspraktiken im Mittelalter. Die detaillierte Analyse der Erziehung umfasst die Ziele und Methoden, wobei die religiösen und gesellschaftlichen Einflüsse auf die Erziehungspraktiken im Fokus stehen. Der Text betont die moralische und juristische Verantwortung der Eltern, die eng mit den religiösen Ansichten des Mittelalters verbunden war.
4. Das Bild der Kinder im Mittelalter - mehr als „kleine Erwachsene“?: Dieses Kapitel reflektiert kritisch die These von Philippe Ariès, ob und inwieweit man bereits im Mittelalter von einer eigenständigen Phase der Kindheit sprechen kann. Es bewertet die im vorherigen Kapitel dargestellten Aspekte und prüft, inwieweit diese eine eigenständige Kinderperspektive und -wahrnehmung belegen. Es analysiert die vorhandenen Indizien für ein differenziertes Verständnis von Kindern im Mittelalter, jenseits der Vorstellung von „kleinen Erwachsenen“. Das Kapitel setzt sich somit explizit mit der zentralen Forschungsfrage der Arbeit auseinander.
Schlüsselwörter
Mittelalterliche Kindheit, Entwicklungsphasen, Infantia, Pueritia, Adolescentia, Anthropologie, Erziehung, Philippe Ariès, Shulamith Shahar, „kleine Erwachsene“, religiöse Vorstellungen, gesellschaftliche Normen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Mittelalterliche Vorstellungen von Kindheit
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text untersucht mittelalterliche Vorstellungen von Kindheit und deren Entwicklungsphasen. Er hinterfragt die These von Philippe Ariès, dass es im Mittelalter keine Vorstellung von Kindheit gab, und beleuchtet die Sichtweise auf Kinder vom 6. bis zum 15. Jahrhundert in Europa.
Welche Entwicklungsphasen der Kindheit werden im Mittelalter behandelt?
Der Text beschreibt das mittelalterliche Entwicklungsmodell der Kindheit, unterteilt in „Infantia“, „Pueritia“ und „Adolescentia“. Jede Phase wird durch eine Dauer von Vielfachen von sieben Jahren definiert und repräsentiert spezifische körperliche und geistige Entwicklungsschritte. Geschlechtsunterschiede in der Behandlung und Darstellung der Phasen werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Aspekte mittelalterlicher Vorstellungen von Kindheit werden beleuchtet?
Der Text untersucht anthropologische Annahmen über Kinder im Mittelalter, Konzepte von Leben und Tod im Zusammenhang mit Kindern und die Erziehungspraktiken. Die Analyse der Erziehung umfasst Ziele und Methoden unter Berücksichtigung religiöser und gesellschaftlicher Einflüsse. Die moralische und juristische Verantwortung der Eltern wird hervorgehoben.
Wie wird die These von Philippe Ariès behandelt?
Der Text setzt sich kritisch mit der These von Philippe Ariès auseinander, ob im Mittelalter bereits von einer eigenständigen Phase der Kindheit gesprochen werden kann. Er bewertet die dargestellten Aspekte und prüft, ob diese eine eigenständige Kinderperspektive und -wahrnehmung belegen. Die Frage, ob Kinder im Mittelalter mehr waren als "kleine Erwachsene", wird untersucht.
Welche Quellen werden im Text verwendet?
Der Text stützt sich maßgeblich auf das Werk von Shulamith Shahar.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Textes?
Schlüsselwörter sind: Mittelalterliche Kindheit, Entwicklungsphasen, Infantia, Pueritia, Adolescentia, Anthropologie, Erziehung, Philippe Ariès, Shulamith Shahar, „kleine Erwachsene“, religiöse Vorstellungen, gesellschaftliche Normen.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text enthält eine Einleitung, Kapitel über die drei Entwicklungsphasen der Kindheit im Mittelalter ("Infantia", "Pueritia", "Adolescentia"), ein Kapitel zu mittelalterlichen Vorstellungen (anthropologische Annahmen, Leben/Tod, Erziehung), ein Kapitel, das die These der "kleinen Erwachsenen" kritisch hinterfragt, und einen Schluss.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Ziel ist es, ein umfassendes Bild der mittelalterlichen Sichtweise auf Kinder zu liefern und die These von Philippe Ariès zu hinterfragen.
Welche Zeitspanne wird im Text betrachtet?
Der Fokus liegt auf der Zeit zwischen dem 6. und 15. Jahrhundert in Europa.
- Quote paper
- Jasmin-Nicole Schmid (Author), 2010, Mittelalterliche Vorstellungen von Kind und Kindheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168081