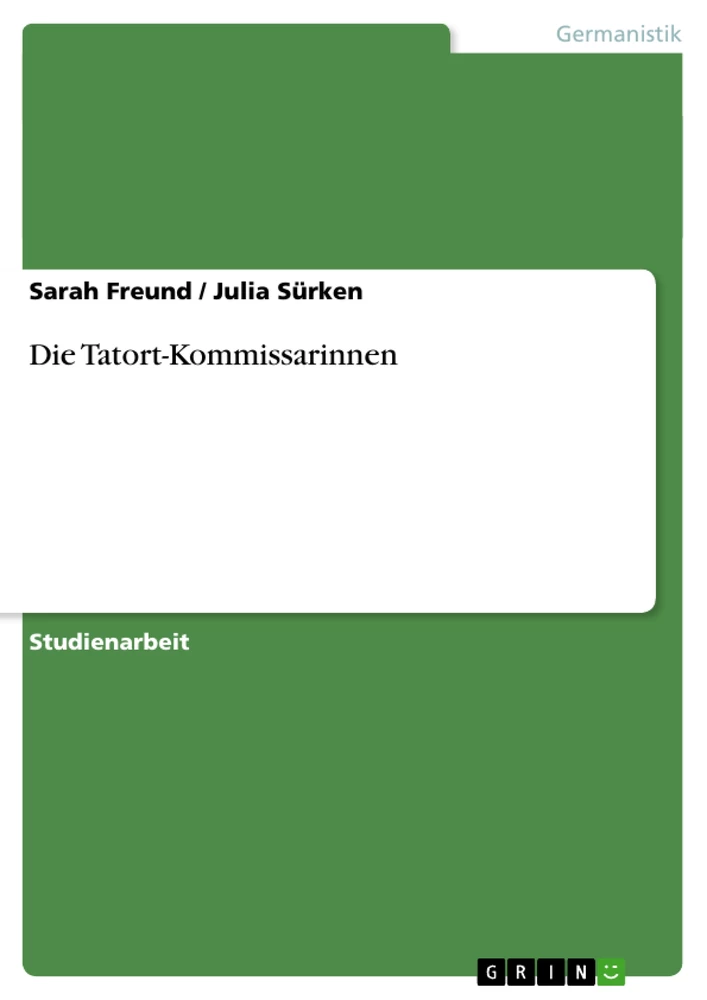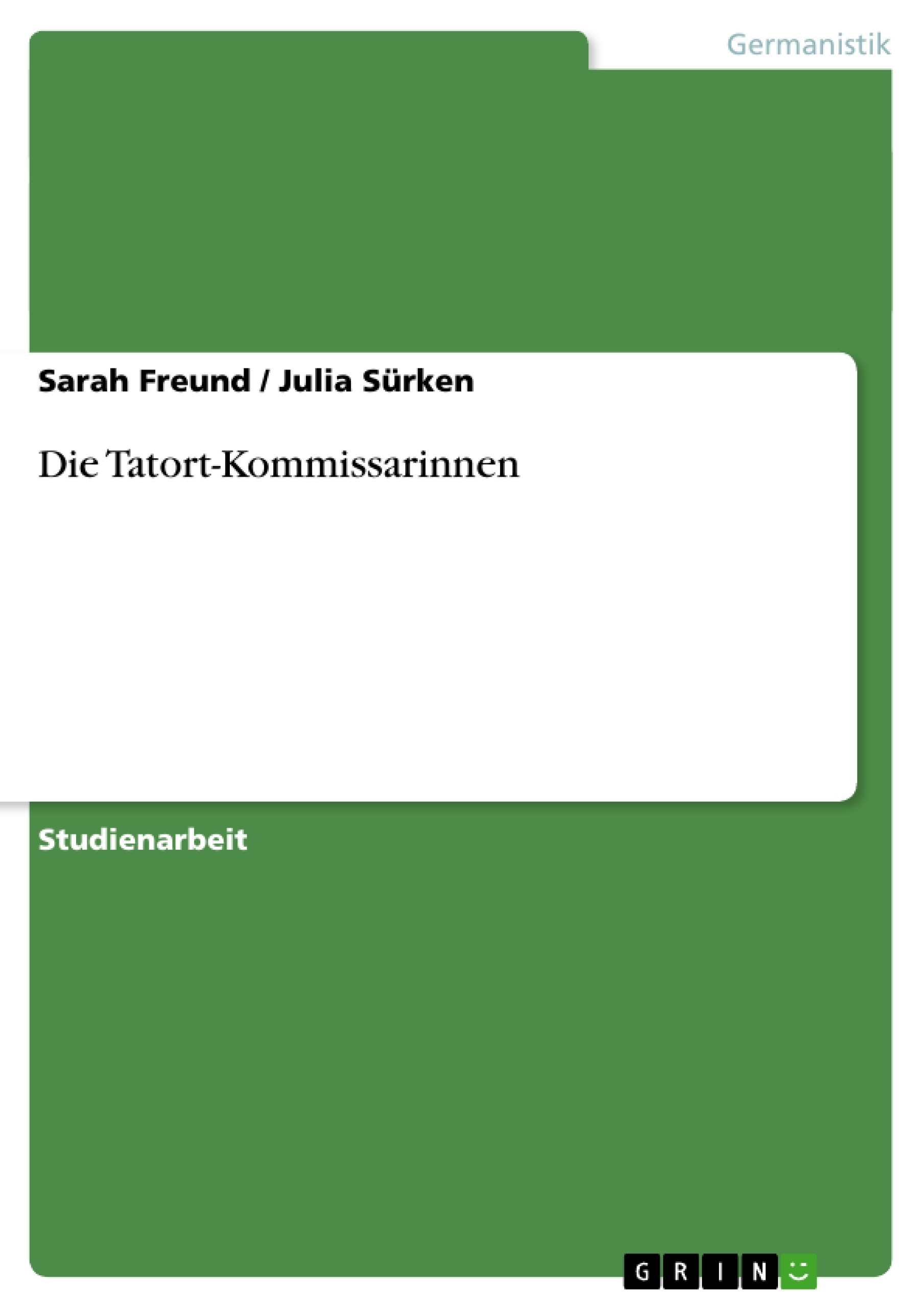Dem aufmerksamen Fernsehzuschauer wird aufgefallen sein, dass beim
sonntäglichen Fernsehabend immer häufiger Kommissarinnen für den „Tatort“
ermitteln. Aktuell werden Folgen mit fünf verschiedenen weiblichen Ermittlern in
regelmäßigen Abständen gedreht: Lena Odenthal, Inga Lürsen, Klara Blum,
Charlotte Lindholm und Charlotte Sänger kämpfen gegen die Kriminalität. Doch
kämpfen sie auch gegen überholte Geschlechterklischees? Entspricht ihre
Darstellung dem Bild der Frau in unserer Gesellschaft? In dieser Arbeit wird die
Darstellung der „Tatort“-Kommissarinnen anhand von vier ausgewählten Beispielen
untersucht. An ihnen wird aufgezeigt, wie sich die Kommissarinnen entwickelt
haben, und wie gut oder schlecht sie gegen überholte Geschlechterstereotype und
Rollenklischees ankämpfen. Dabei ist die zentrale Fragestellung: Wie hat sich die
Darstellung der „Tatort“-Kommissarinnen von 1978 bis 2003 verändert?
Im ersten Teil (Punkt 2) wird die Darstellung von Frauen in deutschen Fernsehkrimis
bis 1978 reflektiert. Dabei steht im Mittelpunkt der Betrachtungen die Fernsehfrau
und die Merkmale ihrer Darstellung. Der nächste Teil (Punkt 3) beschäftigt sich mit
der realen Polizei: Hier werden das quantitative Auftreten der Polizistinnen und ihre
Rolle in der Männerdomäne Polizei beschrieben. In Punkt 4 folgt eine Darstellung
ausgewählter „Tatort“-Kommissarinnen. Jede ist exemplarisch für eine bestimmte
„Epoche“: In chronologischer Reihenfolge werden die Anfänge mit Marianne
Buchmüller, der Durchbruch mit Lena Odenthal, die Hochzeit mit Inga Lürsen und
die Gegenwart mit Klara Blum untersucht. Neben einer Charakterisierung der
jeweiligen Persönlichkeiten, wird auch das Verhältnis zu den Kollegen und zum
Beruf, das Privatleben, die Beziehungen zu Opfer und Täter in den Vordergrund
gerückt. Das Auftauchen von Geschlechterklischees und Rollenzuweisungen ist
dabei immer wieder ein zentraler Untersuchungsgegenstand. Eingegangen wird auch
auf die Entwicklung der Frauen vor „Tatort“–Zeiten und die Veränderungen der
Kommissarinnen untereinander. Natürlich erhebt diese Darstellung nicht den
Anspruch vollständig zu sein. Die Anzahl der Kommissarinnen und die Vielzahl der
Folgen haben nicht allesamt Beachtung gefunden. Dennoch kann diese Auswahl durchaus wichtige Veränderungen und die Entwicklung insgesamt von 1978 bis
Anfang 2003 nachzeichnen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Darstellung von Frauen in deutschen Fernsehkrimis bis 1978
- 3. Die Realität: Polizei und Gender
- 4. Die „Tatort“-Kommissarinnen
- 4.1 Der Anfang: Marianne Buchmüller
- 4.2 Der Durchbruch: Lena Odenthal
- 4.3 Die Hochzeit: Inga Lürsen
- 4.4 Die Gegenwart: Klara Blum
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Kommissarinnen in der deutschen Fernsehserie „Tatort“ von 1978 bis 2003. Ziel ist es, die Entwicklung der weiblichen Ermittlerfiguren im Laufe der Zeit zu analysieren und zu beleuchten, inwieweit diese Darstellung traditionelle Geschlechterklischees und Rollenstereotype widerspiegelt oder überwindet.
- Entwicklung der Darstellung von Frauen in deutschen Fernsehkrimis
- Quantitative und qualitative Analyse der Rolle von Polizistinnen in der Realität
- Charakterisierung ausgewählter „Tatort“-Kommissarinnen und deren Entwicklung
- Analyse des Verhältnisses der Kommissarinnen zu Kollegen, Beruf und Privatleben
- Untersuchung des Auftretens von Geschlechterklischees und Rollenzuweisungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Veränderung der Darstellung von „Tatort“-Kommissarinnen von 1978 bis 2003. Sie benennt die fünf aktuell aktiven weiblichen Ermittlerinnen und skizziert die Untersuchungsmethode, die auf der Analyse von vier exemplarischen Figuren basiert. Die Einleitung hebt die Bedeutung der Untersuchung im Kontext gesellschaftlicher Geschlechterrollen hervor und deutet auf die Komplexität der Thematik hin.
2. Die Darstellung von Frauen in deutschen Fernsehkrimis bis 1978: Dieses Kapitel beleuchtet die Darstellung von Frauen in deutschen Fernsehkrimis vor dem Erscheinen der „Tatort“-Kommissarinnen. Es verweist auf die quantitative Unterrepräsentation von Frauen in tragenden Rollen und beschreibt charakteristische Merkmale der damaligen Fernsehfrauen. Die Analyse stützt sich auf vorhandene Studien zur Darstellung von Frauen im deutschen Fernsehen und zeigt die deutliche Diskrepanz zwischen der Anzahl der Frauenrollen und ihrer Bedeutung in den Handlungssträngen auf.
3. Die Realität: Polizei und Gender: Dieses Kapitel beschreibt die tatsächliche Situation von Frauen im Polizeidienst. Es beleuchtet den quantitativen Aspekt, also die geringe Anzahl von Polizistinnen, und analysiert deren Rolle in der traditionell von Männern dominierten Polizeibehörde. Der Fokus liegt auf der Darstellung der realen Geschlechterverhältnisse im Berufsfeld, die als Kontext für die Analyse der fiktiven Figuren in den „Tatort“-Folgen dient.
4. Die „Tatort“-Kommissarinnen: Dieses Kapitel stellt vier ausgewählte „Tatort“-Kommissarinnen vor: Marianne Buchmüller, Lena Odenthal, Inga Lürsen und Klara Blum. Jede Kommissarin repräsentiert eine bestimmte Epoche in der Entwicklung der Darstellung weiblicher Ermittlerfiguren in der Serie. Für jede Kommissarin wird eine Charakterisierung gegeben, die ihre Persönlichkeit, ihr Verhältnis zu Kollegen und Beruf, ihr Privatleben sowie ihre Beziehungen zu Opfern und Tätern berücksichtigt. Ein zentrales Thema ist dabei die Untersuchung von Geschlechterklischees und Rollenzuweisungen. Die Entwicklung der weiblichen Figuren sowohl innerhalb der Serie als auch im gesellschaftlichen Kontext wird analysiert.
Schlüsselwörter
Tatort, Kommissarinnen, Geschlechterrollen, Geschlechterklischees, Fernsehkrimis, Frauen in Medien, Polizeiarbeit, Rollenstereotype, Medienanalyse, Darstellung von Frauen, Entwicklung, Quantitative Analyse, Qualitative Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Darstellung von Kommissarinnen im Tatort (1978-2003)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von weiblichen Kommissarinnen in der deutschen Fernsehserie „Tatort“ zwischen 1978 und 2003. Sie untersucht, wie sich die Figuren im Laufe der Zeit entwickelt haben und inwieweit diese Darstellung traditionelle Geschlechterklischees und Rollenstereotype widerspiegelt oder überwindet.
Welche Aspekte werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Darstellung von Frauen in deutschen Fernsehkrimis im Allgemeinen, die Rolle von Polizistinnen in der Realität (quantitativ und qualitativ), die Charakterisierung ausgewählter „Tatort“-Kommissarinnen (Marianne Buchmüller, Lena Odenthal, Inga Lürsen und Klara Blum) und deren Entwicklung, deren Verhältnis zu Kollegen, Beruf und Privatleben sowie das Auftreten von Geschlechterklischees und Rollenzuweisungen.
Welche Kommissarinnen werden im Detail betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf vier „Tatort“-Kommissarinnen: Marianne Buchmüller, Lena Odenthal, Inga Lürsen und Klara Blum. Jede Kommissarin repräsentiert eine bestimmte Epoche und wird hinsichtlich ihrer Persönlichkeit, ihres Verhältnisses zu Kollegen und Beruf, ihres Privatlebens sowie ihrer Beziehungen zu Opfern und Tätern analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Darstellung von Frauen in deutschen Fernsehkrimis bis 1978, Die Realität: Polizei und Gender, Die „Tatort“-Kommissarinnen (mit Unterkapiteln zu jeder Kommissarin) und Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Methodik vor. Kapitel 2 und 3 liefern den Kontext. Kapitel 4 bildet den Hauptteil der Analyse.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit kombiniert quantitative und qualitative Analysemethoden. Die quantitative Analyse betrachtet beispielsweise die Unterrepräsentation von Frauen im deutschen Fernsehen. Die qualitative Analyse fokussiert auf die detaillierte Charakterisierung der ausgewählten Kommissarinnen und die Interpretation ihrer Handlungen und Beziehungen im Kontext gesellschaftlicher Geschlechterrollen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Tatort, Kommissarinnen, Geschlechterrollen, Geschlechterklischees, Fernsehkrimis, Frauen in Medien, Polizeiarbeit, Rollenstereotype, Medienanalyse, Darstellung von Frauen, Entwicklung, Quantitative Analyse, Qualitative Analyse.
Welche Zeitspanne wird untersucht?
Der Zeitraum der Untersuchung erstreckt sich von den Anfängen des „Tatort“ bis 2003, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der Darstellung weiblicher Ermittlerfiguren gelegt wird.
Was ist das Fazit der Arbeit (ohne Spoiler)?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bewertet die Entwicklung der Darstellung weiblicher Ermittlerfiguren im „Tatort“ im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen. Es wird ein Gesamtbild der Veränderung der Geschlechterrollen im Kontext des Fernsehkrimis geliefert.
- Quote paper
- Sarah Freund (Author), Julia Sürken (Author), 2003, Die Tatort-Kommissarinnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16792