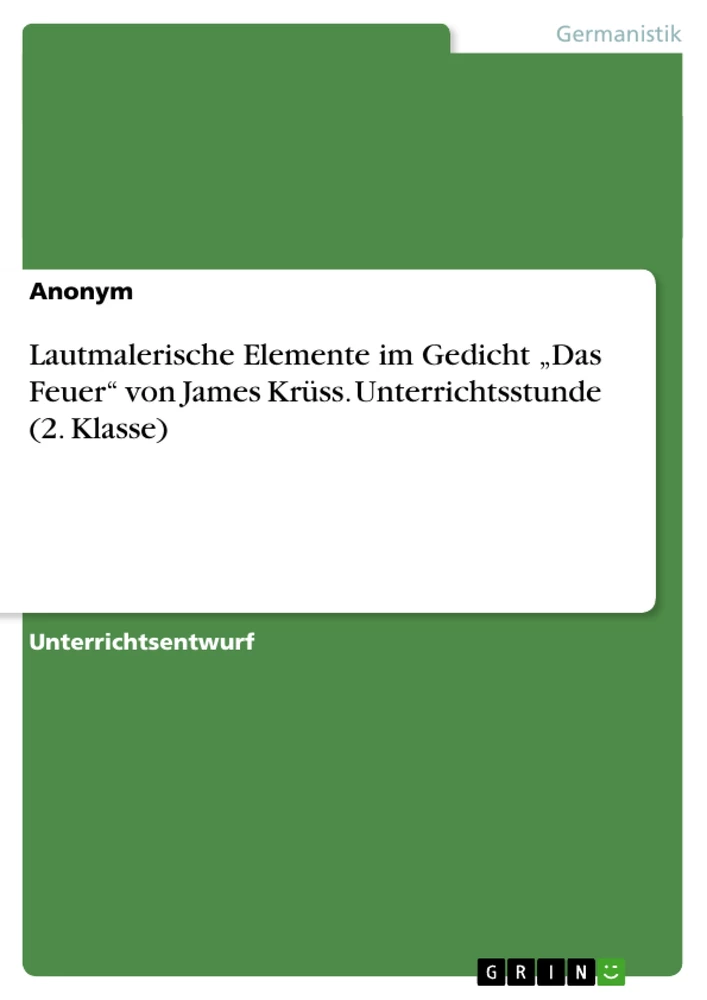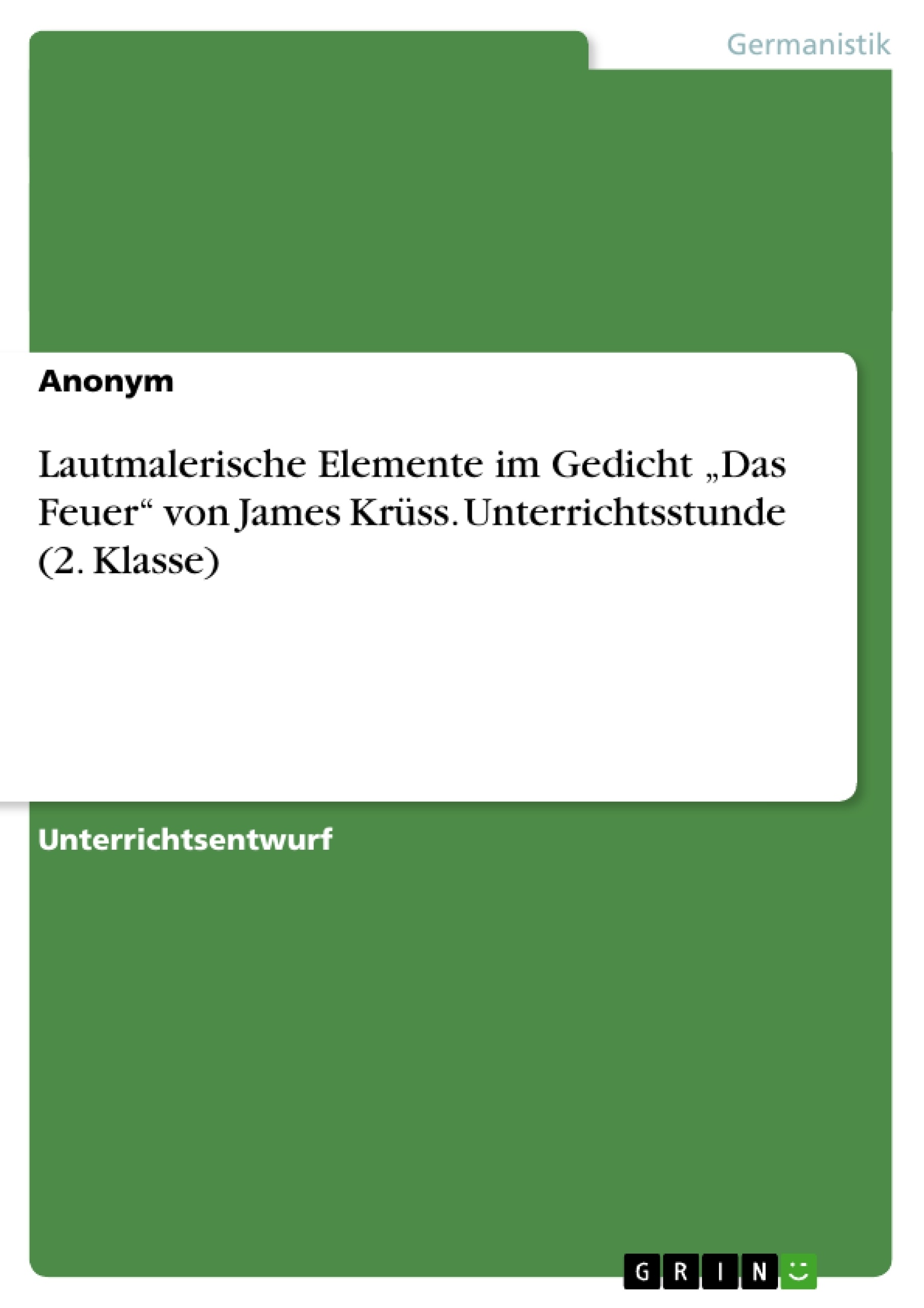Ein Gedicht hat ( nach Dieter Burdorf1) folgende Eigenschaften:
„ Es ist eine mündliche oder schriftliche Rede in Versen, ist also durch zusätzliche
Pausen bzw. Zeilenbrüche von der normalen rhythmischen oder graphischen Erscheinungsform
der Alltagssprache abgehoben. Es ist kein Rollenspiel, also nicht
auf szenische Aufführung hin angelegt.“
Laut Burdorf ist das eine „Minimaldefinition“, zu der eine Reihe weiterer Eigenschaften
hinzu treten können, wie zum Beispiel:
- grammatische Abweichungen ( Reim, Metrum, klangliche Besonderheiten, unübliche
Wortstellungen , Verformungen der Wortgestalt u.s.w.)
- Kürze des Textes
- Wortgebrauch, der gekennzeichnet ist durch Wiederholungen (Leitmotive) und
gezielte Variation. Große Bedeutung der Bildlichkeit ( Allegorie, Metapher,
Symbol)
- Liedartiger Charakter; Nähe zur Musik
Burdorf merkt an, daß diese Liste nicht vollständig ist und weiter ausdifferenziert
werden könnte.
Da es sich bei dem von mir gewählten Gedicht um ein Gedicht speziell für Kinder
handelt, werde ich versuchen, den Begriff des Gedichts einzugrenzen und den Bezug
zum Kindergedicht herzustellen. Nach Harald Reger2 sind unter Kinderlyrik Texte zu verstehen, „die in gebundener, nicht unbedingt gereimter Sprache und in
einer bestimmten Form von Kindern und Erwachsenen für Kinder vom Kleinkindalter
bis zu etwa 10 Jahren verfaßt und von Heranwachsenden in der genannten Altersspanne
rezipiert werden.“ Diese Texte sind zum Teil nicht nur sprech- und lesbar,
sondern auch singbar. Die wichtigsten Ausdrucksformen sind: Kinderreim,
traditionelles Kindergedicht, Kinderlied, Sprachspiel und das realitätskritische
Kindergedicht. [...]
1 aus: Dieter Burdorf: „Einführung in die Gedichtanalyse“
Verlag J.B.Metzler, Stuttgart 1997, S.15
2 aus: Harald Reger: „Kinderlyrik in der Grundschule“
Pädagogischer Verlag Burgbücherei Schneider, Baltmannsweiler 1990, S.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Sachanalyse
- 1.1 Definitionen
- 1.2 Autor
- 1.3 Inhalt des Gedichts
- 1.4 Aufbau und Form des Gedichts
- 1.5 Sprachliche und literarische Mittel
- 1.6 Intention
- 2. Didaktische Analyse
- 2.1 Grundlegende didaktische Überlegungen
- 2.2 Bezug zum Bildungsplan
- 2.3 Lernvoraussetzungen der Schüler
- 2.4 Stundenziele
- 2.5 Methodisches Vorgehen
- 2.5.1 Einstieg
- 2.5.2 Textbegegnung
- 2.5.3 Texterschließung
- 2.5.4 Ergebnisvertiefung
- 3. Literaturverzeichnis
- 4. Anhang: Gedicht „Das Feuer“ von James Krüss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Unterrichtsentwurf analysiert das Gedicht "Das Feuer" von James Krüss im Hinblick auf seine lautmalerischen Elemente und didaktische Anwendbarkeit im Deutschunterricht der zweiten Klasse. Ziel ist es, die Schüler mit der Lyrik des Autors vertraut zu machen und ihr Sprachbewusstsein zu fördern.
- Lautmalerei (Onomatopoesie) als zentrales Stilmittel
- Sinneswahrnehmung und deren Darstellung in lyrischer Form
- Aufbau und Struktur des Gedichts
- Didaktische Überlegungen zur Unterrichtsgestaltung
- Förderung des Sprachbewusstseins bei Grundschulkindern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Sachanalyse: Dieser Abschnitt bietet eine detaillierte Analyse des Gedichts "Das Feuer" von James Krüss. Zunächst werden Definitionen von Gedichten und Kinderlyrik vorgestellt, wobei die Werke von Dieter Burdorf und Harald Reger herangezogen werden. Anschließend wird der Autor James Krüss und sein Schaffen kurz vorgestellt. Der inhaltliche Fokus liegt auf der Darstellung des Phänomens Feuer durch die Ansprache aller fünf Sinne. Die Analyse des Aufbaus und der Form des Gedichts umfasst die Strophenstruktur, den Satzbau, das Metrum (Trochäus und Jambus) und den Reim (Paarreim). Besondere Aufmerksamkeit wird den sprachlichen Mitteln gewidmet, insbesondere der Lautmalerei (Onomatopoesie) und der Personifikation, welche die sinnliche Wahrnehmung und die Lebendigkeit des Gedichts verstärken. Abschließend wird die Intention des Gedichts beleuchtet, wobei die eindrucksvolle Darstellung des Naturphänomens Feuer und die Förderung des Sprachbewusstseins im Vordergrund stehen.
2. Didaktische Analyse: Dieser Teil befasst sich mit den didaktischen Aspekten des Unterrichtsentwurfs. Es werden grundlegende didaktische Überlegungen angestellt, der Bezug zum Bildungsplan hergestellt und die Lernvoraussetzungen der Schüler berücksichtigt. Die Stundenziele werden formuliert, wobei der Fokus auf dem Verständnis des Gedichts, der Erkennung lautmalerischer Elemente und der Entwicklung eines ersten Sprachbewusstseins liegt. Das methodische Vorgehen beschreibt den geplanten Unterrichtsablauf, inklusive Einstieg, Textbegegnung, Texterschließung und Ergebnisvertiefung. Der Entwurf berücksichtigt die Altersstufe der Schüler und zielt auf eine spielerische und sinnliche Auseinandersetzung mit dem Gedicht ab.
Häufig gestellte Fragen zum Unterrichtsentwurf: "Das Feuer" von James Krüss
Was ist der Inhalt des Unterrichtsentwurfs?
Der Unterrichtsentwurf analysiert das Gedicht "Das Feuer" von James Krüss für den Deutschunterricht der zweiten Klasse. Er umfasst eine detaillierte Sachanalyse des Gedichts (Definitionen, Autor, Inhalt, Aufbau, sprachliche Mittel, Intention) und eine didaktische Analyse (didaktische Überlegungen, Bezug zum Bildungsplan, Lernvoraussetzungen, Stundenziele, methodisches Vorgehen). Der Fokus liegt auf der Lautmalerei (Onomatopoesie) und der didaktischen Anwendbarkeit des Gedichts zur Förderung des Sprachbewusstseins der Schüler.
Welche Aspekte werden in der Sachanalyse behandelt?
Die Sachanalyse beinhaltet Definitionen von Gedichten und Kinderlyrik (unter Bezugnahme auf Burdorf und Reger), eine kurze Vorstellung des Autors James Krüss, eine detaillierte Inhaltsanalyse mit Fokus auf die sinnliche Darstellung des Feuers, eine Analyse des Aufbaus und der Form (Strophen, Satzbau, Metrum, Reim), eine Untersuchung der sprachlichen Mittel (Lautmalerei, Personifikation) und eine Erörterung der Intention des Gedichts.
Was sind die Schwerpunkte der didaktischen Analyse?
Die didaktische Analyse umfasst grundlegende didaktische Überlegungen, den Bezug zum Bildungsplan, die Berücksichtigung der Lernvoraussetzungen der Schüler, die Formulierung von Stundenziele (Verständnis des Gedichts, Erkennung lautmalerischer Elemente, Entwicklung des Sprachbewusstseins) und die Beschreibung des methodischen Vorgehens (Einstieg, Textbegegnung, Texterschließung, Ergebnisvertiefung) mit spielerischem und sinnlichem Ansatz.
Welche sprachlichen Mittel werden im Gedicht besonders hervorgehoben?
Der Entwurf hebt die Lautmalerei (Onomatopoesie) und die Personifikation als zentrale sprachliche Mittel hervor, die die sinnliche Wahrnehmung und die Lebendigkeit des Gedichts verstärken.
Welche Ziele werden mit dem Unterricht verfolgt?
Die Ziele des Unterrichts sind die Vertrautmachung der Schüler mit der Lyrik von James Krüss und die Förderung ihres Sprachbewusstseins durch die Auseinandersetzung mit lautmalerischen Elementen und der sinnlichen Darstellung des Naturphänomens "Feuer".
Für welche Altersstufe ist der Unterrichtsentwurf konzipiert?
Der Unterrichtsentwurf ist für die zweite Klasse der Grundschule konzipiert.
Welche Struktur hat der Unterrichtsentwurf?
Der Entwurf gliedert sich in eine Sachanalyse des Gedichts "Das Feuer", eine didaktische Analyse mit methodischen Überlegungen und ein Literaturverzeichnis sowie einen Anhang mit dem Gedicht selbst.
Welche Materialien sind im Anhang enthalten?
Der Anhang enthält das Gedicht "Das Feuer" von James Krüss.
- Quote paper
- Anonym (Author), 1999, Lautmalerische Elemente im Gedicht „Das Feuer“ von James Krüss. Unterrichtsstunde (2. Klasse), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16784