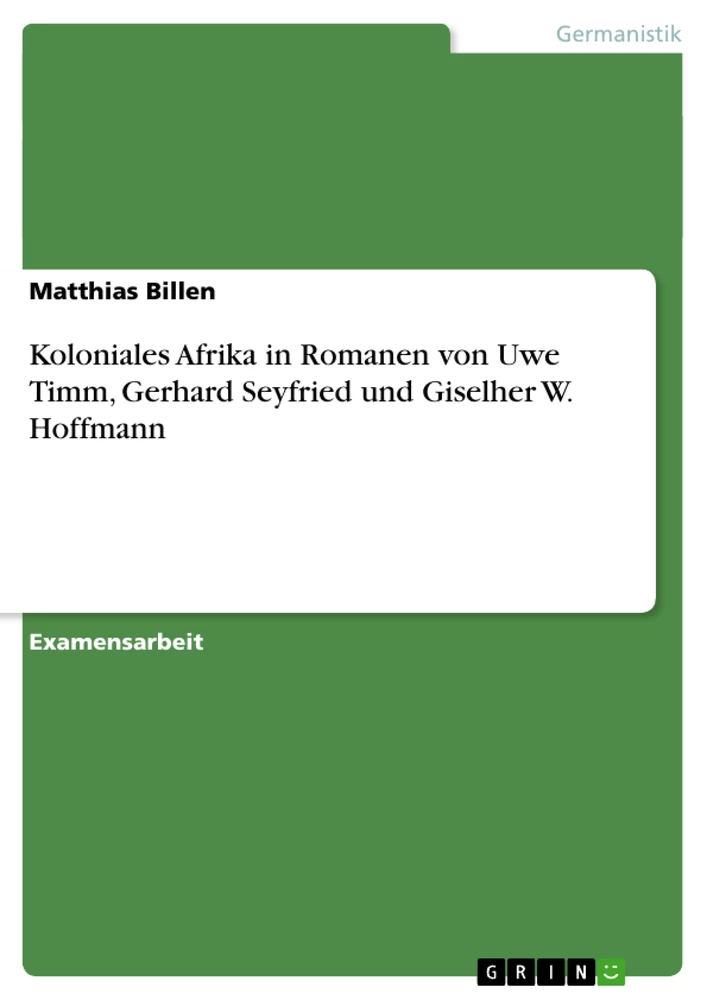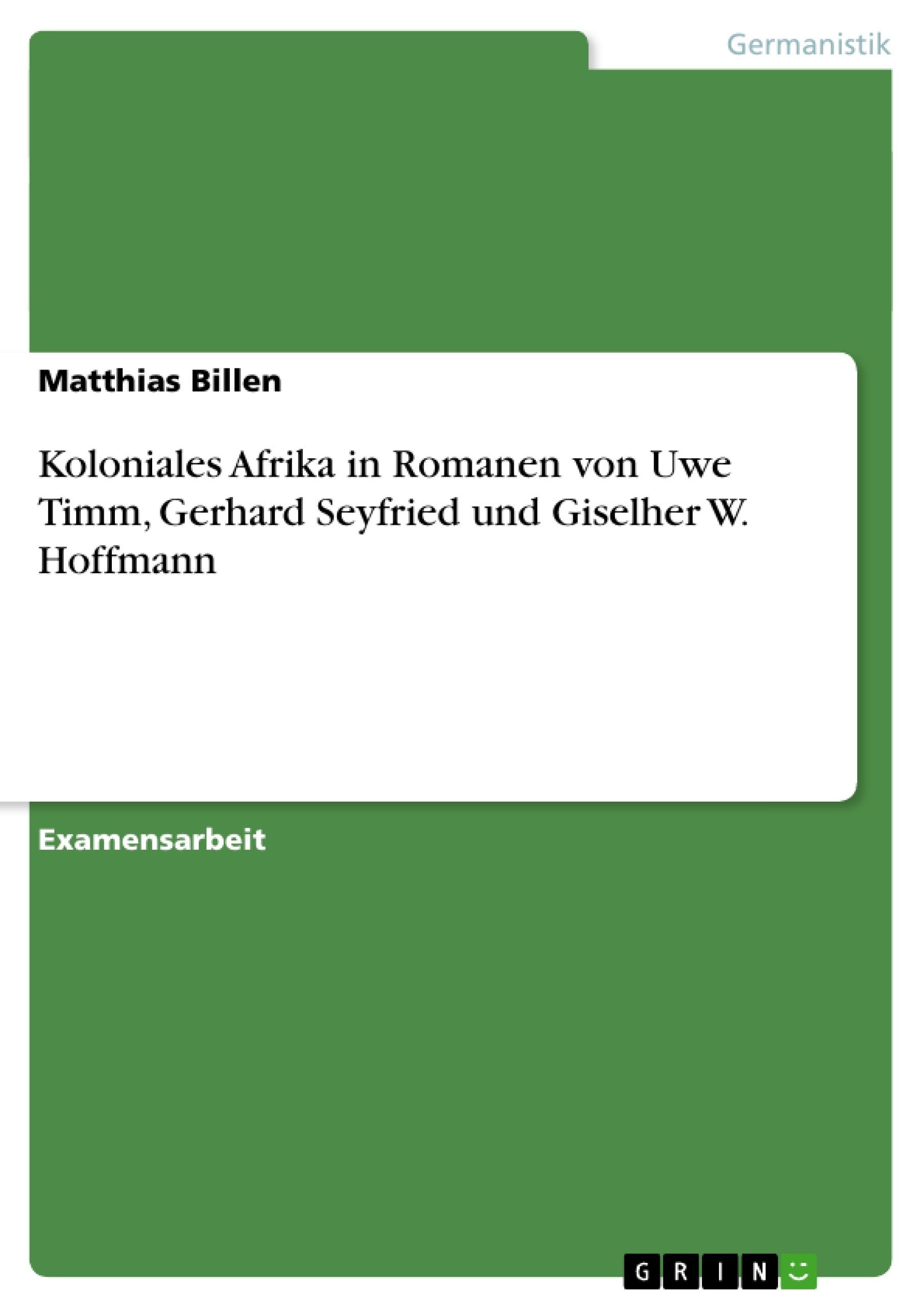Im Rahmen dieser Arbeit sollen jedoch Werke thematisiert werden, die nicht mehr unmittelbar in die Phase während oder kurz nach dem deutschen Kolonialismus eingeordnet werden k önnen. Daher wurde eine Auswahl getroffen, die schließlich die Romane "Die schweigenden Feuer"(1994)5 von Giselher W. Hoffmann, "Herero"(2003)6 von Gerhard Seyfried, sowie "Morenga" (1978)7 von Uwe Timm umfasst. Die drei Romane thematisieren die Kolonialgeschichte Deutschlands mit Bezug auf die V ölker Namibias mit h chst unterschiedlichenSchwerpunkten, wobei die negativenKulminationspunktedie Kriege der deutschen Schutz-truppen gegen die Herero (1904) und Nama (1904-1907/8) sind.8Wichtig für den Vergleich der drei Romane mit ihrem hohen Grad an Historizität sind die unterschiedlichen Perspektiven, die sie einnehmen. Während der namibischedeutschstämmige Schriftsteller Giselher W. Hoffmann die Perspektive des Herero Himeezembi einnimmt und sich mit dem Niedergang der Kultur durch die Kolonisation beschäftigt, entwickelt sich die Handlung aus Sicht der Herero von 1861 bis 1904. Der Roman Herero hingegen versucht, die Situation aus Sicht der Deutschen und der Afrikaner zu schildern, womit beide Perspektiven Raum zur Artikulation gewinnen sollen. Im Kontrast dazu ist Morenga konstruiert aus einer Vielzahl an verschiedenen historischen Dokumenten mitsich abwechselnden fiktionalen Passagen. Der literarische Raum, welcherder Titelfigur zugewiesen wird, ist auf den ersten Blick relativ eng begrenzt und die Handlung stark fokussiert...
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Wissenschaftliche Verortung
- 2.1 Postkoloniale Studien
- 2.2 Interkulturelle Germanistik
- 2.3 Prämissen: Fremdheit und Fremddarstellung
- 3. Fremdheit in Giselher W. Hoffmanns Die schweigenden Feuer
- 3.1 Sexualität und Beziehungsgefüge
- 3.2 Gesellschaftliche Struktur
- 3.3 Geschichtlichkeit
- 3.4 Kulturüberschreitungen
- 3.5 Zwischenfazit
- 4. Die Romanze in der Wildnis: Gerhard Seyfrieds Herero
- 4.1 Der Blick auf Afrika
- 4.1.1 Deutschtum und die Afrikaner
- 4.1.2 Sprachlicher Stil
- 4.1.3 Die Weißen
- 4.2 Die afrikanische Perspektive?
- 4.3 Schaffung von Historizität und die Darstellung des Kriegs
- 4.4 Die Besonderheit: Autonomie der Landschaft
- 4.5 Zwischenfazit
- 4.1 Der Blick auf Afrika
- 5. Deutsche und „Hottentotten“ in Uwe Timms Morenga
- 5.1 Zwischenmenschlichkeit und Begehren
- 5.2 Das Bild und die Stimme der Anderen
- 5.3 Zur Rolle und Funktion von Sprache und Kommunikation
- 5.4 Ökonomische Divergenz zwischen den Kulturen
- 5.5 Zwischenfazit
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Darstellung von kolonialem Afrika in drei Romanen: „Die schweigenden Feuer“ von Giselher W. Hoffmann, „Herero“ von Gerhard Seyfried und „Morenga“ von Uwe Timm. Die Arbeit zielt darauf ab, die verschiedenen Perspektiven und Repräsentationsformen kolonialer Fremdheit in diesen Romanen zu analysieren und die Art und Weise zu beleuchten, wie die Autoren mit den Themen Kolonialismus, Kultur und Identität umgehen.
- Repräsentation von Fremdheit und die Darstellung kolonialer Kultur
- Die Rolle von Sprache und Kommunikation in der Begegnung von Kulturen
- Die Konstruktion von Historizität und die Frage der Authentizität
- Die Perspektive der Afrikaner und die Frage der Artikulationsmöglichkeiten
- Die Dekonstruktion kolonialer Darstellungen und Geschichtsschreibung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema koloniales Afrika in der Literatur ein und stellt die drei Romane vor, die im Zentrum der Arbeit stehen. Der Zusammenhang zwischen den Romanen und der Problematik der Repräsentation von Fremdheit wird anhand des Films „Avatar“ verdeutlicht.
- Kapitel 2: Wissenschaftliche Verortung: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Arbeit und die Relevanz postkolonialer Studien und der interkulturellen Germanistik für die Analyse der ausgewählten Romane.
- Kapitel 3: Fremdheit in Giselher W. Hoffmanns „Die schweigenden Feuer“: Dieses Kapitel analysiert die Repräsentation von Fremdheit in „Die schweigenden Feuer“. Besonderer Fokus liegt auf der Darstellung der Herero-Kultur und ihrer Auseinandersetzung mit der kolonialen Dominanz.
- Kapitel 4: Die Romanze in der Wildnis: Gerhard Seyfrieds „Herero“: Die Analyse von „Herero“ untersucht die Perspektive der Deutschen und Afrikaner im Roman und setzt sich mit der Frage der Authentizität und der Konstruktion von Historizität auseinander.
- Kapitel 5: Deutsche und „Hottentotten“ in Uwe Timms „Morenga“: Dieses Kapitel analysiert „Morenga“ im Hinblick auf die Darstellung der kolonialen Innenperspektive und die Gegenüberstellung von historischen Quellen. Der Roman wird als Beispiel für die Dekonstruktion kolonialer Darstellungen betrachtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der postkolonialen Studien und der interkulturellen Germanistik, wie z.B. Kolonialismus, Kultur, Identität, Fremdheit, Repräsentation, Sprache, Kommunikation, Historizität, Authentizität und Dekonstruktion.
- Quote paper
- Matthias Billen (Author), 2010, Koloniales Afrika in Romanen von Uwe Timm, Gerhard Seyfried und Giselher W. Hoffmann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167799