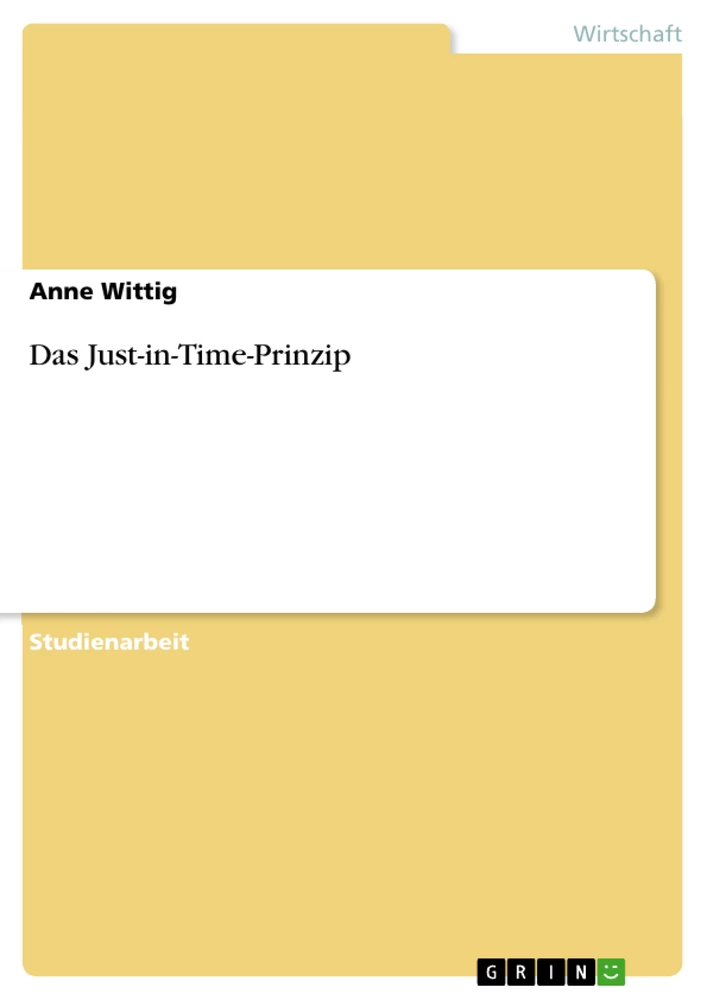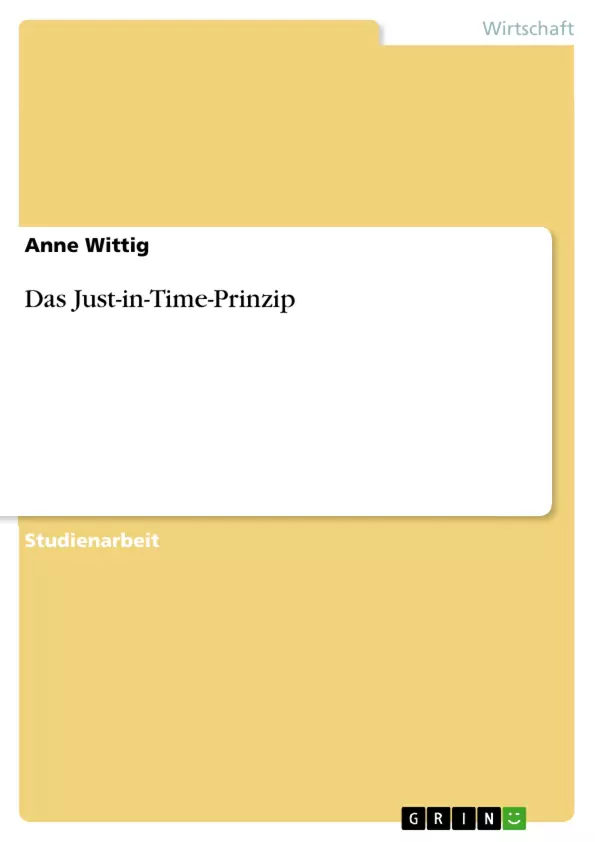Die aktuelle Finanzkrise hat längst ihre auf Banken, deren Kunden und Aktionäre begrenzten Auswirkungen auf die Realwirtschaft ausgeweitet. Besonders hart getroffen hat es dabei die
Automobilhersteller, die aufgrund bereits bestehender Probleme, nun in eine noch stärkere Schieflage geraten sind. So hat sich aus der Struktur- und der Finanzkrise eine Absatzkrise für die Autobauer entwickelt, wobei laut Berechnungen zufolge, der Weltautomarkt im
Gesamtjahr 2008 um vier bis fünf Prozent schrumpfen wird. Dies bedeutet für die Automobilproduzenten weniger Verkäufe von Autos, mit den Folgen, dass die Produktion zurückgeschraubt, Leiharbeiter abgebaut und Angestellte in Urlaub oder Kurzarbeit geschickt
werden. Doch trifft diese Krise hier nicht nur die Hersteller selbst, sie tangiert zudem deren Zulieferbetriebe, da die Beziehungen zwischen Hersteller und Lieferant in den letzten Jahren
immer enger geknüpft worden sind. Die Zulieferer erhielten ein Mehr an Verantwortung und erfuhren eine stetig wachsende Einbindung in Produktions- und Entwicklungsabläufe. So liefern sie nicht mehr nur einzelne Teile in ein Lager für die Automobilindustrie ab, sondern
fabrizieren bereits einbaufertige Produkte, mit denen es den Hersteller zur rechten Zeit zu versorgen gilt.
Das weltweit erfolgreiche und über viele Branchen hinweg auftretende Konzept, das hinter dieser engen Verzahnung von Herstellern und Zulieferern steht, ist das des Just-in-Time.
Mit diesem Konzept befasst sich die vorliegende Hausarbeit, welche sich im Besonderen mit den Herstellern und ihrer Rolle als Kunden von Vorprodukten auseinandersetzt. Im Speziellen wird dabei stets das Beispiel der Automobilindustrie aufgegriffen. Ziel ist es, das Just-in-Time-Konzept zu durchleuchten, die Entwicklung nachzuzeichnen, Einflüsse zu erläutern sowie die Bedeutung herauszustellen, um letztendlich ein in sich stimmiges Bild dieses Konzeptes zu skizzieren.
Dabei wird, nachdem in Kapitel 2 das Wesen von Just-in-Time dargelegt wurde, in Kapitel 3 der geschichtliche Fortschritt von der ersten Idee des Konzeptes bis hin zur Einführung in Deutschland beschrieben. In Kapitel 4 folgen die Einflussfaktoren, die für den allgemeinen Bedeutungszuwachs des Lieferservices verantwortlich sind und darauf aufbauend werden in Kapitel 5 die Vor- und Nachteile der Just-in-Time-Lieferung verdeutlicht. Im letzten Abschnitt erfolgt eine Schlussbetrachtung, die neben einem Fazit eine Prognose hinsichtlich der Entwicklung von Just-in-Time enthält.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Problemstellung
- 2. Das Wesen des Just-in-Time-Konzeptes
- 3. Die geschichtliche Entwicklung des Just-in-Time-Konzeptes
- 3.1 Der Toyota - Weg
- 3.2 Klassische Massenproduktion versus schlanke JiT-Produktion
- 3.3. Einführung des Just-in-Time-Konzeptes in Deutschland
- 4. Die Einflussfaktoren für den allgemeinen Bedeutungszuwachs des Lieferservices
- 5. Vorteile und Nachteile von Just-in-Time aus Sicht des Abnehmers
- 5.1 Die Vorteile
- 5.2 Die Nachteile
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Hausarbeit zielt darauf ab, das Just-in-Time-Konzept (JiT) umfassend zu beleuchten, seine geschichtliche Entwicklung aufzuzeigen, die Einflussfaktoren für seine Verbreitung zu erläutern und schließlich seine Bedeutung im Kontext der Automobilindustrie zu verdeutlichen. Dabei wird insbesondere der Fokus auf die Rolle der Hersteller als Kunden von Vorprodukten gelegt.
- Das Wesen des Just-in-Time-Konzeptes
- Die geschichtliche Entwicklung von Just-in-Time
- Einflussfaktoren für den Bedeutungszuwachs des Lieferservices
- Vorteile und Nachteile von Just-in-Time aus Sicht des Abnehmers
- Die Bedeutung von Just-in-Time in der Automobilindustrie
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel beleuchtet die Problemstellung, die sich aus der aktuellen Finanzkrise und ihren Auswirkungen auf die Automobilindustrie ergibt. Es wird die enge Verzahnung zwischen Herstellern und Zulieferern und die Bedeutung des Just-in-Time-Konzeptes in diesem Kontext hervorgehoben. Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Wesen des Just-in-Time-Konzeptes, erläutert seine Funktionsweise und beschreibt dessen Rolle im Toyota Produktionssystem. Die geschichtliche Entwicklung von Just-in-Time vom Ursprung bei Toyota bis hin zur Einführung in Deutschland wird in Kapitel 3 dargestellt. Kapitel 4 untersucht die Einflussfaktoren, die zum Bedeutungszuwachs von Just-in-Time beigetragen haben. Schließlich werden in Kapitel 5 die Vor- und Nachteile von Just-in-Time aus Sicht des Abnehmers beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Just-in-Time, JiT, Toyota Produktionssystem, Automobilindustrie, Lieferkette, Lieferantenmanagement, Produktionslogistik, Materialwirtschaft, Kostenoptimierung, Verschwendung, Effizienz, Flexibilität, Kundenorientierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Just-in-Time-Prinzip (JiT)?
Es ist ein Produktionskonzept, bei dem Materialien erst dann geliefert werden, wenn sie tatsächlich im Produktionsprozess benötigt werden, um Lagerkosten zu minimieren.
Woher stammt das Just-in-Time-Konzept?
Die Ursprünge liegen im Toyota-Produktionssystem in Japan, das als Gegenmodell zur klassischen Massenproduktion entwickelt wurde.
Welche Vorteile bietet JiT für Automobilhersteller?
Zu den Vorteilen gehören die Reduzierung von Lagerbeständen, geringere Kapitalbindung, höhere Effizienz und eine schnellere Reaktion auf Kundenwünsche.
Was sind die Risiken von Just-in-Time-Lieferungen?
Die größte Gefahr ist die hohe Abhängigkeit von Zulieferern und Logistik; Störungen in der Lieferkette können sofort zum Stillstand der gesamten Produktion führen.
Wie beeinflusste die Finanzkrise die JiT-Strukturen?
Die Krise führte zu Absatzrückgängen, was die enge Verzahnung zwischen Herstellern und Zulieferern auf die Probe stellte und zu Produktionskürzungen führte.
- Quote paper
- Anne Wittig (Author), 2009, Das Just-in-Time-Prinzip, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167718