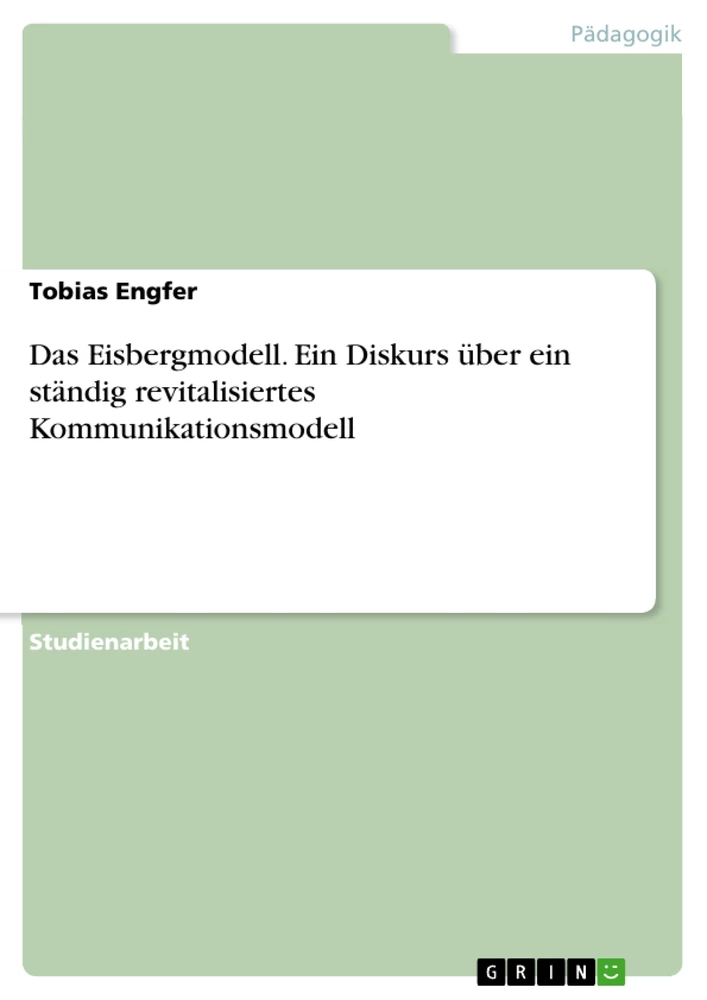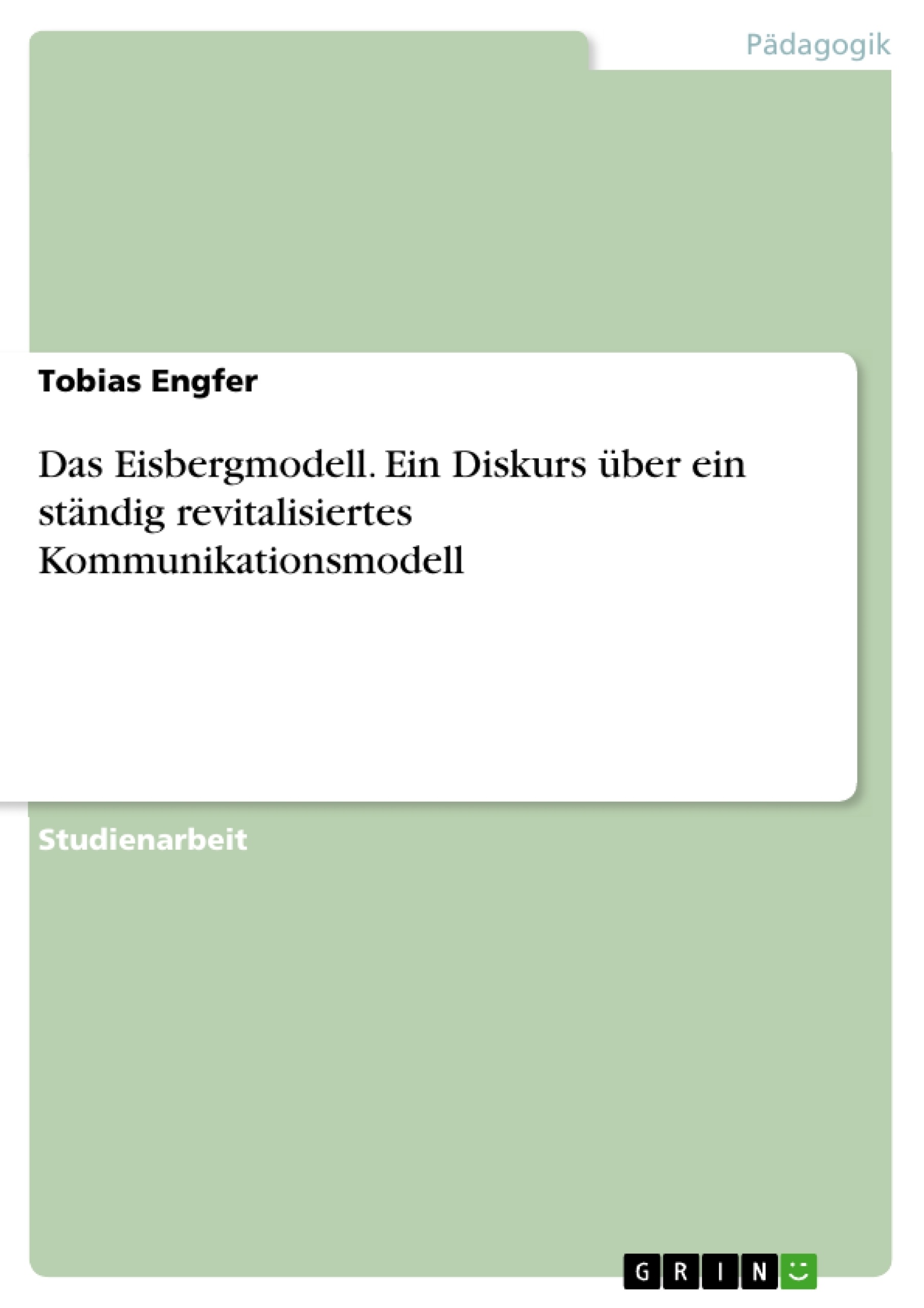1. Einleitung
„Man kann nicht nicht kommunizieren.“ (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1996, S. 53) Dieses Axiom von Paul Watzlawick ist bestimmend für jegliche Art der Kommunikation, sei sie verbal oder nonverbal. Einzige Voraussetzung ist, dass mindestens zwei Personen interagieren. (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1996, S. 52f)
Für die vorliegende Hausarbeit ist dieser Ausspruch von solcher grundlegenden Bedeutung, da es um ein Kommunikationsmodell geht, welches in den Fokus der Betrachtungen rückt. Es gibt die verschiedensten Modelle mithilfe derer Kommunikation, respektive personelle Inter-aktion, erklärt und beschrieben, werden kann. Aufgrund dessen sind eine ausführliche Dar-stellung und ein detaillierter Überblick über besagte Modelle, innerhalb eines solchen Rahmens nicht zu realisieren.
Gerade weil der Bereich der Kommunikation ein solch breites Feld darstellt, ist eine Differen-zierung von Nöten, die sich aus dem Hintergrund des Seminars ergibt. Schwerpunktmäßig soll hier das EISBERGMODELL behandelt werden, unter dem Aspekt der Berufspädagogik. Um solch eine Thematisierung vorzunehmen ist es dennoch notwendig, andere Anwendungs-gebiete aufzuzeigen und die Herkunft dieses Modelles mit eingehend darzustellen.
Daraus lässt sich die Struktur der Hausarbeit ableiten. Zunächst werden Begrifflichkeiten näher erläutert, die eine zentrale Rolle spielen. Daraufhin soll der Ursprung respektive der Hintergrund des Eisbergmodells beleuchtet werden. Maßgeblichen Anteil daran hat Sigmund Freud mit seiner psychoanalytischen Interpretation des Bewussten und des Unbewussten. Dem schließt sich ein weiteres Anwendungsfeld an. In den Wirtschaftswissenschaften findet das Modell mit Bezug auf die Unternehmenskultur rege Verwendung. Die Idee geht zurück auf Edgar Henry Schein. Hans Ulrich Gresch hat das Eisbergmodell von Freud aufgegriffen und weiter verfeinert. Wie bereits erwähnt soll die Berufspädagogik bei all diesen Betrach-tungswinkeln nicht untergehen, weswegen als Bindeglied die Lernkultur angebracht wird, die als Bestandteil der Unternehmenskultur und somit auch des Eisbergmodells, dennoch eine Disziplin der Berufs- und Erwachsenenbildung ist. Im Fazit erfolgt eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen abgehandelten Bereichen und welchen Einfluss sie auf die Verwen-dung des Kommunikationsmodells haben, wenn es in der Berufspädagogik angewendet wird.
Table of Contents
- 1. Einleitung
- 2. Begrifflichkeiten
- 2.1. Unternehmenskultur
- 2.2. Kommunikation
- 3. Das Eisbergmodell nach Sigmund Freud
- 4. Das Eisbergmodell nach Schein
- 4.1. Basis- und Grundannahmen
- 4.2. Werte, Normen und Standards
- 4.3. Artefakte, Symbole und Zeichen
- 5. Das Eisbergmodell der Kommunikation
- 6. Das Bindeglied Lernkultur
- 7. Fazit
Objectives and Key Themes
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Eisbergmodell als Kommunikationsmodell und untersucht seine Anwendung in der Berufspädagogik. Ziel ist es, die verschiedenen Ebenen des Modells zu beleuchten, seine historischen Wurzeln aufzuzeigen und seine Relevanz für die Gestaltung von Lernkultur in Unternehmen darzustellen.
- Begriffserklärung von Unternehmenskultur und Kommunikation
- Die Entwicklung und Anwendung des Eisbergmodells in verschiedenen Disziplinen
- Das Eisbergmodell im Kontext der Unternehmenskultur und seiner Bedeutung für Lernkultur
- Der Einfluss des Eisbergmodells auf die Gestaltung von Kommunikation in der Berufspädagogik
Chapter Summaries
- Die Einleitung führt das Axiom von Paul Watzlawick "Man kann nicht nicht kommunizieren" ein und erläutert die Relevanz des Eisbergmodells als Kommunikationsmodell.
- Kapitel 2 definiert die Begriffe Unternehmenskultur und Kommunikation und zeigt die vielschichtigen Ansätze und Problemfelder dieser Konzepte auf.
- Kapitel 3 beleuchtet den Ursprung des Eisbergmodells in der psychoanalytischen Interpretation von Sigmund Freud, die das Bewusste und das Unbewusste unterscheidet.
- Kapitel 4 analysiert das Eisbergmodell von Edgar Schein und seine drei Ebenen: Basis- und Grundannahmen, Werte, Normen und Standards sowie Artefakte, Symbole und Zeichen.
- Kapitel 5 untersucht das Eisbergmodell im Kontext der Kommunikation und seine Anwendungsmöglichkeiten.
- Kapitel 6 stellt die Lernkultur als Bindeglied zwischen Unternehmenskultur und Berufspädagogik dar.
Keywords
Diese Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Unternehmenskultur, Kommunikation, Eisbergmodell, Lernkultur und Berufspädagogik. Sie analysiert die verschiedenen Ebenen des Eisbergmodells und deren Bedeutung für die Gestaltung von Lernkultur in Unternehmen. Dabei werden wichtige Themen wie die psychoanalytische Interpretation des Bewussten und des Unbewussten, die Anwendung des Modells in der Wirtschaft und die Relevanz des Modells für die Kommunikation in der Berufspädagogik behandelt.
- Arbeit zitieren
- Tobias Engfer (Autor:in), 2011, Das Eisbergmodell. Ein Diskurs über ein ständig revitalisiertes Kommunikationsmodell, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167714