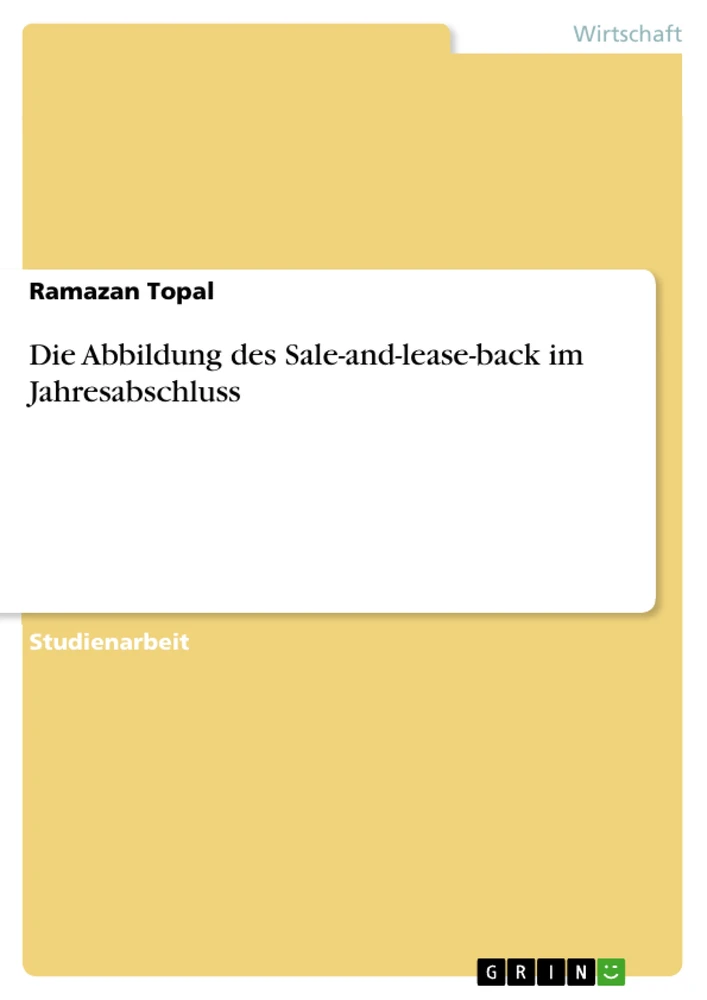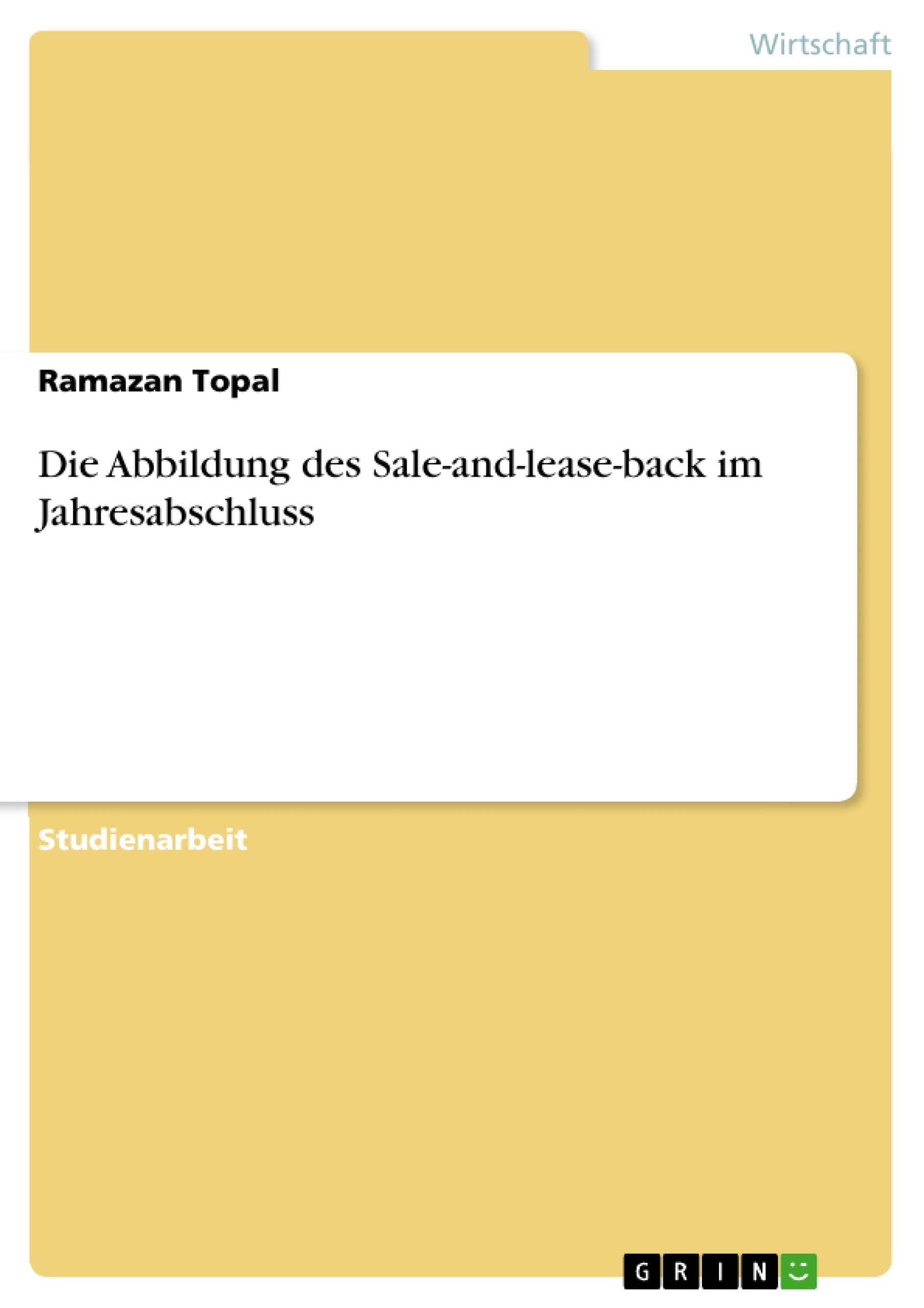Kreditklemme, Liquiditätsengpass und Insolvenzgefahr sind einige Schlagworte, die die Wirtschaftsnachrichten angeheizt durch die Finanzkrise füllen. Die restriktivere Kreditpolitik der Banken – spätestens seit den Kreditvergaberichtlinien nach Basel II – verschärft zusätzlich die Kapitalbeschaffung für Unternehmen durch Bankkredite. So liegt es nahe, dass viele kleine und mittelständische Unternehmen den Forderungen der Banken mangels Kreditsicherheiten nicht gerecht werden können.
Die Sale-and-lease-back-Transaktionen stellen eine alternative Finanzierungsform dar, die die Liquidität der Unternehmen erhöht und ihre Handlungsspielräume vergrößert. Auch bei expandierenden Unternehmen gehören Sale-and-lease-Geschäfte zur gängigen Praxis, denn Wachstum geht stets mit einem verstärkten Bedarf an liquiden Mitteln einher. Diese Finanzierungsart findet ferner bei solide aufgestellten Unternehmen aus steuerlichen oder bilanzpolitischen Motiven Einsatz.
Das Ziel dieser Seminararbeit ist es, das Sale-and-lease-back als Sonderform des Leasings mit Fokus auf die bilanzielle Abbildung nach HGB vorzustellen.
Nach einer kurzen Einführung in das Thema werden die Motive angesprochen, die einen Leasingnehmer dazu bewegt, sich für Sale-and-lease-back-Gestaltung zu entscheiden. Im Hauptteil wird vertieft auf die Bilanzierung im Jahresabschluss nach HGB eingegangen. In einem Fallbeispiel wird der Verfasser die Auswirkung einer Sale-and-lease-back-Transaktion auf die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung exemplarisch mit den dazugehörigen Buchungen aufzeigen. Im letzten Kapitel werden die Besonderheiten zwischen den Rechnungslegungsvorschriften nach HGB und IFRS hervorgehoben.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung und Aufbau
- B. Grundlagen
- 1. Was ist Sale-and-lease-back?
- 2. Welche Motive hat ein Leasingnehmer?
- C. Bilanzierung im Jahresabschluss nach HGB
- 1. Wer hat das Leasinggut zu bilanzieren?
- a)
- b)
- 2. Operating Leasing
- Fallbeispiel
- Finanzierungsleasing
- a) Buchungen beim Leasingnehmer
- b) Buchungen beim Leasinggeber
- c) Auswirkung auf die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
- 1. Wer hat das Leasinggut zu bilanzieren?
- D. Unterschiede zwischen HGB und IFRS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Abbildung von Sale-and-lease-back-Transaktionen im Jahresabschluss nach HGB. Das Ziel ist es, diese Finanzierungsform zu erläutern, die Motive des Leasingnehmers zu beleuchten und die bilanzielle Darstellung nach HGB detailliert darzustellen. Ein Fallbeispiel veranschaulicht die Auswirkungen auf Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung.
- Sale-and-lease-back als alternative Finanzierungsform
- Motive des Leasingnehmers für Sale-and-lease-back
- Bilanzierung nach HGB
- Auswirkungen auf Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
- Vergleich HGB und IFRS
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung und Aufbau: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit vor dem Hintergrund der Finanzkrise und der verschärften Kreditvergabepolitik der Banken. Sale-and-lease-back wird als alternative Finanzierungslösung für Unternehmen, insbesondere KMUs, positioniert, die durch Liquiditätsengpässe und Kreditbeschaffungsprobleme beeinträchtigt sind. Die Arbeit fokussiert auf die bilanzielle Abbildung nach HGB und beleuchtet die Motive von Leasingnehmern sowie die Auswirkungen auf Bilanz und GuV anhand eines Fallbeispiels. Der Vergleich mit IFRS bildet einen weiteren Schwerpunkt.
B. Grundlagen: Dieses Kapitel liefert eine Einführung in das Leasing und definiert Sale-and-lease-back als Sonderform des Leasings. Es wird erklärt, dass Sale-and-lease-back aus zwei separaten Verträgen besteht: einem Kaufvertrag und einem Leasingvertrag. Der Fokus liegt auf der Freisetzung von gebundenem Kapital durch den Verkauf des Vermögenswerts an eine Leasinggesellschaft mit anschließendem Rückmietvertrag. Das Kapitel erläutert die grundsätzlichen Vertragsbestandteile und den Unterschied zu konventionellem Leasing.
C. Bilanzierung im Jahresabschluss nach HGB: Dieser Abschnitt befasst sich detailliert mit der bilanzellen Abbildung von Sale-and-lease-back-Transaktionen nach HGB. Er behandelt die Frage, wer das Leasinggut zu bilanzieren hat, und unterscheidet zwischen Operating- und Finanzierungsleasing. Ein Fallbeispiel illustriert die Buchungen beim Leasingnehmer und Leasinggeber und zeigt die Auswirkungen auf die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung. Die verschiedenen Aspekte der Bilanzierung werden umfassend beleuchtet und an praktischen Beispielen erklärt.
D. Unterschiede zwischen HGB und IFRS: Das abschließende Kapitel hebt die Unterschiede in der Rechnungslegung von Sale-and-lease-back-Transaktionen nach HGB und IFRS hervor. Es vergleicht die jeweiligen Vorschriften und zeigt auf, wo sich die Behandlung dieser Transaktionen in den beiden Rechnungslegungsstandards unterscheidet. Dieser Vergleich liefert einen wichtigen Kontext für ein umfassendes Verständnis der Thematik.
Schlüsselwörter
Sale-and-lease-back, Leasing, Bilanzierung, Jahresabschluss, HGB, IFRS, Finanzierungsform, Liquidität, Kreditbeschaffung, Buchungen, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung.
Häufig gestellte Fragen zu: Sale-and-lease-back Bilanzierung
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit befasst sich umfassend mit Sale-and-lease-back-Transaktionen. Sie beinhaltet eine Einleitung, Grundlageninformationen zu Sale-and-lease-back, eine detaillierte Erläuterung der Bilanzierung nach HGB (Handelsgesetzbuch), einschließlich eines Fallbeispiels, und einen Vergleich der Bilanzierung nach HGB und IFRS (International Financial Reporting Standards). Die Arbeit beleuchtet die Motive des Leasingnehmers und die Auswirkungen auf Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung.
Was ist Sale-and-lease-back?
Sale-and-lease-back ist eine spezielle Form des Leasings, bei der ein Unternehmen einen Vermögensgegenstand verkauft und anschließend von dem Käufer zurückmietet. Es besteht aus zwei getrennten Verträgen: einem Kaufvertrag und einem Leasingvertrag. Das Hauptziel ist die Freisetzung von gebundenem Kapital.
Welche Motive hat ein Leasingnehmer für Sale-and-lease-back?
Die Motive eines Leasingnehmers sind vielfältig, oftmals geht es um die Verbesserung der Liquiditätssituation, insbesondere bei Liquiditätsengpässen oder Problemen bei der Kreditbeschaffung. Sale-and-lease-back kann eine alternative Finanzierungslösung darstellen.
Wie wird Sale-and-lease-back nach HGB bilanziert?
Die Bilanzierung nach HGB unterscheidet zwischen Operating-Leasing und Finanzierungsleasing. Die Seminararbeit beschreibt detailliert die Buchungen beim Leasingnehmer und Leasinggeber für beide Varianten und zeigt die Auswirkungen auf die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung anhand eines Fallbeispiels. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, wer das Leasinggut zu bilanzieren hat.
Welche Unterschiede gibt es in der Bilanzierung von Sale-and-lease-back nach HGB und IFRS?
Das letzte Kapitel der Arbeit vergleicht die Vorschriften zur Bilanzierung von Sale-and-lease-back nach HGB und IFRS und hebt die Unterschiede in der Behandlung dieser Transaktionen in den beiden Rechnungslegungsstandards hervor.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Thematik?
Schlüsselwörter sind: Sale-and-lease-back, Leasing, Bilanzierung, Jahresabschluss, HGB, IFRS, Finanzierungsform, Liquidität, Kreditbeschaffung, Buchungen, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in vier Abschnitte: Einleitung und Aufbau, Grundlagen von Sale-and-lease-back, Bilanzierung nach HGB mit Fallbeispiel und schließlich ein Vergleich der Bilanzierung nach HGB und IFRS. Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit vor dem Hintergrund der Finanzkrise und der verschärften Kreditvergabepolitik der Banken.
- Quote paper
- Ramazan Topal (Author), 2010, Die Abbildung des Sale-and-lease-back im Jahresabschluss, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167577