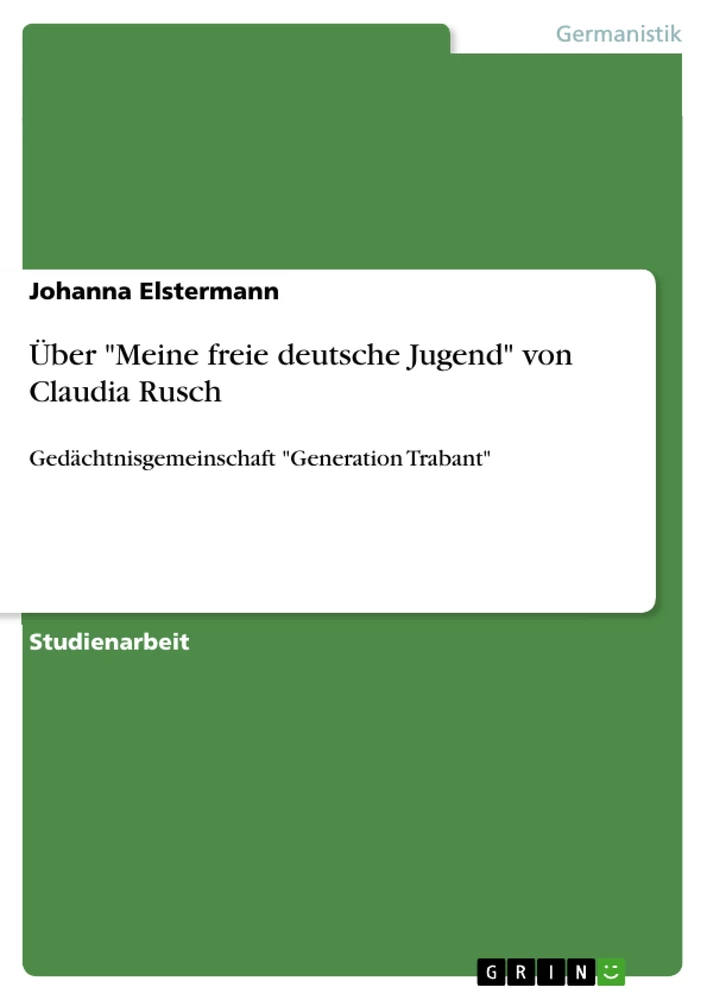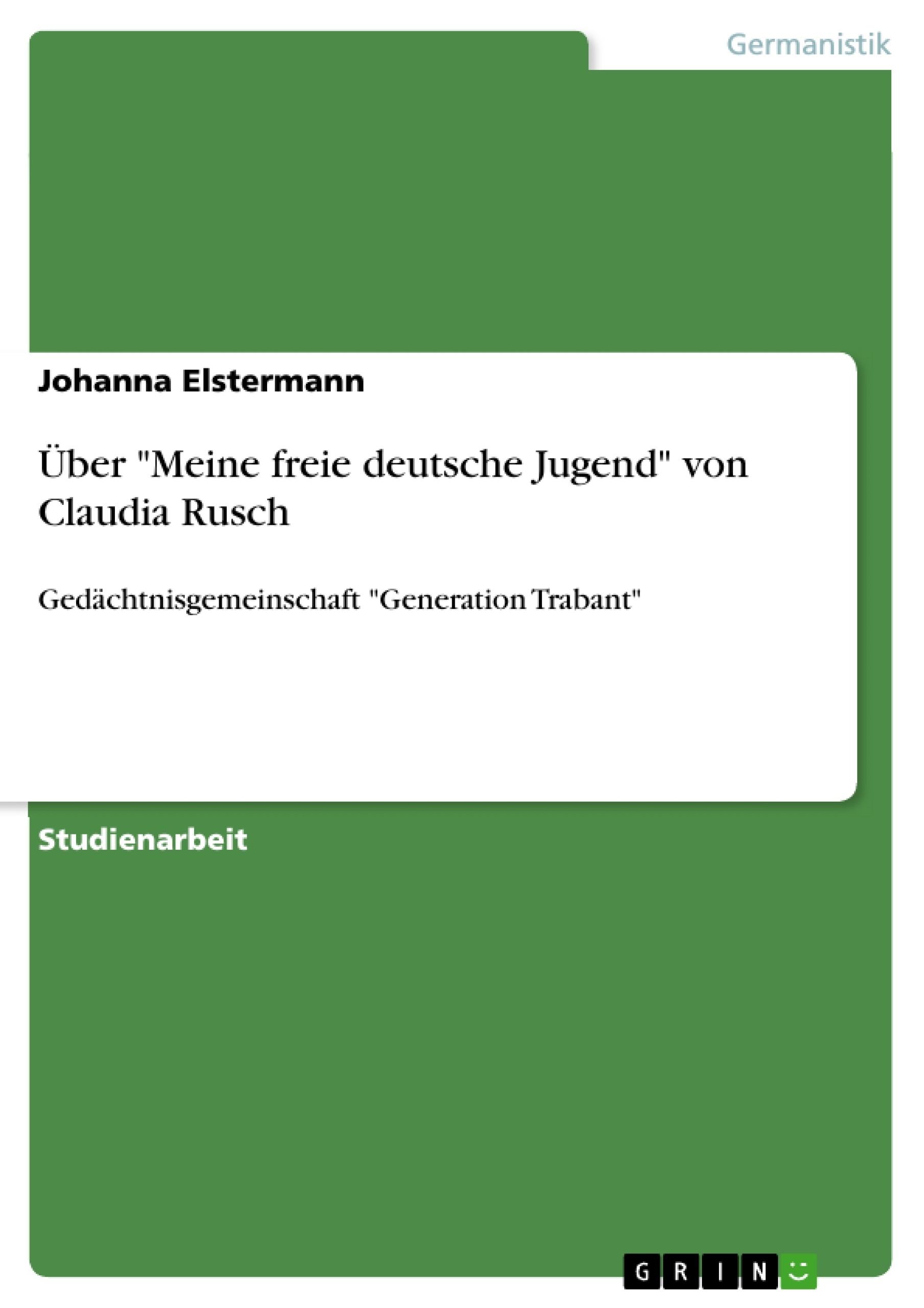Erinnerungsbücher wie Meine freie deutsche Jugend von Claudia Rusch, um das es in der vorliegenden Ausarbeitung gehen soll, nehmen eine besondere Rolle ein, da sie nicht nur über den Prozess des Erwachsenwerdends erzählen, sondern auch über einen Staat schreiben, der parallel dazu verschwand.
Die Ich-Erzählinstanz führt den Leser, in Meine freie deutsche Jugend über 27 pointenreichen Erinnerungsgeschichten, durch ihre Kindheit und Jugend in der DDR. In den einzelnen Geschichten wechselt der Standpunkt der Erzählerin vom Kind zur Jugendlichen oder zur Erwachsenen. Rusch wird mit jeder Geschichte älter, ähnlich dem Protagonisten eines Bildungsromans.
Anders als im Erinnerungsbuch Zonenkinder von Jana Hensel, die den Anspruch hat im “Wir” für eine ganze Generation zu sprechen, geht es Claudia Rusch um Erinnnerungen an ihre individuelle Lebensgeschichte, diese ist einerseits geprägt von außergewöhnlichen Erfahrungen eines Oppossitionellenkindes in einem totalitären Staat und andererseits von typischen Kindheitsmustern in der DDR.
Auf welch schicksalshafte Weise das Leben von Claudia Rusch mit der Existenz der DDR verbunden ist, wird schon am Geburtsdatum deutlich. Sie wurde 1971 geboren und feierte ihre Volljährigkeit im Jahr des Mauerfalls 1989. Damit wurde sie nicht nur vom Gesetz mit größeren Entscheidungsfreiheiten ausgestattet, sondern auch die Begrenzungen der DDR- BürgerInnen wurden gleichzeitig mit dem Fall der Mauer aufgehoben.
Von Kritikern wurde ihr Buch in eine Reihe mit teils systemkritischen (u.a. Mein erstes T-Shirt von Jakob Hein) teils „ostalgischen“ (u.a. Zonenkinder von Jana Hensel) Auseinandersetzungen ihrer Generation mit Kindheit und Aufwachsen in der DDR gestellt. Entsprechend wurden Hensel und Rusch auch als östliches Pendant zur westlichen Generation Golf bezeichnet, der entsprechende Begriff Generation Trabant war schon 2001 geprägt worden. Auf den Aspekt der Gedächtnisgemeinschaft Generation Trabant werden ich im letzten Punkt eingehen.
Die vorliegende Ausarbeitung ist so aufgebaut, dass auf eine gesamte Inhaltsangabe, aufgrund der Segmenthaftigkeit der einzelnen Erzählungen, verzichtet wird. Im ersten Punkt wird die Rolle des politischen Regimes und seiner Institutionen für die Identitätsbildung der werdenden Schriftstellerin untersucht.
Zuletzt wende ich mich auch der Frage zu, wodurch das Verhältnis der autobiographischen Darstellung zum Prozess der Erinnerung gekennzeichnet ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Totalitärer Staat und Identitätsbildung
- 2.1 Leitmotiv: Die Sehnsucht nach Reisefreiheit
- 2.2 Identität und Öffentlichkeitsebenen
- 2.3 Schwerter zu Pflugscharen
- 2.4 Die Jugendweihe als Institution
- 3. Gedächtnisgemeinschaft Generation Trabant
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht die Darstellung von Kindheit und Jugend in der DDR im autobiografischen Werk „Meine freie deutsche Jugend“ von Claudia Rusch. Das Hauptziel besteht darin, den Einfluss des totalitären Staates auf die Identitätsbildung der Autorin zu analysieren und die spezifischen Herausforderungen aufzuzeigen, denen oppositionelle Kinder ausgesetzt waren. Die Arbeit beleuchtet das Verhältnis zwischen individueller Erfahrung und kollektivem Gedächtnis der „Generation Trabant“.
- Der Einfluss des totalitären DDR-Staates auf die Identitätsbildung eines Kindes.
- Die Herausforderungen der Bewältigung von staatlicher Überwachung und Kontrolle im Alltag.
- Die Sehnsucht nach Freiheit und Reisefreiheit als zentrales Motiv.
- Die Ambivalenz der Erinnerung an die DDR und die Konstruktion der eigenen Identität.
- Die Rolle der „Generation Trabant“ im kollektiven Gedächtnis.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt das Buch „Meine freie deutsche Jugend“ von Claudia Rusch vor. Sie beschreibt das Buch als autobiografische Darstellung der Kindheit und Jugend der Autorin in der DDR, betont die besondere Perspektive eines oppositionellen Kindes und den Kontext des sich auflösenden Staates. Die Einleitung hebt die Besonderheit des Werkes im Vergleich zu anderen Erinnerungsliteratur hervor, indem sie den Fokus auf die individuelle Erfahrung und den daraus resultierenden Herausforderungen setzt, im Gegensatz zum Anspruch auf Repräsentation einer ganzen Generation. Der Bezug zum persönlichen Umfeld des Autors wird dargelegt, um die Relevanz der Arbeit zu unterstreichen, und die aktuelle Forschungslage wird kurz angeschnitten.
2. Totalitärer Staat und Identitätsbildung: Dieses Kapitel analysiert den prägenden Einfluss des totalitären DDR-Staates auf die Identitätsbildung der Autorin. Es betont die starke gesellschaftliche und historische Determiniertheit der kindlichen Erfahrung und die Schlüsselrolle des Staates. Der Fokus liegt auf dem Einfluss des Systems auf die Entwicklung der Autorin und wie sich die individuellen Faktoren in diesem Kontext entwickeln. Andere Einflüsse, beispielsweise die Beziehung zu den Eltern, werden als zu umfangreich für den Rahmen der Ausarbeitung genannt.
2.1 Leitmotiv: Die Sehnsucht nach Reisefreiheit: Dieses Unterkapitel konzentriert sich auf die Sehnsucht nach Reisefreiheit als zentrales Motiv in Ruschs Buch. Die Sehnsucht wird als eine der frühesten Erinnerungen der Autorin dargestellt, die die räumlichen und politischen Beschränkungen der DDR verdeutlicht. Die Reisefreiheit symbolisiert dabei nicht nur den Wunsch nach geografischer Mobilität, sondern auch nach persönlicher Freiheit und dem Bruch mit den politischen Zwängen des Systems. Die Kontrastierung der kindlichen Sehnsucht mit der Realität der Fluchtversuche über die Ostsee unterstreicht die politischen Repressalien des Systems.
2.2 Identität und Öffentlichkeitsebenen: Dieses Unterkapitel befasst sich mit dem Umgang der Autorin mit der ständigen Überwachung und Kontrolle durch die Staatssicherheit. Es zeigt, wie sie frühzeitig lernt, zwischen privatem und öffentlichem Diskurs zu unterscheiden und die Ambivalenz ihrer Erfahrungen mit den Sicherheitskräften zu verarbeiten. Die Anekdote über den Begriff „Kakerlake“ illustriert die kindliche Unwissenheit über die politische Bedeutung und das komplizierte Zusammenspiel der verschiedenen Kommunikationsebenen. Der Einfluss des Systems und der informellen Mitarbeiter (IM) auf das soziale Klima des Misstrauens wird anhand der Familiengeschichte deutlich.
Schlüsselwörter
DDR, Identitätsbildung, totalitärer Staat, Staatssicherheit (Stasi), Opposition, Reisefreiheit, Erinnerungsliteratur, Generation Trabant, autobiografische Darstellung, kollektives Gedächtnis.
Häufig gestellte Fragen zu "Meine freie deutsche Jugend"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Darstellung von Kindheit und Jugend in der DDR im autobiografischen Werk „Meine freie deutsche Jugend“ von Claudia Rusch. Sie untersucht den Einfluss des totalitären Staates auf die Identitätsbildung der Autorin und die Herausforderungen oppositioneller Kinder in der DDR. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Verhältnis zwischen individueller Erfahrung und kollektivem Gedächtnis der „Generation Trabant“.
Welche Themen werden im Buch behandelt?
Das Buch behandelt Themen wie den Einfluss des totalitären DDR-Staates auf die Identitätsbildung, die Bewältigung staatlicher Überwachung und Kontrolle, die Sehnsucht nach Freiheit und Reisefreiheit, die Ambivalenz der Erinnerung an die DDR und die Konstruktion der eigenen Identität, sowie die Rolle der „Generation Trabant“ im kollektiven Gedächtnis.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über den totalitären Staat und Identitätsbildung (mit Unterkapiteln zu Reisefreiheit und Öffentlichkeitsebenen), ein Kapitel über die Gedächtnisgemeinschaft Generation Trabant und ein Fazit. Die Einleitung führt in das Thema und das Buch ein. Kapitel 2 analysiert den Einfluss des Staates auf die Identitätsbildung der Autorin. Kapitel 3 befasst sich mit der „Generation Trabant“ im kollektiven Gedächtnis. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welches ist das zentrale Motiv im Buch?
Die Sehnsucht nach Reisefreiheit ist ein zentrales Motiv, das die räumlichen und politischen Beschränkungen der DDR und den Wunsch nach persönlicher Freiheit symbolisiert.
Wie wird die staatliche Überwachung und Kontrolle dargestellt?
Die Arbeit zeigt, wie die Autorin lernt, zwischen privatem und öffentlichem Diskurs zu unterscheiden und die Ambivalenz ihrer Erfahrungen mit der Staatssicherheit zu verarbeiten. Der Einfluss der Stasi und informeller Mitarbeiter (IM) auf das soziale Klima wird thematisiert.
Wie unterscheidet sich dieses Werk von anderer Erinnerungsliteratur?
Das Werk hebt die individuelle Erfahrung und die daraus resultierenden Herausforderungen hervor, im Gegensatz zum Anspruch auf Repräsentation einer ganzen Generation. Es fokussiert sich auf die persönliche Geschichte der Autorin.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: DDR, Identitätsbildung, totalitärer Staat, Staatssicherheit (Stasi), Opposition, Reisefreiheit, Erinnerungsliteratur, Generation Trabant, autobiografische Darstellung, kollektives Gedächtnis.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Hauptzielsetzung besteht darin, den Einfluss des totalitären Staates auf die Identitätsbildung der Autorin zu analysieren und die spezifischen Herausforderungen aufzuzeigen, denen oppositionelle Kinder ausgesetzt waren.
- Quote paper
- Johanna Elstermann (Author), 2010, Über "Meine freie deutsche Jugend" von Claudia Rusch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167563