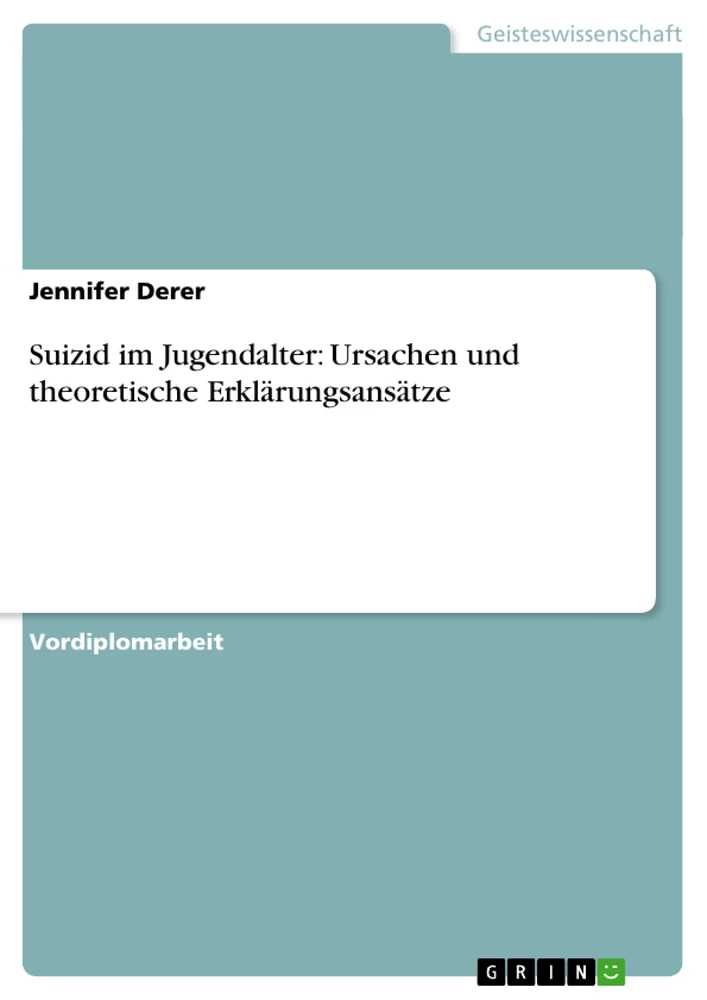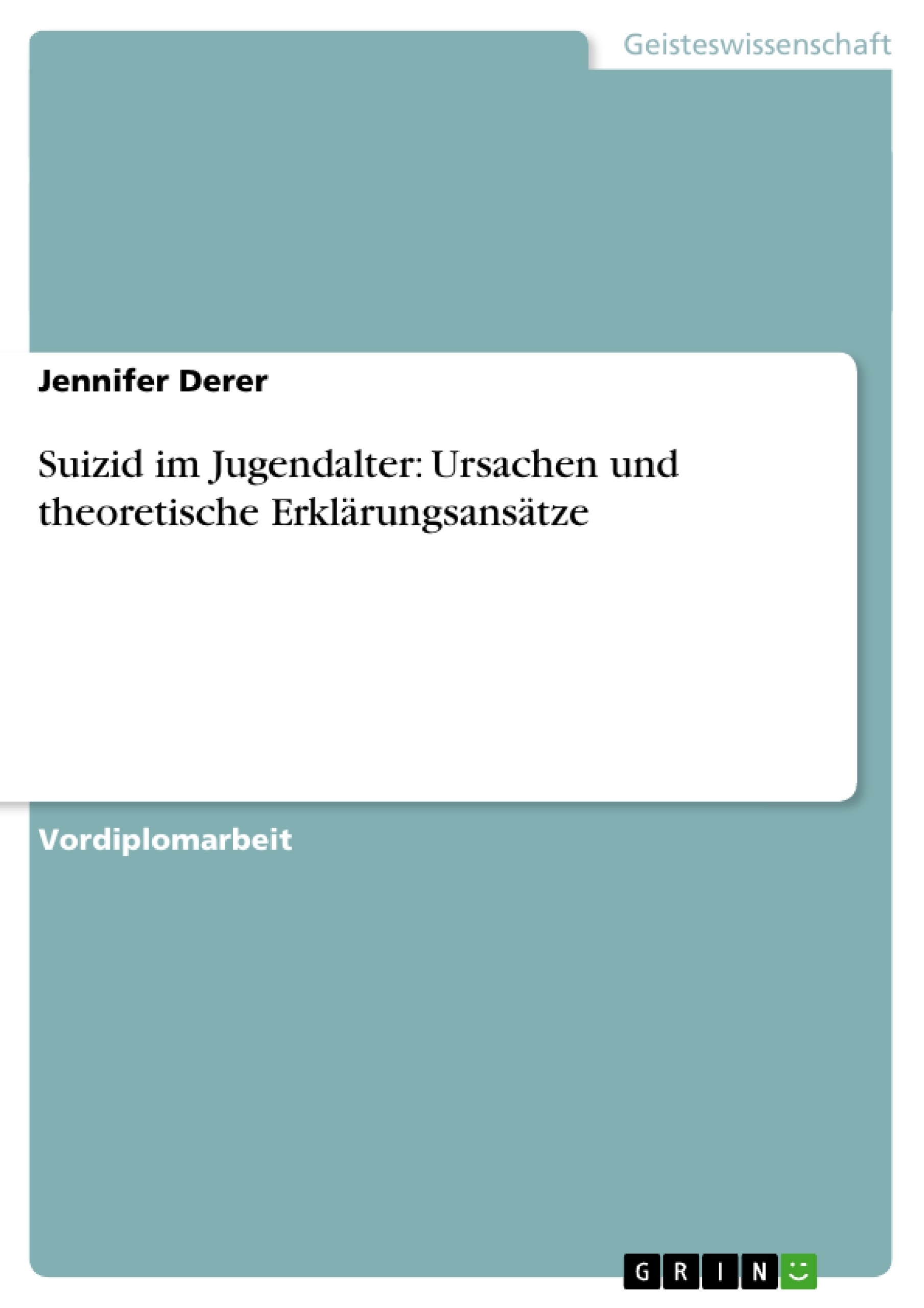In Deutschland sterben jährlich etwa 700 junge Menschen im Alter zwischen 5 und 25
Jahren durch Suizid (siehe Suizidstatistik, S. 4). Auch Markus wollte sterben. Aus
Liebeskummer warf er sich vor eine U-Bahn. Lediglich das schnelle
Reaktionsvermögen des U-Bahn-Fahrers rettete dem damals 17-jährigen das Leben.
Die Zahl von 700 jugendlichen Suizidanten erscheint in Bezug auf die Gesamtzahl von
ca. 12.000 Suiziden im Jahr nicht sehr hoch. Berücksichtigt man allerdings die
Gesamtzahl der jugendlichen Todesfälle (etwa 6000 Gestorbene im Jahr 2000;
inklusive den Suizidtoten; vgl. Statistisches Jahrbuch 2002, S. 73) wird sichtbar, dass
der Tod durch Suizid die zweithäufigste Todesursache bei Jugendlichen darstellt. Und
auch aus emotionaler Sicht erscheint eine Anzahl von 700 jungen Menschen, die
freiwillig aus dem Leben scheiden alles andere als gering. Es wird wohl kaum
jemanden unberührt lassen, wenn er in einer Zeitungsmeldung liest, dass sich ein 16-
jähriges Mädchen auf dem Dachboden ihres Elternhauses erhängt hat. Vielmehr lösen
solche Ereignisse Entsetzen, Fassungslosigkeit, Schmerz und die Frage nach dem
„warum?“ aus. Folglich beschäftige ich mich im dritten Kapitel meiner Arbeit mit der
Frage, welche Motive und Lebensumstände bei Jugendlichen zu dem Entschluss
führen (können), ihrem Leben ein Ende zu bereiten, wobei ich besonders die
Identitätsfindung des Jugendlichen berücksichtige. Zuvor (Kapitel zwei) erläutere ich jedoch die für meine Arbeit relevanten Begriffe
„Suizid“ und „Suizidversuch“, um den Rahmen meiner Vordiplomarbeit festzusetzen.
Im vierten Teil, welcher den Hauptteil der Arbeit ausmacht, stelle ich medizinische,
psychologische und soziologische Suizidtheorien, zunächst allgemein dar, bevor ich
diese Modelle daraufhin überprüfe, inwieweit sie das Phänomen Suizid bei
Jugendlichen aus heutiger Sicht beschreiben.
Abschließend (Punkt 5) gebe ich einige Schlussfolgerungen für die Sozialarbeit
wieder. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begrifflichkeiten und epidemiologische Daten
- 2.1. Suizid
- 2.2. Suizidversuch
- 3. Ursachen und Hintergründe von suizidalen Handlungen im Jugendalter
- 4. Theoretische Erklärungsansätze
- 4.1. Emile Durkheims soziologische Suizidtheorie
- 4.1.1. Der egoistische Selbstmord
- 4.1.2. Der altruistische Selbstmord
- 4.1.3. Der anomische Selbstmord
- 4.1.4. Die soziologische Suizidtheorie in Bezug auf Jugendliche
- 4.2. Die psychoanalytische Suizidtheorie von Sigmund Freud
- 4.2.1. Freuds „Trauer und Melancholie“
- 4.2.2. Die psychoanalytische Suizidtheorie in Bezug auf Jugendliche
- 4.3. Die medizinische Theorie des präsuizidalen Syndroms von Erwin Ringel
- 4.3.1. Einengung
- 4.3.2. Aggressionsumkehr
- 4.3.3. Suizidphantasien
- 4.3.4. Das präsuizidale Syndrom bei Jugendlichen
- 4.1. Emile Durkheims soziologische Suizidtheorie
- 5. Schlussfolgerung für die Sozialarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Suizide im Jugendalter. Ziel ist es, die Ursachen und Hintergründe suizidaler Handlungen bei Jugendlichen zu beleuchten und verschiedene theoretische Erklärungsansätze zu präsentieren und zu bewerten.
- Definition und epidemiologische Daten von Suizid und Suizidversuchen
- Ursachen und Hintergründe suizidaler Handlungen im Jugendalter
- Soziologische Erklärungsansätze (Durkheim)
- Psychoanalytische Erklärungsansätze (Freud)
- Medizinische Erklärungsansätze (präsuizidales Syndrom nach Ringel)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem emotionalen Brief eines Jugendlichen, der Suizid begehen will, um die Tragik und die Dringlichkeit des Themas zu veranschaulichen. Anschließend werden die epidemiologischen Daten in Deutschland vorgestellt, die Suizid als zweithäufigste Todesursache bei Jugendlichen identifizieren. Die Arbeit kündigt die folgenden Kapitel an, die sich mit Begriffsbestimmungen, Ursachen, theoretischen Erklärungsansätzen und Schlussfolgerungen für die Sozialarbeit befassen.
2. Begrifflichkeiten und epidemiologische Daten: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe „Suizid“ und „Suizidversuch“. Es werden verschiedene Bezeichnungen und ihre impliziten Wertungen diskutiert, wobei die Notwendigkeit neutraler Begriffe für wissenschaftliche Zwecke betont wird. Es folgt eine detaillierte Definition von Suizid, die sowohl aktive als auch passive Handlungen umfasst, und verweist auf die Arbeiten von Herbert E. Colla und Emile Durkheim.
3. Ursachen und Hintergründe von suizidalen Handlungen im Jugendalter: Dieses Kapitel befasst sich mit den Motiven und Lebensumständen, die Jugendliche zu Suizidgedanken führen können. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Bedeutung der Identitätsfindung in der Adoleszenz. Es werden verschiedene Faktoren, wie beispielsweise soziale, familiäre und psychische Belastungen, berücksichtigt, die zu Suizidhandlungen beitragen können. Das Kapitel verknüpft diese Ursachen mit den theoretischen Ansätzen, die in den nachfolgenden Kapiteln behandelt werden.
4. Theoretische Erklärungsansätze: Dieser umfangreiche Kapitelteil analysiert verschiedene theoretische Modelle zur Erklärung von Suizid, jeweils mit einem Fokus auf die Relevanz für Jugendliche. Es werden die soziologische Theorie Durkheims (egoistisch, altruistisch, anomisch), die psychoanalytische Theorie Freuds (fokussiert auf Trauer und Melancholie) und die medizinische Theorie des präsuizidalen Syndroms nach Ringel (Einengung, Aggressionsumkehr, Suizidphantasien) vorgestellt und kritisch diskutiert. Für jeden Ansatz wird die Übertragbarkeit auf die Situation von Jugendlichen explizit geprüft.
Schlüsselwörter
Suizid, Jugendlicher Suizid, Selbstmord, Suizidprävention, Soziologie, Psychologie, Medizin, Durkheim, Freud, präsuizidales Syndrom, Sozialarbeit, Identitätsfindung, Adoleszenz.
Häufig gestellte Fragen zu: Suizid im Jugendalter - Eine Analyse soziologischer, psychoanalytischer und medizinischer Erklärungsansätze
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Suizide im Jugendalter. Sie beleuchtet die Ursachen und Hintergründe suizidaler Handlungen bei Jugendlichen und präsentiert verschiedene theoretische Erklärungsansätze aus soziologischer, psychoanalytischer und medizinischer Perspektive. Die Arbeit enthält eine Einleitung, Kapitel zu Begriffsbestimmungen und epidemiologischen Daten, Ursachen und Hintergründen suizidaler Handlungen, verschiedene theoretische Erklärungsansätze (Durkheim, Freud, Ringel) und eine Schlussfolgerung für die Sozialarbeit. Ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche theoretischen Ansätze werden behandelt?
Die Arbeit analysiert drei zentrale theoretische Ansätze zur Erklärung von Suizid: Emile Durkheims soziologische Suizidtheorie (egoistisch, altruistisch, anomisch), Sigmund Freuds psychoanalytische Suizidtheorie (fokussiert auf Trauer und Melancholie) und Erwin Ringels medizinische Theorie des präsuizidalen Syndroms (Einengung, Aggressionsumkehr, Suizidphantasien). Für jeden Ansatz wird die Relevanz und Übertragbarkeit auf die Situation von Jugendlichen explizit geprüft.
Welche Faktoren werden als Ursachen für Suizide im Jugendalter genannt?
Die Arbeit nennt verschiedene Faktoren, die zu suizidalen Handlungen bei Jugendlichen beitragen können. Besonderes Augenmerk liegt auf der Bedeutung der Identitätsfindung in der Adoleszenz. Soziale, familiäre und psychische Belastungen werden als wichtige Einflussfaktoren hervorgehoben. Die Arbeit verknüpft diese Ursachen mit den behandelten theoretischen Ansätzen.
Welche Bedeutung haben die epidemiologischen Daten?
Die Arbeit beginnt mit der Darstellung epidemiologischer Daten, die Suizid als zweithäufigste Todesursache bei Jugendlichen in Deutschland identifizieren. Diese Daten unterstreichen die Dringlichkeit und Tragik des Themas und bilden den Ausgangspunkt für die weitere Analyse.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist es, die Ursachen und Hintergründe suizidaler Handlungen bei Jugendlichen zu beleuchten und verschiedene theoretische Erklärungsansätze zu präsentieren und zu bewerten. Der Fokus liegt auf einem umfassenden Verständnis des Phänomens Suizid im Jugendalter.
Welche Schlussfolgerungen werden für die Sozialarbeit gezogen?
Die Arbeit enthält ein Kapitel mit Schlussfolgerungen für die Sozialarbeit. Der genaue Inhalt dieses Kapitels ist im vorliegenden Auszug nicht detailliert beschrieben. Jedoch lässt sich vermuten, dass hier die gewonnenen Erkenntnisse aus der Analyse der verschiedenen theoretischen Ansätze und der Ursachen von Jugendsuiziden auf die Praxis der Sozialarbeit angewendet und Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.
Welche Begriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert die zentralen Begriffe „Suizid“ und „Suizidversuch“. Verschiedene Bezeichnungen und ihre impliziten Wertungen werden diskutiert, wobei die Notwendigkeit neutraler Begriffe für wissenschaftliche Zwecke betont wird. Die Definition von Suizid umfasst sowohl aktive als auch passive Handlungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter der Arbeit umfassen: Suizid, Jugendlicher Suizid, Selbstmord, Suizidprävention, Soziologie, Psychologie, Medizin, Durkheim, Freud, präsuizidales Syndrom, Sozialarbeit, Identitätsfindung, Adoleszenz.
- Quote paper
- Jennifer Derer (Author), 2003, Suizid im Jugendalter: Ursachen und theoretische Erklärungsansätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16749