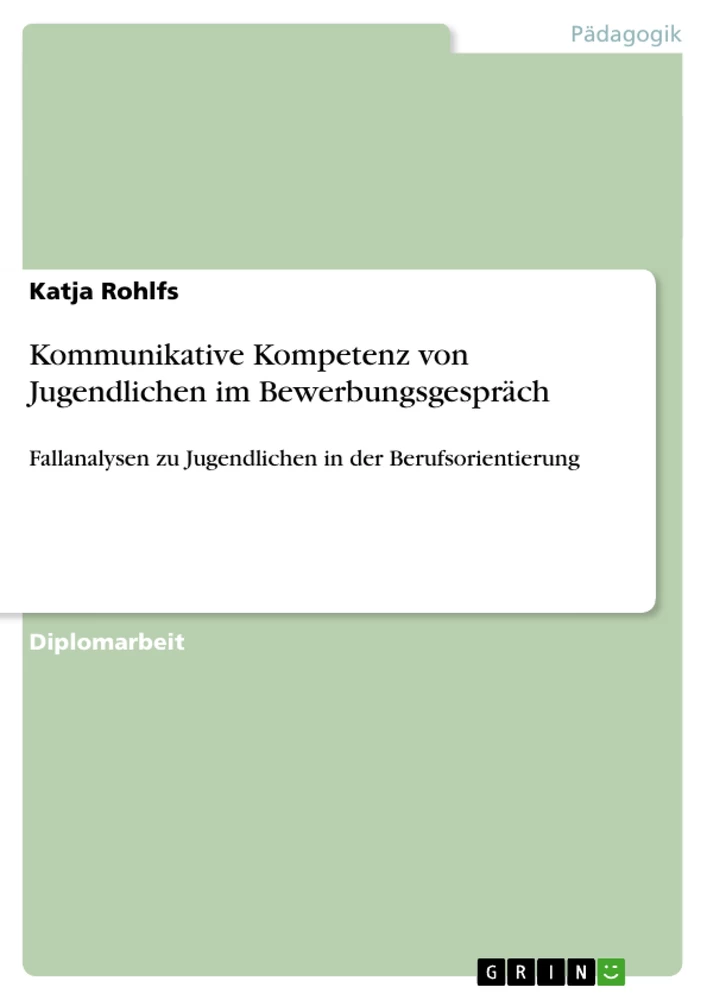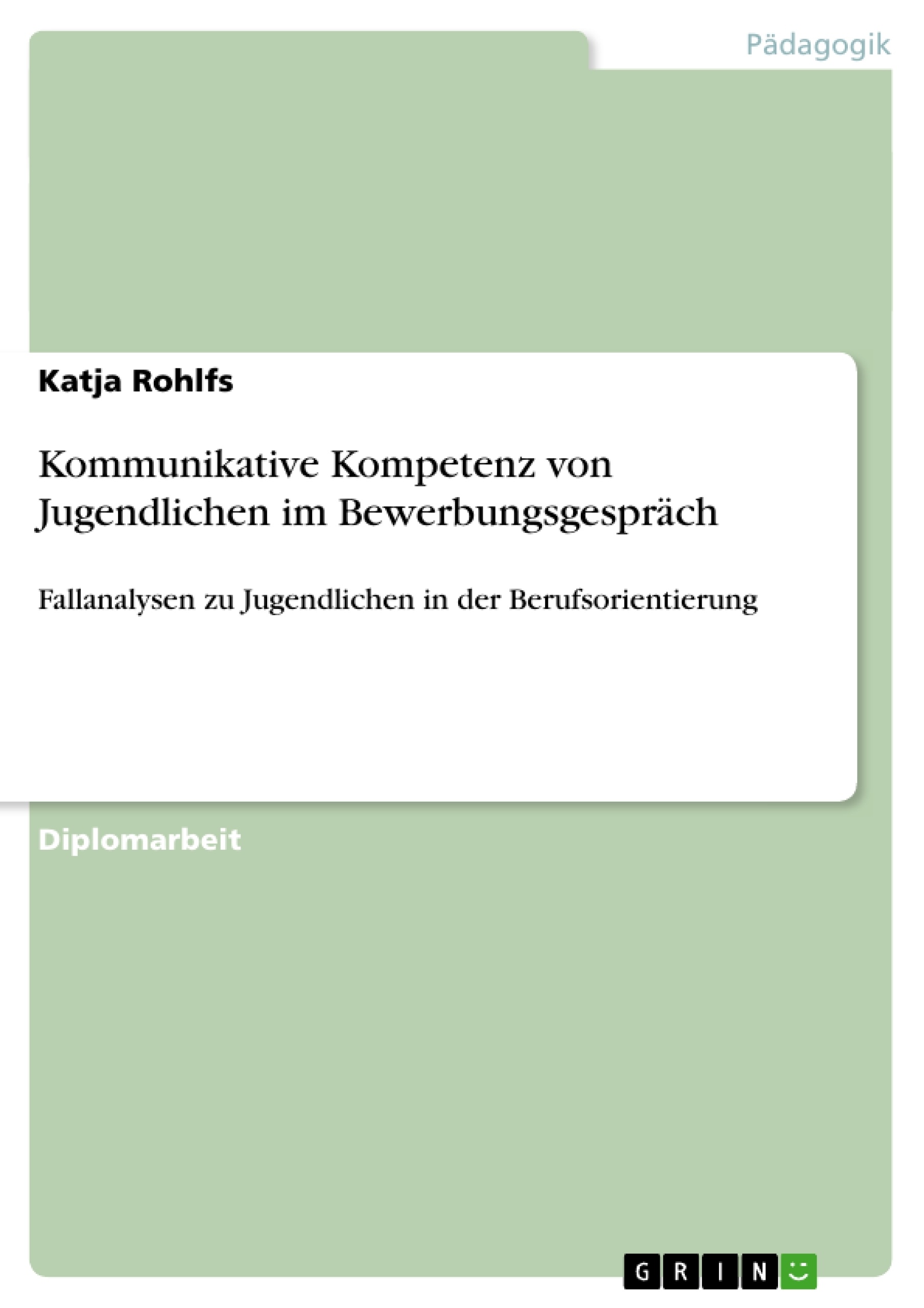Aufbau der Arbeit
Teil I: Theoretischer Bezugsrahmen: Kommunikative Kompetenz im Bewerbungsgespräch
Dieser Teil umfasst die Klärung der Definitionen zur Kommunikation und Kompetenz. Theoretische Konzepte kommunikativer Kompetenz werden vorgestellt und sollen zu einer Konsolidierung der Begrifflichkeit der „Kommunikativen Kompetenz“ führen. In einem zweiten Schritt soll eine theoretische Skizzierung sozialer Kommunikation einschließlich ihrer Einflussfaktoren die hierbei vielfältig zu berücksichtigenden Aspekte anreißen. Ausgehend von den bis dorthin erarbeiteten Grundlagen soll in einem dritten Schritt ein Modell zur Beschreibung kommunikativer Kompetenz erarbeitet werden, das als Grundmodell zur Beobachtung der videographierten Bewerbungsgespräche dienen soll.
Das videotechnisch aufgezeichnete Bewerbungsgespräch als empirischer Zugang wird im Kapitel Methodisch-methodologische Grundlegungen erörtert und anzuwendende Methoden beschrieben. Inhaltsanalytische Methoden wie die Frequenzanalyse sowie die qualitative Inhaltsanalyse von Mayring und die Gesprächsanalyse im Zusammenhang mit der Diskursforschung werden hier diskutiert und im letzten Schritt begründet.
Teil II: Empirische Studie: Fallspezifische Untersuchungen
Im fallanalytischen Teil wird zunächst die untersuchte Zielgruppe sowie der geplante Untersuchungsverlauf beschrieben. Dem Datenmaterial dieser Untersuchung liegen lediglich zitierte Bewerbungsgespräche zugrunde, die bei einer Untersuchung nicht stillschweigend als natürliche Gespräche behandelt werden dürfen. Aus diesem Grunde werden die durch die Simulation entstandenen Artefakte berücksichtigt und daraus schlussfolgernd eine ausführliche Beschreibung von in der Realität stattfindenden Bewerbungsgesprächen unternommen. Zur Illustration werden hierbei passende Belege des Datenmaterials der sozialen Wirklichkeit im Rollenspiel mit theoretischen Ausführungen des Bewerbungsgesprächs verflochten.
Teil III: Fazit und Ausblick
Im Schlussteil werden alle Ergebnisse zusammenfassend und verallgemeinernd präsentiert und im Anschluss an die Resultate dieser Diplomarbeit ein Ausblick vorgenommen.
Anhang Der Anhang in Form eines Anlagenbeihefts ist der Diplomarbeit beigefügt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Grundlegende Problemstellung
- 2 Zielstellung der Arbeit
- 3 Abgrenzung des Themas
- 4 Aufbau der Arbeit
- Teil I. Theoretischer Bezugsrahmen: Kommunikative Kompetenz und soziale Kommunikation
- 1 Kommunikative Kompetenz als Schlüsselfaktor
- 1.1 Zum Begriff Kommunikation
- 1.2 Zum Kompetenzbegriff
- 1.2.1 Vorbemerkungen
- 1.2.2 Der Begriff Kompetenz in sozial-kommunikativen Bezügen
- 1.3 Kommunikative Kompetenz in der wissenschaftlichen Forschung
- 1.3.1 Spitzberg/Cupach: Interpersonal Competence in communication
- 1.3.2 Das Komponentenmodell von SPITZBERG/CUPACH
- 1.3.3 Habermas: Gesellschaftliche Strukturen und Identitätsfindung
- 1.3.4 Skizzierung relevanter wissenschaftlicher Theorien
- 1.3.4.1 GRICE
- 1.3.4.2 WITTGENSTEINS Sprachspiel
- 1.3.4.3 Kommunikationspädagogische Aspekte nach GEIẞNER
- 1.3.4.4 Analyse und Vermittlung von Gesprächskompetenz
- 1.3.4.4.1 Fruchtbarkeit der Gesprächsforschung für Lehr-Lern-Prozesse.
- 1.3.4.4.2 Definition und Probleme des Begriffs „Gesprächskompetenz“
- 1.3.4.4.3 Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen von Trainingskonzepten
- 1.3.4.4.4 Sprachliche Kompetenzförderung in Schulen
- 1.4 Das wirtschaftspädagogische Konzept der Handlungskompetenz
- 1.4.1 Vorbemerkungen
- 1.4.2 Die Bedeutung kommunikativer Kompetenzen für die Handlungskompetenz
- 1.5 Konsolidierung der Begrifflichkeiten
- 2 Grundlagen sozialer Kommunikation
- 2.1 Modell sozial-kommunikativen Handelns
- 2.2 Wahrnehmungsprozesse.
- 2.2.1 Erster Eindruck
- 2.2.2 Ausstrahlung und Wirkung als Signalübermittlung
- 2.3 Rollentheorie
- 2.3.1 Revision der Rollentheorie
- 2.3.2 Die Ich-Identität als Interpretationsbasis für das Handeln in Rollen
- 2.4 Kommunikation
- 2.4.1 Verbale Kommunikation
- 2.4.2 Nonverbale Kommunikation
- 2.5 Das Selbst in der sozialen Kommunikation
- 2.5.1 Selbstkonzept und Selbstwert
- 2.5.2 Zum Konzept der Selbstdarstellung
- 2.5.3 Kommunikationsstil und Selbstwert
- 3 Das Analysemodell
- 4.1 Methodisch-methodologische Grundlegungen
- 4.1.1. Die Diskurs- und Gesprächsforschung
- 4.1.1.1 Begriffsbestimmung und Entwicklungsgeschichte
- 4.1.1.2 Analytisches Interesse und methodische Prinzipien
- 4.1.2 Inhaltsanalytische Verfahren
- 4.2.1 Die Frequenzanalyse
- 4.2.2. Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
- 4.3 Methodendiskussion
- 4.3.1 Einordnung in das Forschungsparadigma
- 4.3.2 Begründung der Methodenauswahl
- Teil II. Empirische Studie: Fallspezifische Untersuchungen zum Rollenspiel \"Bewerbungsgespräch”.
- 1 Zur Stichprobe: Junge Menschen im Modellversuch \"MDQM”
- 1.1 Die Lebensphase der Jugend.
- 1.2 Festlegung des Materials und Analyse der Entstehungssituation
- 1.3 Merkmale und Kennzeichen der Jugendlichen in MDQM I
- 1.4 Formale Charakteristika des Materials
- 1.5 Richtung der Analyse
- 1.6 Theoretische Differenzierung der Fragestellung in Bezug auf das Klientel
- 2 Beschreibung der Untersuchung.
- 3 Kommunikation im Kontext eines Bewerbungsgesprächs
- 3.1 Das Bewerbungsgespräch als Rollenspiel
- 3.1.1 Allgemeine Charakterisierung
- 3.1.2 Die Bedeutung für die Ausbildungsplatzbewerberin
- 3.1.3 Beobachtbare Artefakte der Simulation
- 3.1.4 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 3.2 Das Bewerbungsgespräch als Mittel der Personalauswahl
- 3.2.1 Die Bedeutung für das Unternehmen
- 3.2.2 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 3.3 Das Bewerbungsgespräch als Situationstyp
- 3.3.1 Allgemeine Charakterisierung
- 3.3.2 Essentielle Bestandteile
- 3.3.3.1 Elemente auf der Makroebene
- 3.3.3.1.1 Der Situation vorgelagerte Aspekte
- 3.3.3.1.2 Die Rolle der Bewerberin
- 3.3.3.1.3 Die Rolle der Personalverantwortlichen
- 3.3.3.1.4 Inhalte des Bewerbungsgesprächs
- 3.3.3.1.5 Wechselseitigkeit und Persönliche Filter
- 3.3.3.1.6 Interviewkontext
- 3.3.3.1.7 Ergebnisse
- 3.3.3.1.8 Auswirkungen
- 3.3.3.2 Sozial-kommunikative Aufgaben auf der Makroebene
- 3.3.3.2.1 Phasenstrukturelle Elemente
- 3.3.3.2.2 Sequenzstrukturelle Elemente
- 3.3.3.3 Elemente auf der Mikroebene
- 4 Erste Ergebnisse aus den Gesprächsinventaren
- 5 Transkriptionen
- 6 Frequenzanalyse über alle Bewerbungsgespräche
- 6.1 Oberflächen-Strukturen
- Gebrauchte Wortanzahl, Wörter und Redeanteile
- Extrakt
- Verwendete Sätze
- Extrakt
- Komplexität der Sprache.
- Extrakt
- 6.2 Genderlect-Ansatz
- 6.3 Kommunikationsstile nach SATIR
- Typ 1: Versöhnliche Kommunikationsform
- Typ 2: Anklagende Kommunikationsform
- Typ 3: Intellektualisierende Kommunikationsform
- Typ 4: Irrelevanter Kommunikationstyp
- Extrakt,,Kommunikationsstile“
- 6.4 Selektionskriterium Worttypen
- Extrakt,,Worttypen“.
- 6.5 Zusammenfassende Ergebnisse der Frequenzanalyse
- 7 Inhaltsanalyse
- 7.1 Allgemeines inhaltsanalytisches Vorgehen
- 7.2 Definition und Entwicklung eines Kategoriensystems
- 7.3 Inhalte im Geschlechtervergleich
- Arbeitsmotive
- Explikation
- Verdienst
- Struktur
- Freizeit
- Sicherheit
- Arbeitsbezogene Werte
- Zukünftiges berufliches Selbstbild
- Thema Beziehungen im Geschlechtervergleich
- 7.4 Ergebnisse der Inhaltsanalyse im Geschlechtervergleich
- 8 Erfassung von Ausdrucks- und Emotionskomponenten
- 8.1 Ratingskala für soziale Kompetenz (RSK)
- 8.2 Beschreibung der Kategorien
- 8.3 Ergebnisse
- 8.3.1 Übergeordnete Ergebnisse
- 8.3.2 Einzelfallbewertung der Emotions- und Ausdruckskomponenten
- 8.3.3 Strukturierung der Ergebnisse
- 9 Zusammenfassung der gesammelten Ergebnisse
- Teil III: Fazit Und Ausblick
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit der kommunikativen Kompetenz von Jugendlichen im Bewerbungsgespräch. Ziel ist es, die sprachlichen und nonverbalen Kompetenzen von Jugendlichen in der Berufsorientierung zu analysieren und zu verstehen, wie diese im Rahmen eines Rollenspiels, das ein Bewerbungsgespräch simuliert, zum Ausdruck kommen.
- Kommunikative Kompetenz im Kontext der Berufsorientierung
- Analyse von sprachlichen und nonverbalen Kommunikationsstrategien
- Die Rolle von Selbstpräsentation und Selbstdarstellung im Bewerbungsgespräch
- Die Bedeutung von Geschlechterrollen und -stereotypen in der Kommunikation
- Entwicklung eines Modells zur Analyse von kommunikativer Kompetenz im Bewerbungsgespräch
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Relevanz von kommunikativer Kompetenz im Berufsleben. Kapitel 1 beleuchtet den theoretischen Bezugsrahmen, indem es den Begriff der Kommunikation und den Kompetenzbegriff im Kontext sozialer Kommunikation behandelt. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung und Bedeutung von kommunikativer Kompetenz im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung und im wirtschaftspädagogischen Kontext.
Kapitel 2 widmet sich den Grundlagen sozialer Kommunikation, darunter Wahrnehmungsprozesse, Rollentheorie und das Selbst in der sozialen Kommunikation. Hier werden wichtige Aspekte wie der erste Eindruck, Selbstdarstellung und Kommunikationsstil beleuchtet.
Kapitel 3 befasst sich mit der empirischen Studie und analysiert das Rollenspiel "Bewerbungsgespräch". Es werden die Stichprobe, das Material und die Entstehungssituation der Studie beschrieben. Zudem wird das Bewerbungsgespräch als Situationstyp und seine Bedeutung für Bewerber und Unternehmen untersucht.
Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Studie, die sich auf die Frequenzanalyse und die Inhaltsanalyse der Gesprächsinventaren stützen. Es werden verschiedene Aspekte der Kommunikation im Bewerbungsgespräch, wie sprachliche Komplexität, Kommunikationsstile und das Auftreten der Jugendlichen, untersucht.
Kapitel 5 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Bedeutung der Studie für die Berufsorientierung und die Ausbildung von Jugendlichen. Es werden auch mögliche Implikationen für die Praxis der Berufsberatung und die Gestaltung von Bewerbungstrainings aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die kommunikative Kompetenz von Jugendlichen im Bewerbungsgespräch, insbesondere auf die Analyse von sprachlichen und nonverbalen Kommunikationsstrategien, Selbstpräsentation, Selbstdarstellung, Geschlechterrollen, Rollenspiel, Berufsorientierung, Handlungskompetenz und die Entwicklung eines Modells zur Analyse von kommunikativer Kompetenz.
- Citation du texte
- Katja Rohlfs (Auteur), 2005, Kommunikative Kompetenz von Jugendlichen im Bewerbungsgespräch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167128