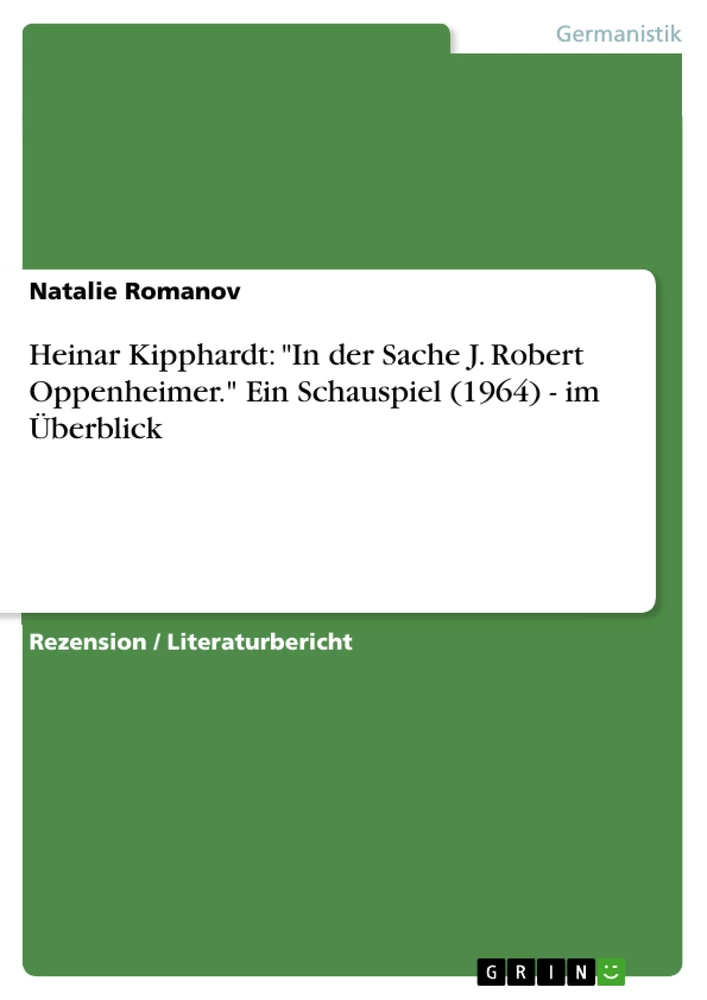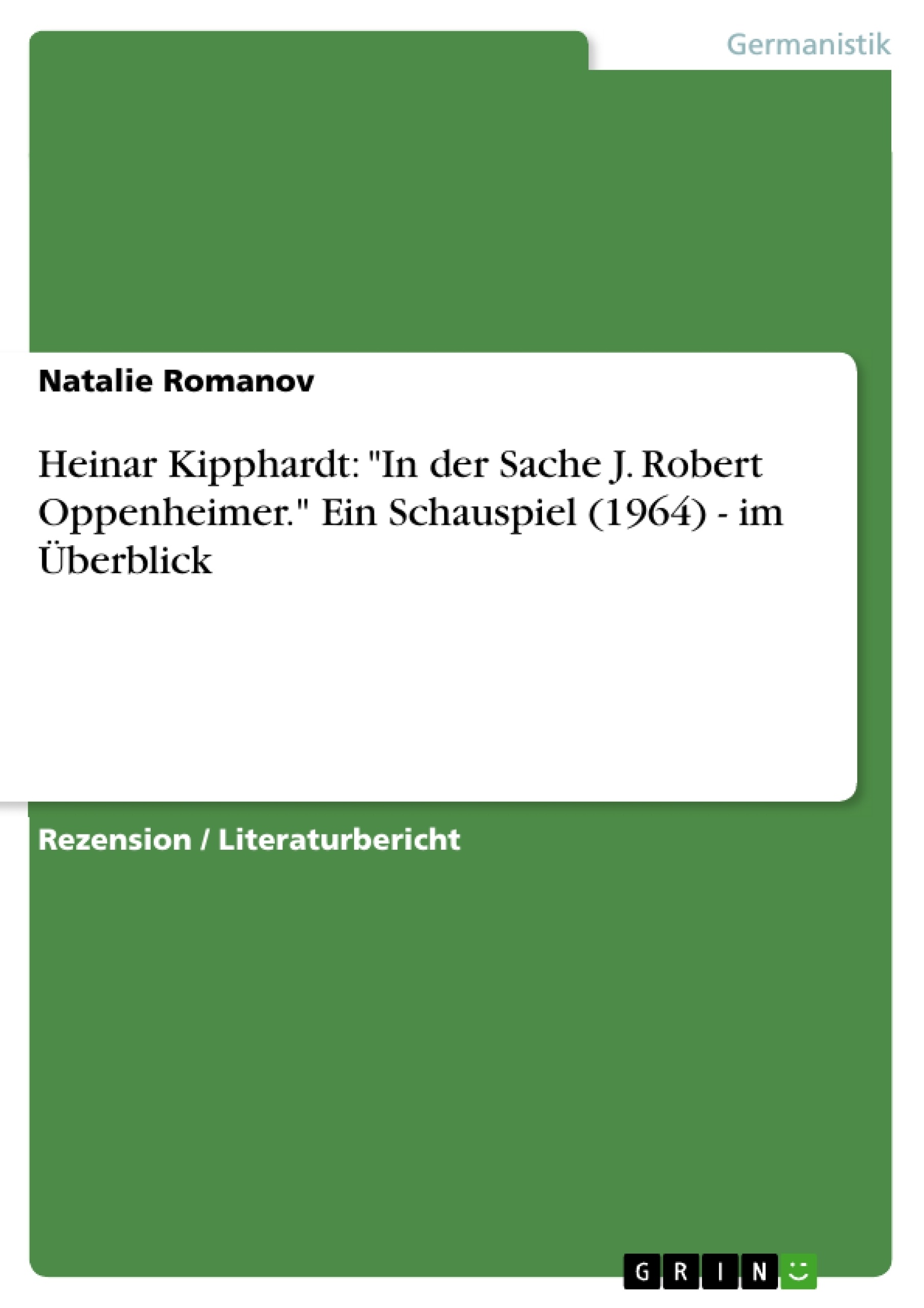“6. August 1945, 8:15 Uhr: Die Sprengkraft von „Little Boy“ entspricht 15 Kilotonnen TNT. Es breitet sich ein riesiger Pilz aus. Rund eine halbe Stunde später fällt aus der Wolke schwarzer radioaktiver Regen. Little Boy hinterlässt ein nie da gewesenes Ausmaß der Zerstörung.“ (Quelle: oe1.orf.at) Jeder kennt letztere Bilder, die sich der Welt offenbarten, als die erste Atombombe „Little Boy“ von den Amerikanern auf Hiroshima abgeworfen wurde: Man sah einem neuen atomaren Zeitalter entgegen, die selbst den „Vater der Atombombe“, Julius Robert Oppenheimer erschreckte. Moralische Skrupel äußernd, wurde die Verantwortung des Wissenschaftlers gegenüber der Menschheit in den nächsten Jahrzehnten zum viel diskutierten Thema: So auch in Heinar Kipphardts Dokumentartheater „In der Sache J. Robert Oppenheimer“, das 1964 uraufgeführt wurde.
Das Stück selbst handelt von den drei unerträglichen Wochen Oppenheimers im Jahre 1954, wo er, aufgrund der Loyalitätsfrage bei seiner Weigerung, am Bau der Wasserstoffbombe 1951 mitzuwirken und seinen kommunistischen Neigungen, heftigsten Verhören ausgesetzt ist und schließlich zum Sicherheitsrisiko abgestempelt wird. Nichts desto trotz ist es nicht letztere Tatsache, die ihn am meisten bestürzt: „OPPENHEIMER: An diesem Kreuzweg empfinden wir Physiker, dass wir niemals so viel Bedeutung hatten und dass wir niemals so ohnmächtig waren.“ [S.140/4-6f] Ob der berühmte Wissenschaftler auch wirklich so dachte, kann in Frage gestellt werden- Tatsache ist, dass
Inhaltsverzeichnis
- Akt I
- Akt II
- Akt III
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Stück "In der Sache J. Robert Oppenheimer" von Heinar Kipphardt befasst sich mit den dreiwöchigen Verhören Oppenheimers im Jahr 1954. Es untersucht die moralischen und ethischen Konflikte des Wissenschaftlers im Kontext seiner Beteiligung am Manhattan-Projekt und seiner Weigerung, an der Entwicklung der Wasserstoffbombe mitzuwirken. Das Stück beleuchtet die komplexen und widersprüchlichen Aspekte von Oppenheimers Persönlichkeit und Wirken.
- Moralische Verantwortung von Wissenschaftlern
- Die ethischen Dilemmata der Atomforschung
- Der Konflikt zwischen wissenschaftlicher Neugier und gesellschaftlicher Verantwortung
- Die Darstellung von Oppenheimer als komplexe Persönlichkeit
- Das politische Klima des Kalten Krieges und die Folgen für die Wissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Akt I: Der erste Akt führt in die Verhörsituation Oppenheimers ein und präsentiert seine widersprüchliche Persönlichkeit. Oppenheimer wird als arroganter und gefühlskalter Wissenschaftler dargestellt, der seine moralischen Bedenken zunächst nur implizit zum Ausdruck bringt, zum Beispiel durch Zitate aus Hamlet. Seine Beteiligung an der Chevalier-Affäre wird beleuchtet, wobei sein Verhalten und seine Erklärungen ("Weil ich ein Idiot war") seine Unsicherheit und seinen Mangel an Selbstreflexion offenbaren. Der Akt legt den Fokus auf die Spannung zwischen Oppenheimers wissenschaftlicher Brillanz und seinem moralischen Versagen.
Akt II: Der zweite Akt vertieft die Auseinandersetzung mit Oppenheimers moralischen Konflikten. Die Zeugenaussagen von Bethe, Rabi und Teller beleuchten die verschiedenen Haltungen und Entscheidungsfindungen innerhalb der Wissenschaftlergemeinschaft in Bezug auf das Wasserstoffbombenprogramm. Die Aussagen der Zeugen dienen dazu, Oppenheimers Charakter und sein Verhalten im Kontext der Gesamtlage zu beleuchten und zu relativieren. Der Akt verdeutlicht die komplexen Überlegungen, die hinter den Entscheidungen der beteiligten Wissenschaftler standen.
Akt III: Der dritte Akt beschreibt den weiteren Verlauf des Verhörs und die Darstellung des persönlichen Konflikts Oppenheimers. Kipphardt konstruiert eine fiktive Schlusssrede für Oppenheimer, in welcher dieser seine Verantwortung und sein Bedauern über seine Handlungen reflektiert. Diese Rede kontrastiert stark mit dem Verhalten Oppenheimers in den vorherigen Akten und zeigt dessen ambivalenten Charakter. Der Akt zeigt die schlussendliche Bewertung Oppenheimers und die implizite Kritik an der politischen Instrumentalisierung von Wissenschaft.
Schlüsselwörter
J. Robert Oppenheimer, Atombombe, Wasserstoffbombe, Manhattan-Projekt, Moral, Verantwortung, Wissenschaft, Politik, Kalter Krieg, Widerspruch, Ambivalenz.
Häufig gestellte Fragen zu "In der Sache J. Robert Oppenheimer"
Was ist der Inhalt des Stücks "In der Sache J. Robert Oppenheimer"?
Das Stück von Heinar Kipphardt schildert die dreiwöchigen Verhöre von J. Robert Oppenheimer im Jahr 1954. Es behandelt seine Beteiligung am Manhattan-Projekt, seine Weigerung, an der Wasserstoffbombe mitzuwirken, und die damit verbundenen moralischen und ethischen Konflikte.
Welche Themen werden im Stück behandelt?
Zentrale Themen sind die moralische Verantwortung von Wissenschaftlern, die ethischen Dilemmata der Atomforschung, der Konflikt zwischen wissenschaftlicher Neugier und gesellschaftlicher Verantwortung, die komplexe Persönlichkeit Oppenheimers und der Einfluss des Kalten Krieges auf die Wissenschaft.
Wie ist das Stück aufgebaut?
Das Drama ist in drei Akte gegliedert. Akt I führt in die Verhörsituation ein und präsentiert Oppenheimers widersprüchliche Persönlichkeit. Akt II vertieft die moralischen Konflikte durch Zeugenaussagen. Akt III zeigt den Verlauf des Verhörs und Oppenheimers persönliche Auseinandersetzung mit seiner Verantwortung, inklusive einer fiktiven Schlusssrede.
Wie wird Oppenheimer im Stück dargestellt?
Oppenheimer wird als ambivalente Figur dargestellt: brillant, aber auch arrogant und gefühlskalt. Das Stück zeigt seine moralischen Zweifel und sein letztliches Bedauern, jedoch auch seine anfängliche Unsicherheit und den Mangel an Selbstreflexion.
Welche Rolle spielt der Kalte Krieg im Stück?
Der Kalte Krieg bildet den politischen Hintergrund und beeinflusst die Entscheidungen und die moralischen Dilemmata der beteiligten Wissenschaftler. Das Stück impliziert eine Kritik an der politischen Instrumentalisierung von Wissenschaft.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Stück?
Schlüsselwörter sind: J. Robert Oppenheimer, Atombombe, Wasserstoffbombe, Manhattan-Projekt, Moral, Verantwortung, Wissenschaft, Politik, Kalter Krieg, Widerspruch, Ambivalenz.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Akte?
Akt I: Einführung in die Verhörsituation, Darstellung von Oppenheimers widersprüchlicher Persönlichkeit und seiner Beteiligung an der Chevalier-Affäre. Akt II: Vertiefung der moralischen Konflikte durch Zeugenaussagen, Beleuchtung der verschiedenen Haltungen innerhalb der Wissenschaftlergemeinschaft. Akt III: Weiterer Verlauf des Verhörs, Oppenheimers persönlicher Konflikt und seine fiktive Schlusssrede, die seine Verantwortung und sein Bedauern reflektiert.
Wofür ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument dient als umfassende Übersicht des Stücks "In der Sache J. Robert Oppenheimer" und ist für akademische Zwecke gedacht, um die Analyse der im Stück behandelten Themen zu erleichtern.
- Quote paper
- Bsc Natalie Romanov (Author), 2009, Heinar Kipphardt: "In der Sache J. Robert Oppenheimer." Ein Schauspiel (1964) - im Überblick, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166986