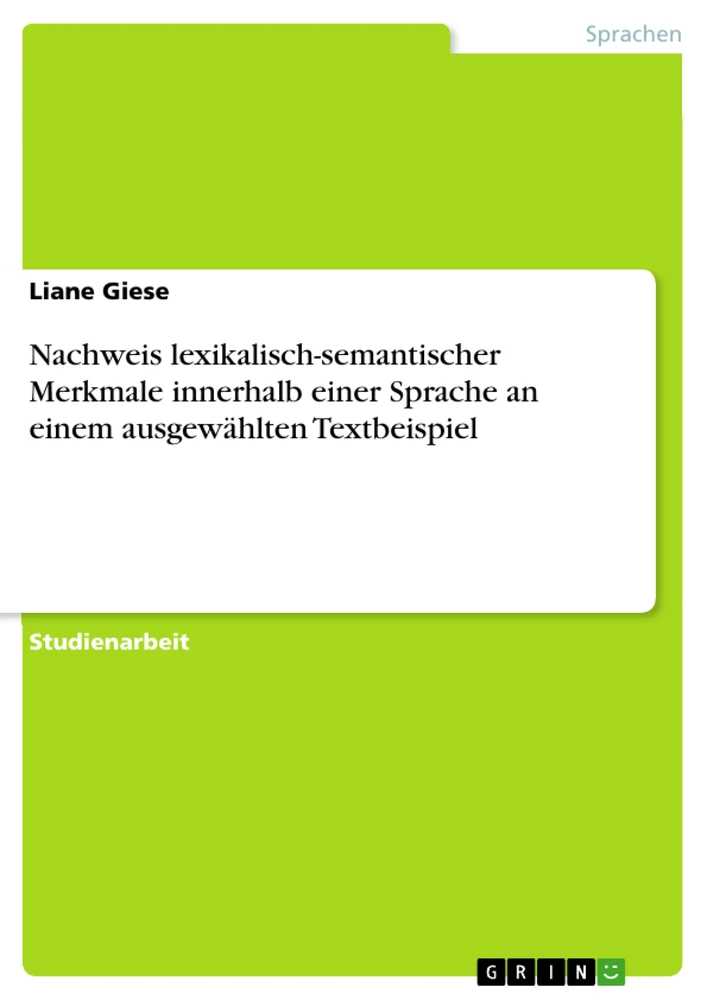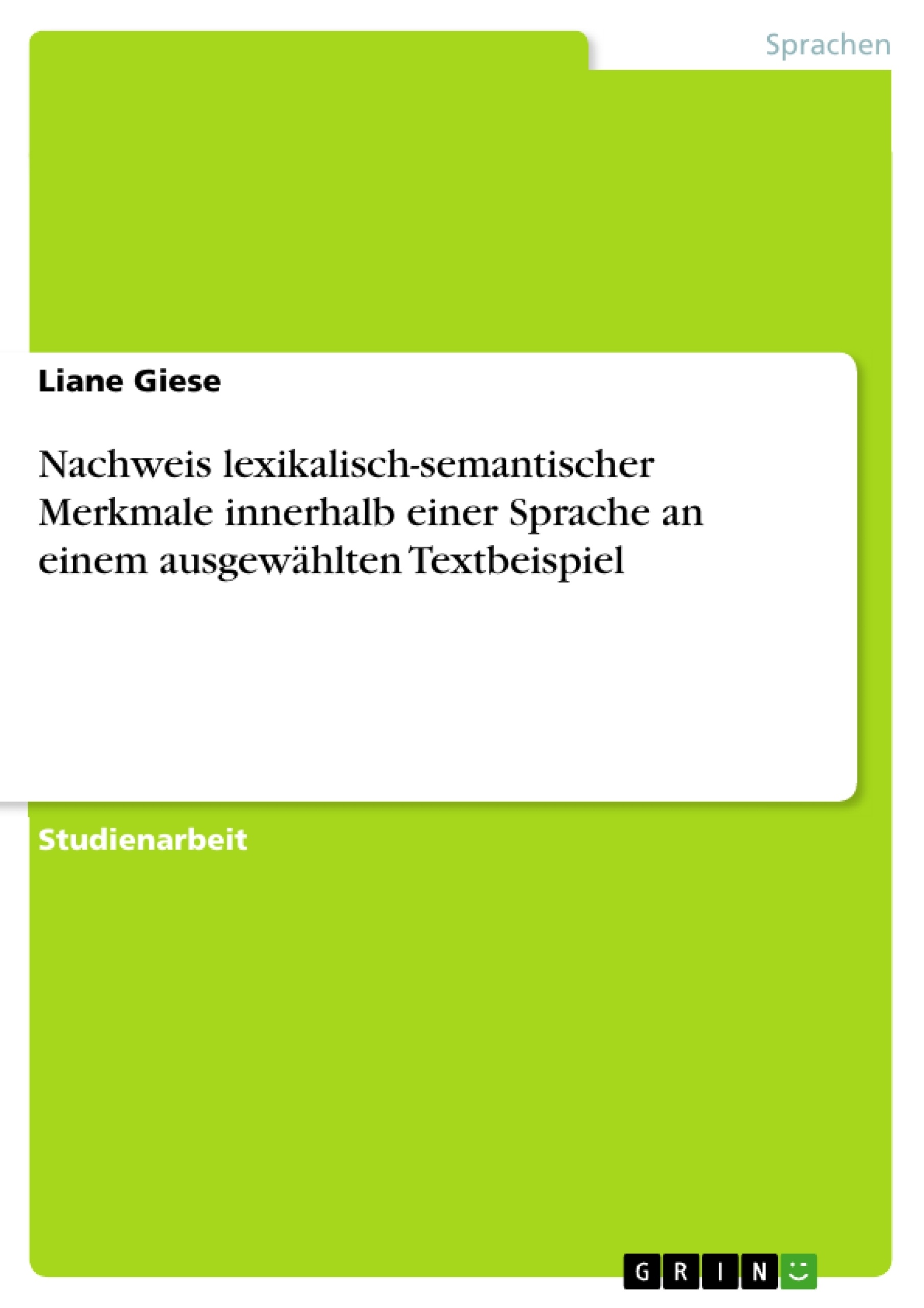Der Gesamtwortbestand des Deutschen wird auf 5 bis 10 Millionen Wörter geschätzt. Praktisch benötigt jeder Sprecher jedoch nur 6 000 bis 10 000 Wörter zur Verständigung. Dass es jedoch gar nicht so sehr auf das einzelne Wort, als vielmehr auf seine lexikalisch und lexikalisch-semantischen Merkmale innerhalb der deutschen Gegenwartssprache ankommt, möchte ich auf den folgenden Seiten nachweisen.
Die Grundlage für diese Arbeit ist ein Fernsehauftritt von Jasmin Tabatabei und Benno Führmann im „ZDF-Morgenmagazin“. Die Gesprächsgrundlage bildet ein Zeichentrickfilm, den sie synchronisiert haben. Ausgewählt habe ich dieses Gespräch, da es durch die gelockerte Atmosphäre des „Morgenmagazins“ und die Dreier-Konstellation der Gesprächsteilnehmer nah an die Privatheit mündlicher Kommunikation heranreicht. Obwohl es ein Interview ist, erinnert es doch mehr an einen Talkshowausschnitt.
Zuerst einmal werde ich den Untersuchungsgegenstand der Lexik, als Teildisziplin der Linguistik, beschreiben und auf das Lexem, als die Einheit innerhalb der Lexik, eingehen. Die verschiedenen Unterscheidungsmöglichkeiten lexikalischer Einheiten werde ich kurz schildern und auf zwei näher eingehen. Daraufhin werde ich mich mit den im Text vorkommenden Wortbildungsprozessen befassen. Abschließend möchte ich noch, an ausgewählten Textstücken beweisen, dass die Polysemie ein Folge des Bedeutungswandels innerhalb einer Sprachgemeinschaft ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Untersuchungsgegenstand der Lexik
- 2.1. Das Lexem
- 3. Transkription
- 4. Unterscheidungsmöglichkeiten der lexikalischen Einheiten innerhalb eines Textes
- 4.1 Der Grundwortschatz eines ausgewählten Textstückes
- 4.2 Autosemantika und Synsematika
- 5. Wortbildungsprozesse der Transkription
- 5.1 Komposition
- 5.2 Derivation
- 5.3 Lexikalisierung
- 5.4 Mündliche lexikalische Alternativen
- 6. Polysemie als Folge des Bedeutungswandels
- 7. Ausblick
- 8. Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die lexikalischen und lexikalisch-semantischen Merkmale eines ausgewählten Textbeispiels, einem Fernsehauftritt von Jasmin Tabatabei und Benno Führmann im „ZDF-Morgenmagazin“, zu untersuchen. Die Analyse soll aufzeigen, wie die Lexik der deutschen Gegenwartssprache funktioniert und wie Wörter ihre Bedeutung im Kontext von mündlicher Kommunikation verändern können.
- Das Lexem als Einheit der Lexik
- Unterscheidungsmöglichkeiten lexikalischer Einheiten im Text
- Wortbildungsprozesse in der Transkription
- Polysemie als Folge des Bedeutungswandels
- Sprache als dynamisches System
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt den Leser in die Thematik ein und erläutert die Relevanz der lexikalischen Merkmale innerhalb einer Sprache. Anschließend werden die Grundlagen der Lexik als Teildisziplin der Linguistik beschrieben und das Lexem als lexikalische Einheit beleuchtet. Die Arbeit geht dann auf die Unterscheidungsmöglichkeiten lexikalischer Einheiten im Text ein und stellt den Grundwortschatz und die Unterscheidung von Autosemantika und Synsematika vor. Es werden die verschiedenen Wortbildungsprozesse der Transkription, wie Komposition, Derivation und Lexikalisierung, erörtert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen der Lexik, wie Lexem, Wortschatz, Autosemantika, Synsematika, Polysemie und Bedeutungswandel. Sie analysiert die lexikalischen Merkmale eines ausgewählten Textbeispiels und untersucht die Bedeutungswandelsprozesse im Kontext von mündlicher Kommunikation.
- Quote paper
- B.A. Liane Giese (Author), 2004, Nachweis lexikalisch-semantischer Merkmale innerhalb einer Sprache an einem ausgewählten Textbeispiel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166963