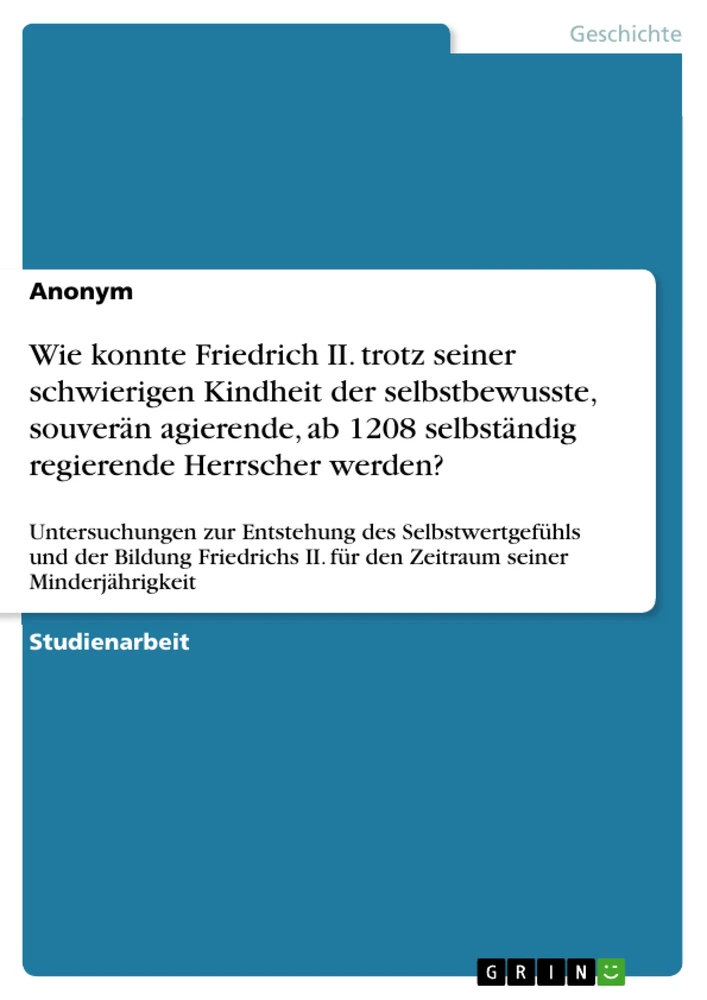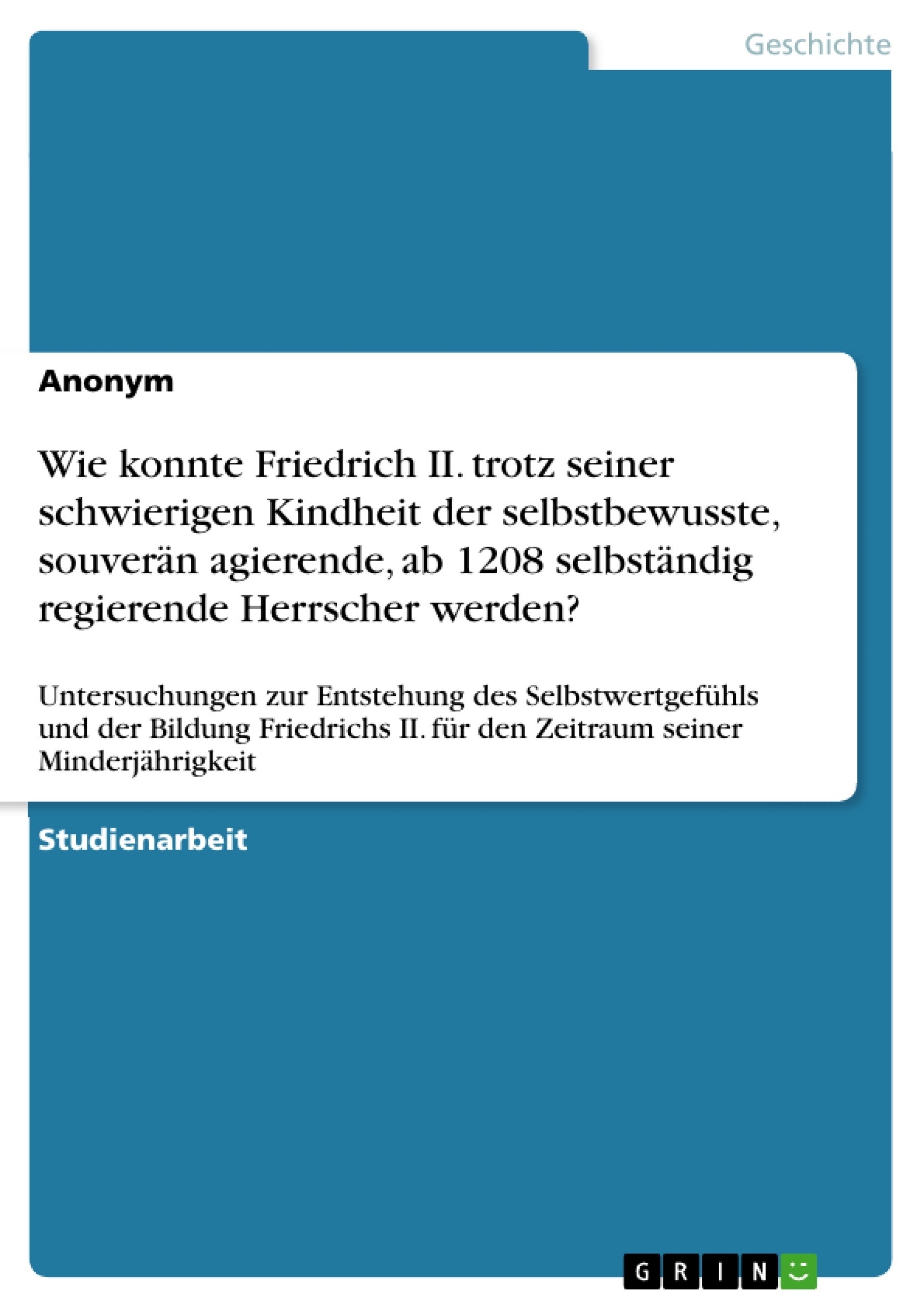Seit Jahrhunderten fasziniert die Gestalt Friedrichs II., des letzten Stauferkaisers, Forschergenerationen sämtlicher Epochen. Die Masse der stetig wachsenden Zahl an Forschungsbeiträgen droht derzeit den ambitionierten Historiker zu übermannen. Neben Karl Hampes Schriften zu Beginn des 20. Jahrhunderts sorgte vor allem das umstrittene Werk Ernst Kantorowicz’ (1927-1931) in der Friedrich-Forschung für Aufsehen. Die Mythisierung der Person Friedrichs II. in dieser Biographie wirke auch auf die jüngeren Arbeiten zum Leben des Staufers. Dem Beitrag Hans Martin Schallers von 1964 folgte das Buch Eberhard Horsts. In den folgenden Jahren wand sich die Forschung von Endzeiterwartung- und Antichrist-Schwerpunkten ab, um sich sozialgeschichtlichen Ansätzen zu widmen. Neue Forschungsarbeiten thematisierten vor allem Friedrich II. im Kontext der Naturphilosophie und der Naturwissenschaften, sowie sein künstlerisches und literarisches Schaffen, ferner auch seine Bauwerke, die Arbeit seiner Kanzlei und der Großgerichtshöfe . Die aktuellsten Arbeiten legten Theo Kölzer, mit verfassungsgeschichtlichem Schwerpunkt, und Wolfgang Stürner mit der ausführlichsten Biographie seit Kantorowicz, vor. Jedoch bleiben viele Lebensbereiche Friedrichs II. unbeleuchtet oder bedürfen eines neuen Ansatzes.
In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, darzulegen, wie sich aus dem jungen König von Sizilien der ab 1208 selbstständige und eigenmächtig regierende Herrscher entwickelte. Beginnend mit dem Streit um die Neubesetzung des Erzbischofstuhles von Palermo begegnet Friedrich II. dem Betrachter im Jahr 1208 als eine Persönlichkeit, die eine erstaunliche Bildung und ein ausgeprägtes Bewusstsein für die Stellung und Rechte des sizilischen Königs besaß. Seine konsequente Revokationspolitik, Kirchenämterneubesetzungen und die Unabhängigkeitsbestrebungen von Papst Innozenz III., sowie sein selbstsicheres, keine Reglementierung duldendes Auftreten , charakterisieren den Herrscher nach seinem Regierungsantritt im Besonderen .
Doch wie war es möglich, dass Friedrich II., nach einer aus den Fugen geratenen, schwierigen Kindheit, überhaupt in dieser Weise auftrat?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Selbstwahrnehmung der Bedeutung der eigenen Person
- Wirkung der Schar verschiedener Vormunde und seiner Legitimationsfunktion
- Bewusstseinsschaffung durch Bedrohung und Schutz
- Das Erlernen des königlichen Handwerks
- Legaten und Lehrer
- Erziehung durch die „,Straße\"?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, wie sich aus dem jungen König von Sizilien der ab 1208 selbstständig und eigenmächtig regierende Herrscher entwickelte. Dabei konzentriert sie sich auf zwei zentrale Aspekte: die frühzeitige Selbstwahrnehmung Friedrichs II. und seine umfassende Bildung und Erziehung.
- Die Entstehung des Selbstwertgefühls bei Friedrich II. im Kontext seiner Kindheit und Jugend
- Der Einfluss verschiedener Vormunde auf die Entwicklung von Friedrichs Selbstbild
- Die Rolle von Bedrohungen und Schutzmaßnahmen für das Bewusstsein Friedrichs II.
- Die Bedeutung von Legaten und Lehrern für die Bildung Friedrichs II.
- Die möglichen Auswirkungen des „Straßenlebens“ auf Friedrichs Bildungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Entstehung des Selbstwertgefühls bei Friedrich II. Es untersucht den Einfluss verschiedener Vormunde und die Rolle von Bedrohungen und Schutzmaßnahmen für die Entwicklung von Friedrichs Selbstbild.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der umfassenden Bildung und Erziehung Friedrichs II. Hierbei werden die Legaten und Lehrer sowie die möglichen Auswirkungen des „Straßenlebens“ auf seine Bildung analysiert.
Schlüsselwörter
Friedrich II., Stauferkaiser, Selbstwahrnehmung, Selbstwertgefühl, Bildung, Erziehung, Minderjährigkeit, Vormunde, Legaten, Lehrer, „Straßenleben“, Quellenkritik, Historiographie.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2008, Wie konnte Friedrich II. trotz seiner schwierigen Kindheit der selbstbewusste, souverän agierende, ab 1208 selbständig regierende Herrscher werden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166847