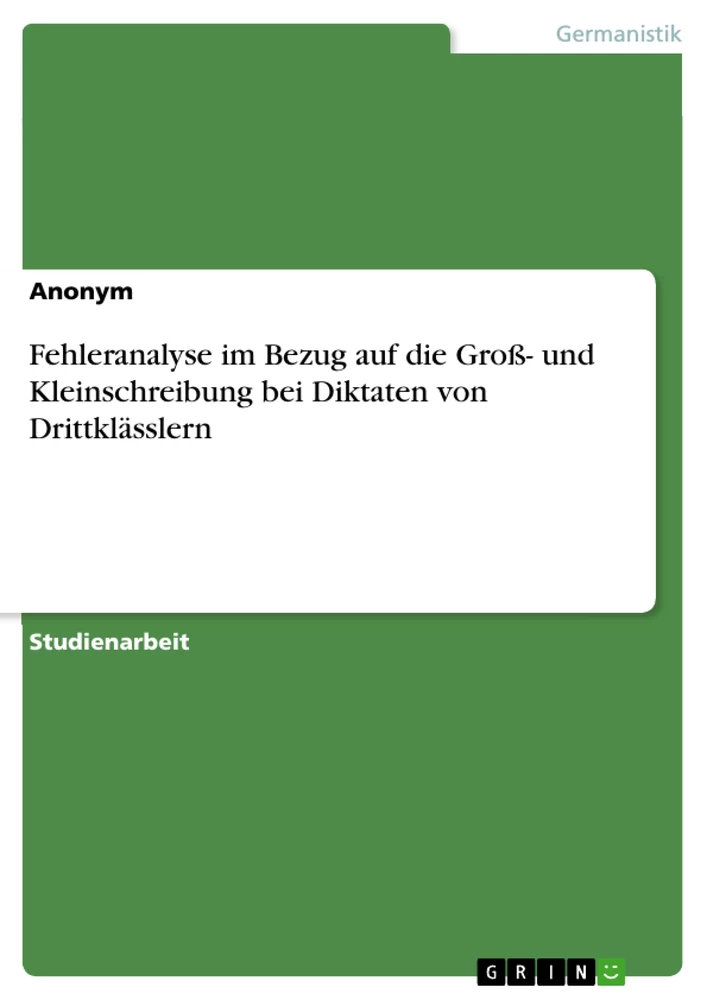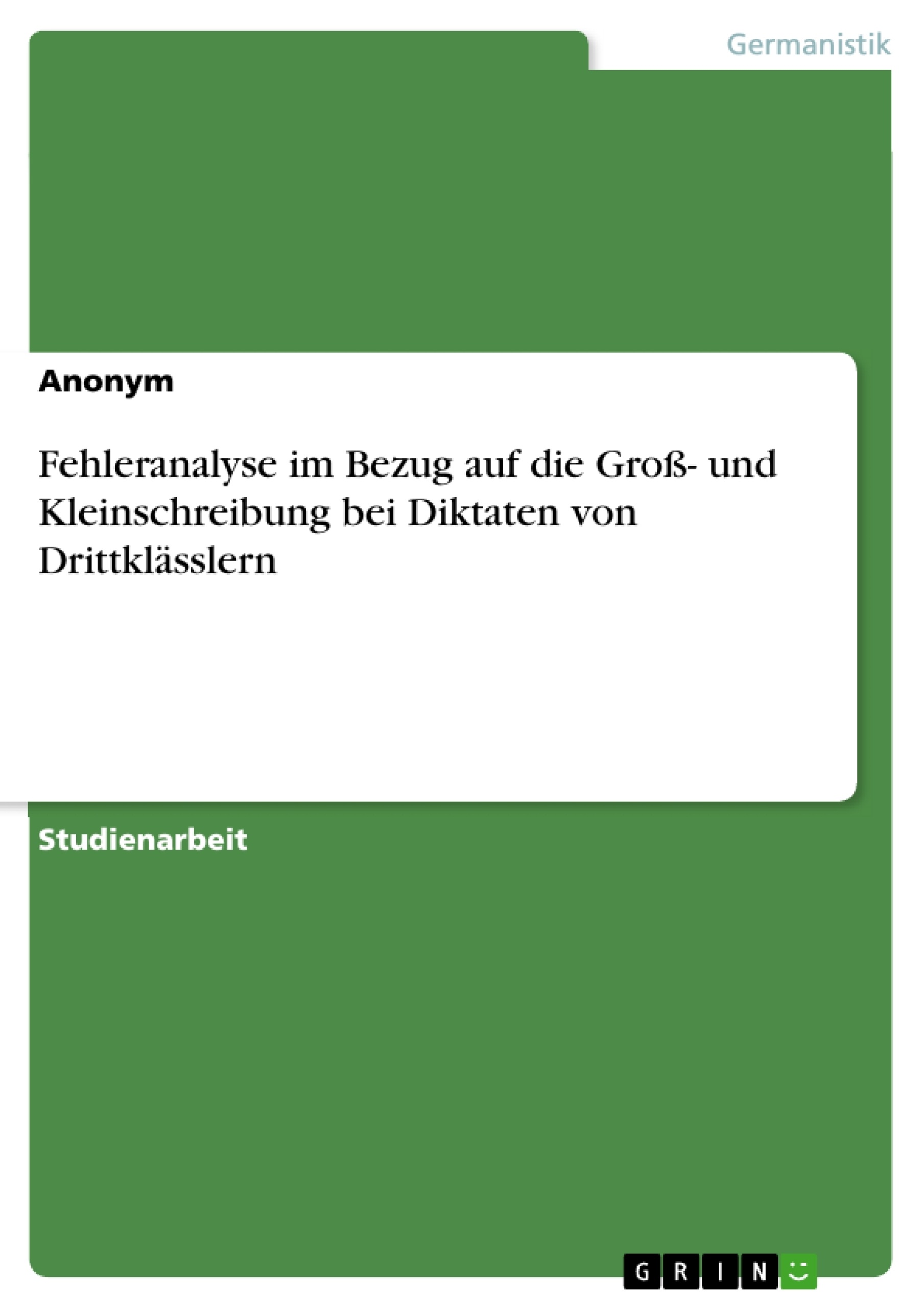Einleitung
„Im Barock fing das Schreibchaos an“ (Schröder 2004, Online im Internet). So titelt die Überschrift eines Artikels zum Thema Groß- und Kleinschreibung, welcher im Textarchiv der Berliner Zeitung zu finden ist. Dies zeigt, dass die Antwort auf die Frage Majuskel- ja oder nein? für die Gesellschaft nicht selbstverständlich ist und für viele im Alltag Probleme darstellt. Und zwar sowohl für Groß als auch Klein. Denn nicht nur Kinder sprich Schüler haben oft große Probleme damit, die richtigen Wörter in ihren Diktaten, Aufsätzen und Texten mit einer Majuskel zu versehen. Auch Studierende und somit zukünftige Lehrkräfte sind sich der Groß- und Kleinschreibung nicht immer sicher (vgl. Röber- Siekmeyer 1999, S. 13). Nicht umsonst gilt das Deutsche als eine der am schwersten zu erlernenden Sprachen -nicht zuletzt aufgrund seines komplex wirkenden Systems der Groß- und Kleinschreibung.
Doch woher kommen eigentlich diese Probleme bei der Entscheidung Majuskel- ja oder nein? Lernt man doch bereits in der Grundschule, dass bloß Nomen und Wörter an einem Satzanfang großgeschrieben werden. Auch dafür, woran man ein Nomen erkennt, gibt es im Sprachbuch eine klare Regel: „Nomen sind Namen für Menschen, Tiere, Pflanzen und Dinge“ (Spracharbeitsheft 2, Teil A 2006, S. 17).
Paradox im Bezug dazu wirkt dann jedoch, dass das Regelwerk der Groß- und Kleinschreibung im Duden hingegen 13 Paragraphen für dessen Erklärung vorsieht. Bedenkt man, dass es bloß 113 Paragraphen gibt, macht dies immerhin 11,5 % des Gesamtregelwerkes aus. Beim Durchlesen hat man das Gefühl, dass es die Autoren einfach nicht schafften, die Regularitäten dafür auf einen Nenner zu bringen und deshalb einen Ausnahmefall an den nächsten reihten.
Wenn man sich zudem einen beliebigen Text ansieht und bewusst auf die Groß- und Kleinschreibung darin achtet, sieht man, dass diese eben nicht einfach bloß durch die oben genannte Regel aus dem Sprachbuch zu erlernen ist.
Trotz alledem wird an Grundschulen nach wie vor die an Wortarten gebundene Großschreibung gelehrt (vgl. Günther& Nünke 2005, S. 9), ohne dass dabei auf den textlichen Zusammenhang geachtet wird. Diese falsche Betrachtung bringt für die Schüler Probleme mit sich und mindert ihre Kompetenzen in diesem Bereich des Rechtschreibens...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Groß- und Kleinschreibung im Bildungsplan
- 2. Die Lehre der Groß- und Kleinschreibung an der Grundschule
- 2.1 Das Nomen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Defizite der wortartenbezogenen Lehre der Groß- und Kleinschreibung an Grundschulen. Sie analysiert den Bildungsplan im Hinblick auf die Erwartungen an Lehrkräfte und die Folgen der wortartenbezogenen Methode. Weiterhin werden die in der Schule angewandten Regeln und deren Auswirkungen auf die Schreibkompetenz von Schülern untersucht. Die Analyse basiert auf Diktaten von Drittklässlern.
- Analyse der wortartenbezogenen Methode der Groß- und Kleinschreibung im Grundschulunterricht
- Untersuchung des Bildungsplans und seiner Vorgaben zur Rechtschreibung
- Bewertung der didaktischen Ansätze in verwendeten Sprachbüchern
- Auswirkungen der Lehrmethoden auf die Schreibkompetenz von Drittklässlern
- Fehleranalyse anhand von Schülerdiktaten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Groß- und Kleinschreibung im Bildungsplan: Dieses Kapitel analysiert den Bildungsplan der Grundschule von 2004 im Hinblick auf die Kompetenzen im Bereich Rechtschreibung, insbesondere die Groß- und Kleinschreibung. Es wird deutlich, dass der Bildungsplan ein „Gespür“ für orthografische Regelungen statt expliziter Regeln betont. Die Lehrkräfte sollen die Schüler größtenteils autodidaktisch zum Rechtschreiben anleiten. Die Fokussierung auf die Großschreibung von Nomen und Satzanfängen am Ende der vierten Klasse wird als unzureichend für ein umfassendes Verständnis der Groß- und Kleinschreibung kritisiert, da die komplexeren Regeln vernachlässigt werden.
2. Die Lehre der Groß- und Kleinschreibung an der Grundschule: Dieses Kapitel untersucht die didaktischen Ansätze der Groß- und Kleinschreibung im Grundschulunterricht, basierend auf den verwendeten Sprachbüchern (Bausteine Spracharbeitshefte). Der Fokus liegt auf der wortartenbezogenen Einführung der Regeln. Das Kapitel beschreibt die schrittweise Einführung der vier relevanten Wortarten (Nomen, Verb, Adjektiv, Artikel) und deren Rolle beim Erlernen der Groß- und Kleinschreibung. Die eingeschränkte Berücksichtigung von Kontext und Textverständnis wird als problematisch für die Entwicklung der Schreibkompetenz der Schüler dargestellt. Ein Beispiel aus einem Spracharbeitsheft veranschaulicht die wortartenbezogene Herangehensweise an die Großschreibung von Nomen.
Schlüsselwörter
Groß- und Kleinschreibung, Rechtschreibung, Grundschule, Bildungsplan, Wortarten, Didaktik, Fehleranalyse, Diktate, Drittklässler, Spracharbeitsheft, Nomen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Groß- und Kleinschreibung im Grundschulunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Defizite der wortartenbezogenen Methode beim Lehren der Groß- und Kleinschreibung an Grundschulen. Sie untersucht den Bildungsplan, die angewandten Regeln im Unterricht, deren Auswirkungen auf die Schreibkompetenz von Schülern und bewertet die didaktischen Ansätze in verwendeten Sprachbüchern. Die Analyse basiert auf Diktaten von Drittklässlern.
Welche Aspekte des Bildungsplans werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Bildungsplan von 2004 im Hinblick auf die Kompetenzen in Rechtschreibung, insbesondere die Groß- und Kleinschreibung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Kritik an der unzureichenden Fokussierung auf die komplexeren Regeln der Groß- und Kleinschreibung, die zu einem „Gespür“ für orthografische Regelungen anstatt expliziter Regeln führt.
Wie wird die wortartenbezogene Methode der Groß- und Kleinschreibung im Grundschulunterricht untersucht?
Die Arbeit analysiert die didaktischen Ansätze der wortartenbezogenen Einführung der Groß- und Kleinschreibung, basierend auf verwendeten Sprachbüchern (z.B. Baustein Spracharbeitshefte). Sie beschreibt die schrittweise Einführung der relevanten Wortarten (Nomen, Verb, Adjektiv, Artikel) und deren Rolle im Lernprozess. Die eingeschränkte Berücksichtigung von Kontext und Textverständnis wird kritisch beleuchtet.
Welche Rolle spielen Schülerdiktate in der Analyse?
Schülerdiktate von Drittklässlern dienen als Grundlage für die Fehleranalyse und die Bewertung der Auswirkungen der Lehrmethoden auf die Schreibkompetenz der Schüler. Die Ergebnisse der Fehleranalyse liefern wichtige Erkenntnisse über die Wirksamkeit der wortartenbezogenen Methode.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die den Bildungsplan (Kapitel 1) und die didaktischen Ansätze im Grundschulunterricht (Kapitel 2) im Detail untersuchen. Kapitel 1 analysiert den Bildungsplan von 2004 und dessen Vorgaben zur Rechtschreibung. Kapitel 2 konzentriert sich auf die wortartenbezogene Methode, die in den verwendeten Sprachbüchern angewandt wird, und beleuchtet die damit verbundenen Probleme.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit kritisiert die unzureichende Berücksichtigung komplexerer Regeln der Groß- und Kleinschreibung im Bildungsplan und die eingeschränkte Berücksichtigung von Kontext und Textverständnis in der wortartenbezogenen Methode. Die Ergebnisse der Fehleranalyse anhand von Schülerdiktaten zeigen die Auswirkungen dieser Defizite auf die Schreibkompetenz der Schüler.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Groß- und Kleinschreibung, Rechtschreibung, Grundschule, Bildungsplan, Wortarten, Didaktik, Fehleranalyse, Diktate, Drittklässler, Spracharbeitsheft, Nomen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2009, Fehleranalyse im Bezug auf die Groß- und Kleinschreibung bei Diktaten von Drittklässlern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166658